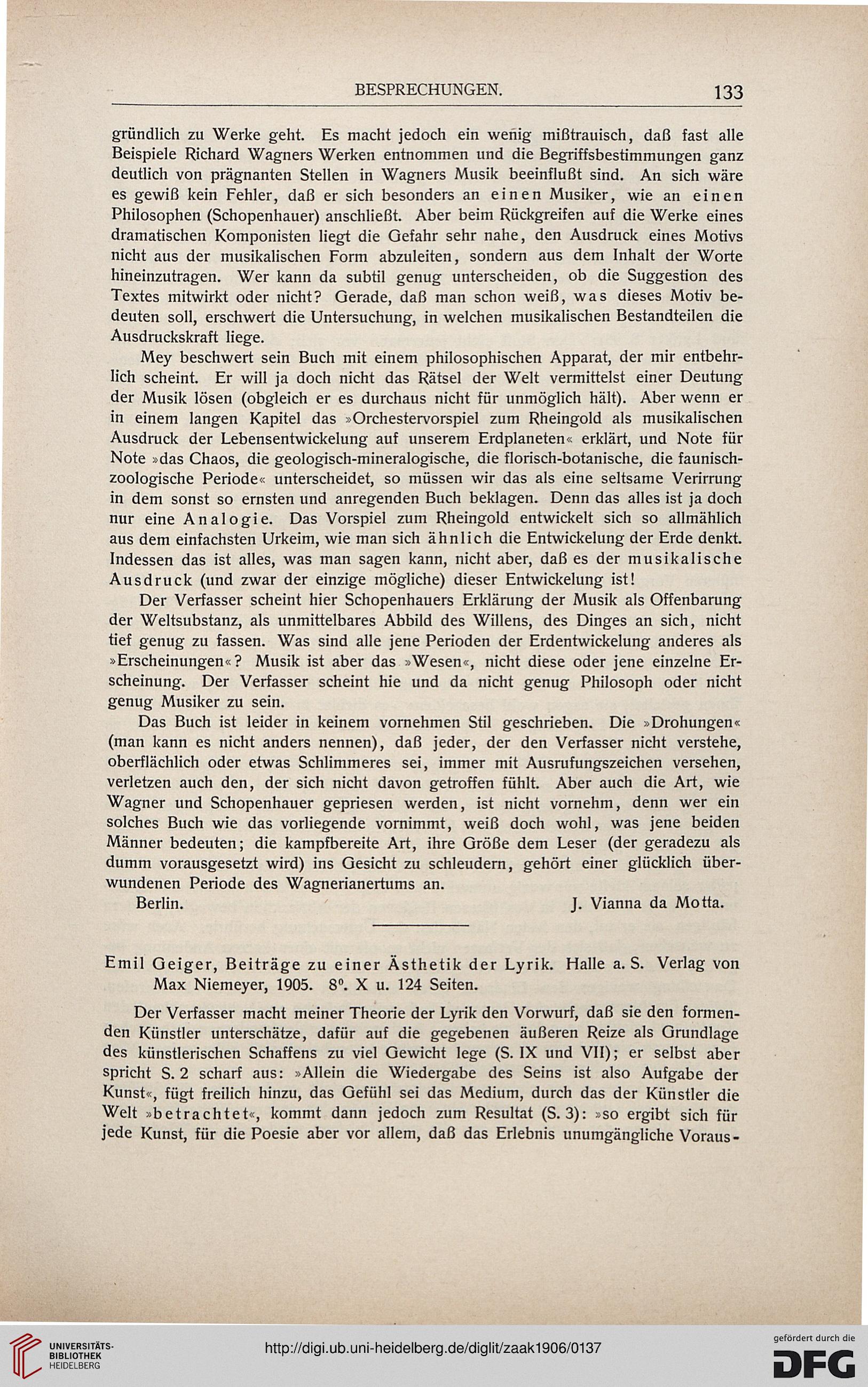BESPRECHUNGEN. 133
gründlich zu Werke geht. Es macht jedoch ein wehig mißtrauisch, daß fast alle
Beispiele Richard Wagners Werken entnommen und die Begriffsbestimmungen ganz
deutlich von prägnanten Stellen in Wagners Musik beeinflußt sind. An sich wäre
es gewiß kein Fehler, daß er sich besonders an einen Musiker, wie an einen
Philosophen (Schopenhauer) anschließt. Aber beim Rückgreifen auf die Werke eines
dramatischen Komponisten liegt die Gefahr sehr nahe, den Ausdruck eines Motivs
nicht aus der musikalischen Form abzuleiten, sondern aus dem Inhalt der Worte
hineinzutragen. Wer kann da subtil genug unterscheiden, ob die Suggestion des
Textes mitwirkt oder nicht? Gerade, daß man schon weiß, was dieses Motiv be-
deuten soll, erschwert die Untersuchung, in welchen musikalischen Bestandteilen die
Ausdruckskraft liege.
Mey beschwert sein Buch mit einem philosophischen Apparat, der mir entbehr-
lich scheint. Er will ja doch nicht das Rätsel der Welt vermittelst einer Deutung
der Musik lösen (obgleich er es durchaus nicht für unmöglich hält). Aber wenn er
in einem langen Kapitel das »Orchestervorspiel zum Rheingold als musikalischen
Ausdruck der Lebensentwickelung auf unserem Erdplaneten« erklärt, und Note für
Note »das Chaos, die geologisch-mineralogische, die florisch-botanische, die faunisch-
zoologische Periode« unterscheidet, so müssen wir das als eine seltsame Verirrung
in dem sonst so ernsten und anregenden Buch beklagen. Denn das alles ist ja doch
nur eine Analogie. Das Vorspiel zum Rheingold entwickelt sich so allmählich
aus dem einfachsten Urkeim, wie man sich ähnlich die Entwickelung der Erde denkt.
Indessen das ist alles, was man sagen kann, nicht aber, daß es der musikalische
Ausdruck (und zwar der einzige mögliche) dieser Entwickelung ist!
Der Verfasser scheint hier Schopenhauers Erklärung der Musik als Offenbarung
der Weltsubstanz, als unmittelbares Abbild des Willens, des Dinges an sich, nicht
tief genug zu fassen. Was sind alle jene Perioden der Erdentwickelung anderes als
»Erscheinungen«? Musik ist aber das »Wesen«, nicht diese oder jene einzelne Er-
scheinung. Der Verfasser scheint hie und da nicht genug Philosoph oder nicht
genug Musiker zu sein.
Das Buch ist leider in keinem vornehmen Stil geschrieben. Die »Drohungen«
(man kann es nicht anders nennen), daß jeder, der den Verfasser nicht verstehe,
oberflächlich oder etwas Schlimmeres sei, immer mit Ausrufungszeichen versehen,
verletzen auch den, der sich nicht davon getroffen fühlt. Aber auch die Art, wie
Wagner und Schopenhauer gepriesen werden, ist nicht vornehm, denn wer ein
solches Buch wie das vorliegende vornimmt, weiß doch wohl, was jene beiden
Männer bedeuten; die kampfbereite Art, ihre Größe dem Leser (der geradezu als
dumm vorausgesetzt wird) ins Gesicht zu schleudern, gehört einer glücklich über-
wundenen Periode des Wagnerianertums an.
Berlin. J. Vianna da Motta.
Emil Geiger, Beiträge zu einer Ästhetik der Lyrik. Halle a. S. Verlag von
Max Niemeyer, 1905. 8°. X u. 124 Seiten.
Der Verfasser macht meiner Theorie der Lyrik den Vorwurf, daß sie den formen-
den Künstler unterschätze, dafür auf die gegebenen äußeren Reize als Grundlage
des künstlerischen Schaffens zu viel Gewicht lege (S. IX und VII); er selbst aber
spricht S. 2 scharf aus: »Allein die Wiedergabe des Seins ist also Aufgabe der
Kunst«, fügt freilich hinzu, das Gefühl sei das Medium, durch das der Künstler die
Welt »betrachtet«, kommt dann jedoch zum Resultat (S. 3): »so ergibt sich für
jede Kunst, für die Poesie aber vor allem, daß das Erlebnis unumgängliche Voraus-
gründlich zu Werke geht. Es macht jedoch ein wehig mißtrauisch, daß fast alle
Beispiele Richard Wagners Werken entnommen und die Begriffsbestimmungen ganz
deutlich von prägnanten Stellen in Wagners Musik beeinflußt sind. An sich wäre
es gewiß kein Fehler, daß er sich besonders an einen Musiker, wie an einen
Philosophen (Schopenhauer) anschließt. Aber beim Rückgreifen auf die Werke eines
dramatischen Komponisten liegt die Gefahr sehr nahe, den Ausdruck eines Motivs
nicht aus der musikalischen Form abzuleiten, sondern aus dem Inhalt der Worte
hineinzutragen. Wer kann da subtil genug unterscheiden, ob die Suggestion des
Textes mitwirkt oder nicht? Gerade, daß man schon weiß, was dieses Motiv be-
deuten soll, erschwert die Untersuchung, in welchen musikalischen Bestandteilen die
Ausdruckskraft liege.
Mey beschwert sein Buch mit einem philosophischen Apparat, der mir entbehr-
lich scheint. Er will ja doch nicht das Rätsel der Welt vermittelst einer Deutung
der Musik lösen (obgleich er es durchaus nicht für unmöglich hält). Aber wenn er
in einem langen Kapitel das »Orchestervorspiel zum Rheingold als musikalischen
Ausdruck der Lebensentwickelung auf unserem Erdplaneten« erklärt, und Note für
Note »das Chaos, die geologisch-mineralogische, die florisch-botanische, die faunisch-
zoologische Periode« unterscheidet, so müssen wir das als eine seltsame Verirrung
in dem sonst so ernsten und anregenden Buch beklagen. Denn das alles ist ja doch
nur eine Analogie. Das Vorspiel zum Rheingold entwickelt sich so allmählich
aus dem einfachsten Urkeim, wie man sich ähnlich die Entwickelung der Erde denkt.
Indessen das ist alles, was man sagen kann, nicht aber, daß es der musikalische
Ausdruck (und zwar der einzige mögliche) dieser Entwickelung ist!
Der Verfasser scheint hier Schopenhauers Erklärung der Musik als Offenbarung
der Weltsubstanz, als unmittelbares Abbild des Willens, des Dinges an sich, nicht
tief genug zu fassen. Was sind alle jene Perioden der Erdentwickelung anderes als
»Erscheinungen«? Musik ist aber das »Wesen«, nicht diese oder jene einzelne Er-
scheinung. Der Verfasser scheint hie und da nicht genug Philosoph oder nicht
genug Musiker zu sein.
Das Buch ist leider in keinem vornehmen Stil geschrieben. Die »Drohungen«
(man kann es nicht anders nennen), daß jeder, der den Verfasser nicht verstehe,
oberflächlich oder etwas Schlimmeres sei, immer mit Ausrufungszeichen versehen,
verletzen auch den, der sich nicht davon getroffen fühlt. Aber auch die Art, wie
Wagner und Schopenhauer gepriesen werden, ist nicht vornehm, denn wer ein
solches Buch wie das vorliegende vornimmt, weiß doch wohl, was jene beiden
Männer bedeuten; die kampfbereite Art, ihre Größe dem Leser (der geradezu als
dumm vorausgesetzt wird) ins Gesicht zu schleudern, gehört einer glücklich über-
wundenen Periode des Wagnerianertums an.
Berlin. J. Vianna da Motta.
Emil Geiger, Beiträge zu einer Ästhetik der Lyrik. Halle a. S. Verlag von
Max Niemeyer, 1905. 8°. X u. 124 Seiten.
Der Verfasser macht meiner Theorie der Lyrik den Vorwurf, daß sie den formen-
den Künstler unterschätze, dafür auf die gegebenen äußeren Reize als Grundlage
des künstlerischen Schaffens zu viel Gewicht lege (S. IX und VII); er selbst aber
spricht S. 2 scharf aus: »Allein die Wiedergabe des Seins ist also Aufgabe der
Kunst«, fügt freilich hinzu, das Gefühl sei das Medium, durch das der Künstler die
Welt »betrachtet«, kommt dann jedoch zum Resultat (S. 3): »so ergibt sich für
jede Kunst, für die Poesie aber vor allem, daß das Erlebnis unumgängliche Voraus-