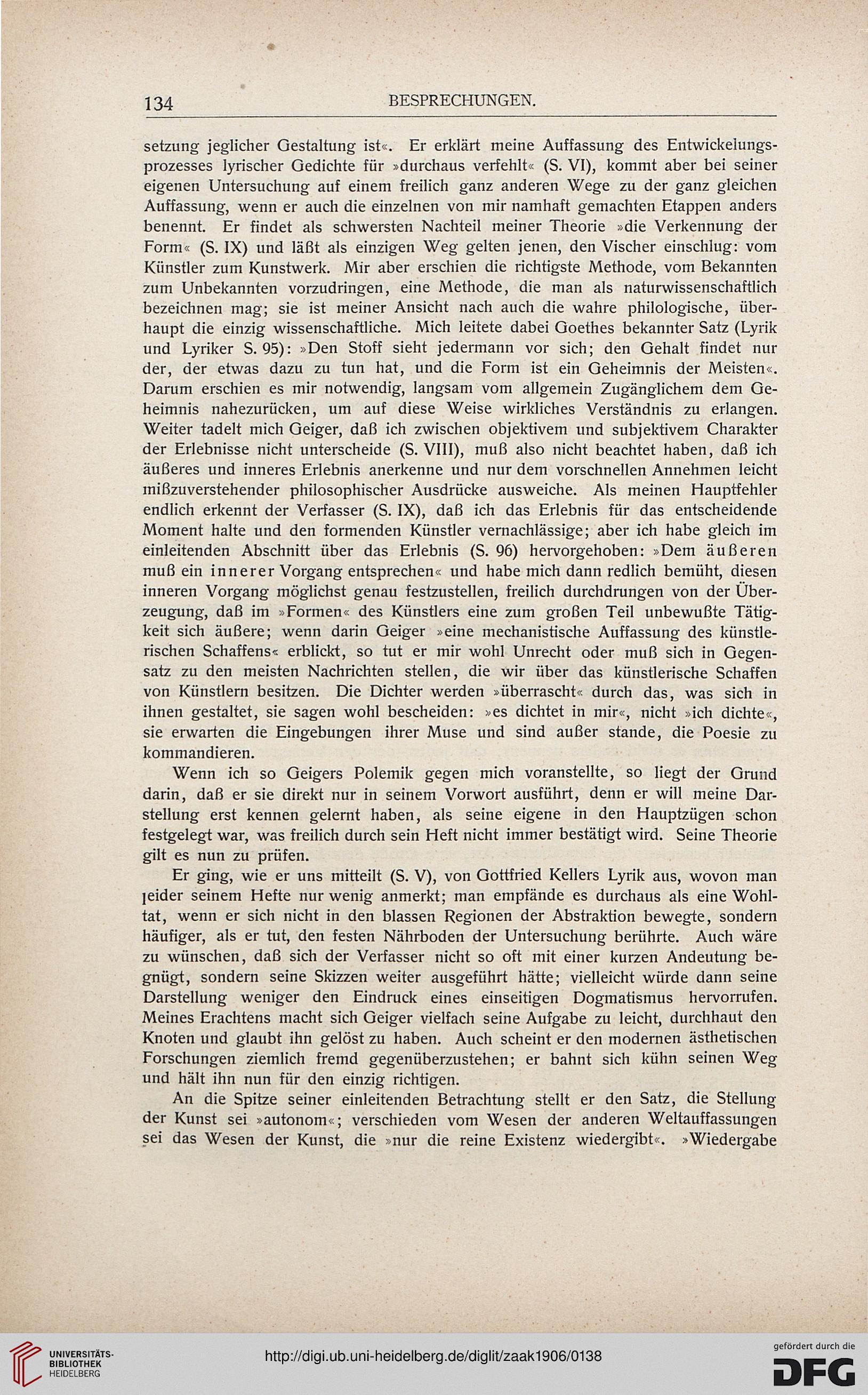134 BESPRECHUNGEN.
setzung jeglicher Gestaltung ist«. Er erklärt meine Auffassung des Entwickelungs-
prozesses lyrischer Gedichte für »durchaus verfehlt« (S. VI), kommt aber bei seiner
eigenen Untersuchung auf einem freilich ganz anderen Wege zu der ganz gleichen
Auffassung, wenn er auch die einzelnen von mir namhaft gemachten Etappen anders
benennt. Er findet als schwersten Nachteil meiner Theorie »die Verkennung der
Form« (S. IX) und läßt als einzigen Weg gelten jenen, den Vischer einschlug: vom
Künstler zum Kunstwerk. Mir aber erschien die richtigste Methode, vom Bekannten
zum Unbekannten vorzudringen, eine Methode, die man als naturwissenschaftlich
bezeichnen mag; sie ist meiner Ansicht nach auch die wahre philologische, über-
haupt die einzig wissenschaftliche. Mich leitete dabei Goethes bekannter Satz (Lyrik
und Lyriker S. 95): »Den Stoff sieht jedermann vor sich; den Gehalt findet nur
der, der etwas dazu zu tun hat, und die Form ist ein Geheimnis der Meisten«.
Darum erschien es mir notwendig, langsam vom allgemein Zugänglichem dem Ge-
heimnis nahezurücken, um auf diese Weise wirkliches Verständnis zu erlangen.
Weiter tadelt mich Geiger, daß ich zwischen objektivem und subjektivem Charakter
der Erlebnisse nicht unterscheide (S. VIII), muß also nicht beachtet haben, daß ich
äußeres und inneres Erlebnis anerkenne und nur dem vorschnellen Annehmen leicht
mißzuverstehender philosophischer Ausdrücke ausweiche. Als meinen Hauptfehler
endlich erkennt der Verfasser (S. IX), daß ich das Erlebnis für das entscheidende
Moment halte und den formenden Künstler vernachlässige; aber ich habe gleich im
einleitenden Abschnitt über das Erlebnis (S. 96) hervorgehoben: »Dem äußeren
muß ein innerer Vorgang entsprechen« und habe mich dann redlich bemüht, diesen
inneren Vorgang möglichst genau festzustellen, freilich durchdrungen von der Über-
zeugung, daß im »Formen« des Künstlers eine zum großen Teil unbewußte Tätig-
keit sich äußere; wenn darin Geiger »eine mechanistische Auffassung des künstle-
rischen Schaffens« erblickt, so tut er mir wohl Unrecht oder muß sich in Gegen-
satz zu den meisten Nachrichten stellen, die wir über das künstlerische Schaffen
von Künstlern besitzen. Die Dichter werden »überrascht« durch das, was sich in
ihnen gestaltet, sie sagen wohl bescheiden: »es dichtet in mir«, nicht »ich dichte«,
sie erwarten die Eingebungen ihrer Muse und sind außer stände, die Poesie zu
kommandieren.
Wenn ich so Geigers Polemik gegen mich voranstellte, so liegt der Grund
darin, daß er sie direkt nur in seinem Vorwort ausführt, denn er will meine Dar-
stellung erst kennen gelernt haben, als seine eigene in den Hauptzügen schon
festgelegt war, was freilich durch sein Heft nicht immer bestätigt wird. Seine Theorie
gilt es nun zu prüfen.
Er ging, wie er uns mitteilt (S. V), von Gottfried Kellers Lyrik aus, wovon man
leider seinem Hefte nur wenig anmerkt; man empfände es durchaus als eine Wohl-
tat, wenn er sich nicht in den blassen Regionen der Abstraktion bewegte, sondern
häufiger, als er tut, den festen Nährboden der Untersuchung berührte. Auch wäre
zu wünschen, daß sich der Verfasser nicht so oft mit einer kurzen Andeutung be-
gnügt, sondern seine Skizzen weiter ausgeführt hätte; vielleicht würde dann seine
Darstellung weniger den Eindruck eines einseitigen Dogmatismus hervorrufen.
Meines Erachtens macht sich Geiger vielfach seine Aufgabe zu leicht, durchhaut den
Knoten und glaubt ihn gelöst zu haben. Auch scheint er den modernen ästhetischen
Forschungen ziemlich fremd gegenüberzustehen; er bahnt sich kühn seinen Weg
und hält ihn nun für den einzig richtigen.
An die Spitze seiner einleitenden Betrachtung stellt er den Satz, die Stellung
der Kunst sei »autonom«; verschieden vom Wesen der anderen Weltauffassungen
sei das Wesen der Kunst, die »nur die reine Existenz wiedergibt«. »Wiedergabe
setzung jeglicher Gestaltung ist«. Er erklärt meine Auffassung des Entwickelungs-
prozesses lyrischer Gedichte für »durchaus verfehlt« (S. VI), kommt aber bei seiner
eigenen Untersuchung auf einem freilich ganz anderen Wege zu der ganz gleichen
Auffassung, wenn er auch die einzelnen von mir namhaft gemachten Etappen anders
benennt. Er findet als schwersten Nachteil meiner Theorie »die Verkennung der
Form« (S. IX) und läßt als einzigen Weg gelten jenen, den Vischer einschlug: vom
Künstler zum Kunstwerk. Mir aber erschien die richtigste Methode, vom Bekannten
zum Unbekannten vorzudringen, eine Methode, die man als naturwissenschaftlich
bezeichnen mag; sie ist meiner Ansicht nach auch die wahre philologische, über-
haupt die einzig wissenschaftliche. Mich leitete dabei Goethes bekannter Satz (Lyrik
und Lyriker S. 95): »Den Stoff sieht jedermann vor sich; den Gehalt findet nur
der, der etwas dazu zu tun hat, und die Form ist ein Geheimnis der Meisten«.
Darum erschien es mir notwendig, langsam vom allgemein Zugänglichem dem Ge-
heimnis nahezurücken, um auf diese Weise wirkliches Verständnis zu erlangen.
Weiter tadelt mich Geiger, daß ich zwischen objektivem und subjektivem Charakter
der Erlebnisse nicht unterscheide (S. VIII), muß also nicht beachtet haben, daß ich
äußeres und inneres Erlebnis anerkenne und nur dem vorschnellen Annehmen leicht
mißzuverstehender philosophischer Ausdrücke ausweiche. Als meinen Hauptfehler
endlich erkennt der Verfasser (S. IX), daß ich das Erlebnis für das entscheidende
Moment halte und den formenden Künstler vernachlässige; aber ich habe gleich im
einleitenden Abschnitt über das Erlebnis (S. 96) hervorgehoben: »Dem äußeren
muß ein innerer Vorgang entsprechen« und habe mich dann redlich bemüht, diesen
inneren Vorgang möglichst genau festzustellen, freilich durchdrungen von der Über-
zeugung, daß im »Formen« des Künstlers eine zum großen Teil unbewußte Tätig-
keit sich äußere; wenn darin Geiger »eine mechanistische Auffassung des künstle-
rischen Schaffens« erblickt, so tut er mir wohl Unrecht oder muß sich in Gegen-
satz zu den meisten Nachrichten stellen, die wir über das künstlerische Schaffen
von Künstlern besitzen. Die Dichter werden »überrascht« durch das, was sich in
ihnen gestaltet, sie sagen wohl bescheiden: »es dichtet in mir«, nicht »ich dichte«,
sie erwarten die Eingebungen ihrer Muse und sind außer stände, die Poesie zu
kommandieren.
Wenn ich so Geigers Polemik gegen mich voranstellte, so liegt der Grund
darin, daß er sie direkt nur in seinem Vorwort ausführt, denn er will meine Dar-
stellung erst kennen gelernt haben, als seine eigene in den Hauptzügen schon
festgelegt war, was freilich durch sein Heft nicht immer bestätigt wird. Seine Theorie
gilt es nun zu prüfen.
Er ging, wie er uns mitteilt (S. V), von Gottfried Kellers Lyrik aus, wovon man
leider seinem Hefte nur wenig anmerkt; man empfände es durchaus als eine Wohl-
tat, wenn er sich nicht in den blassen Regionen der Abstraktion bewegte, sondern
häufiger, als er tut, den festen Nährboden der Untersuchung berührte. Auch wäre
zu wünschen, daß sich der Verfasser nicht so oft mit einer kurzen Andeutung be-
gnügt, sondern seine Skizzen weiter ausgeführt hätte; vielleicht würde dann seine
Darstellung weniger den Eindruck eines einseitigen Dogmatismus hervorrufen.
Meines Erachtens macht sich Geiger vielfach seine Aufgabe zu leicht, durchhaut den
Knoten und glaubt ihn gelöst zu haben. Auch scheint er den modernen ästhetischen
Forschungen ziemlich fremd gegenüberzustehen; er bahnt sich kühn seinen Weg
und hält ihn nun für den einzig richtigen.
An die Spitze seiner einleitenden Betrachtung stellt er den Satz, die Stellung
der Kunst sei »autonom«; verschieden vom Wesen der anderen Weltauffassungen
sei das Wesen der Kunst, die »nur die reine Existenz wiedergibt«. »Wiedergabe