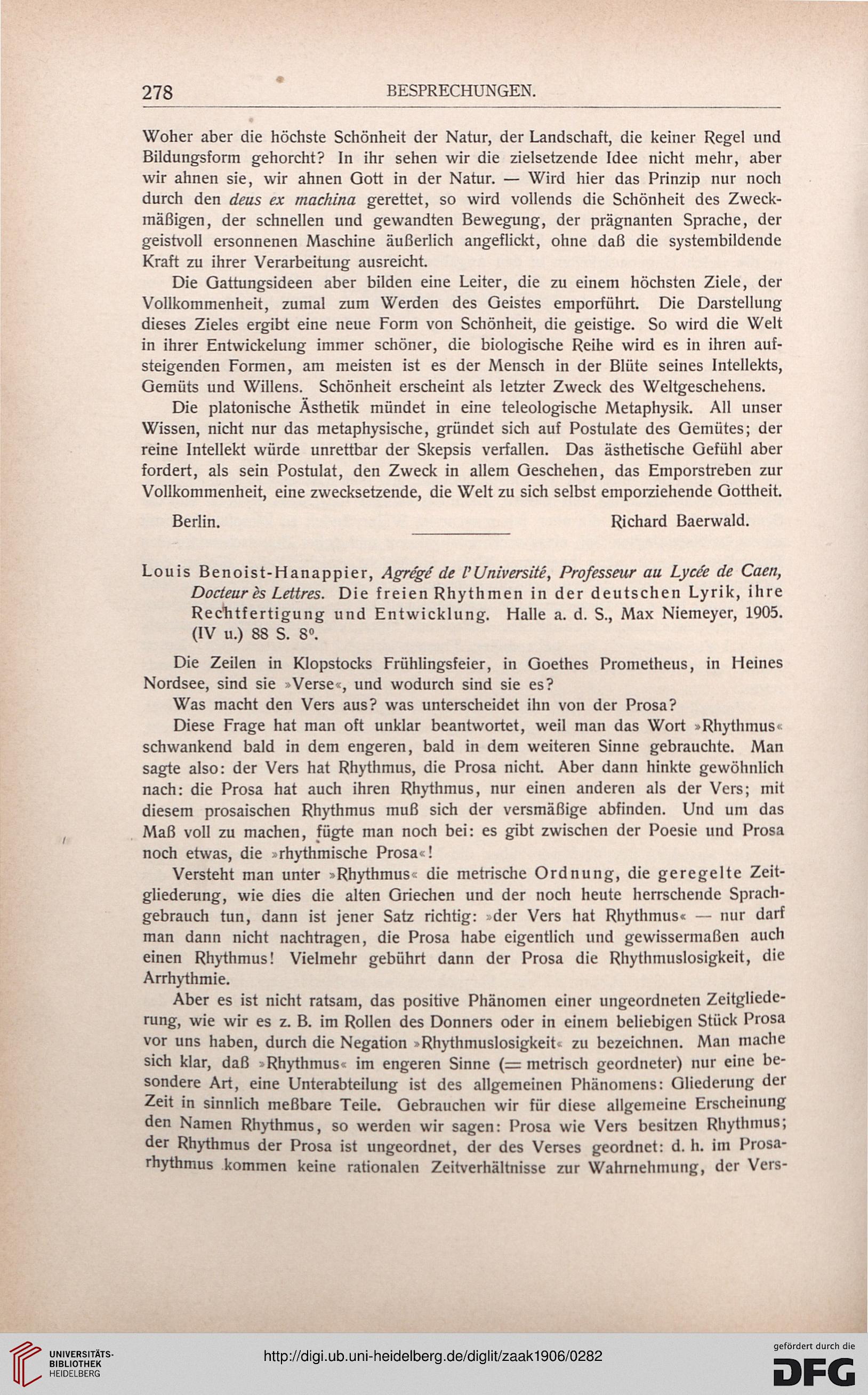278 BESPRECHUNGEN.
Woher aber die höchste Schönheit der Natur, der Landschaft, die keiner Regel und
Bildungsform gehorcht? In ihr sehen wir die zielsetzende Idee nicht mehr, aber
wir ahnen sie, wir ahnen Gott in der Natur. — Wird hier das Prinzip nur noch
durch den deus ex machina gerettet, so wird vollends die Schönheit des Zweck-
mäßigen, der schnellen und gewandten Bewegung, der prägnanten Sprache, der
geistvoll ersonnenen Maschine äußerlich angeflickt, ohne daß die systembildende
Kraft zu ihrer Verarbeitung ausreicht.
Die Gattungsideen aber bilden eine Leiter, die zu einem höchsten Ziele, der
Vollkommenheit, zumal zum Werden des Geistes emporführt. Die Darstellung
dieses Zieles ergibt eine neue Form von Schönheit, die geistige. So wird die Welt
in ihrer Entwickelung immer schöner, die biologische Reihe wird es in ihren auf-
steigenden Formen, am meisten ist es der Mensch in der Blüte seines Intellekts,
Gemüts und Willens. Schönheit erscheint als letzter Zweck des Weltgeschehens.
Die platonische Ästhetik mündet in eine teleologische Metaphysik. All unser
Wissen, nicht nur das metaphysische, gründet sich auf Postulate des Gemütes; der
reine Intellekt würde unrettbar der Skepsis verfallen. Das ästhetische Gefühl aber
fordert, als sein Postulat, den Zweck in allem Geschehen, das Emporstreben zur
Vollkommenheit, eine zwecksetzende, die Welt zu sich selbst emporziehende Gottheit.
Berlin. Richard Baerwald.
Louis Benoist-Hanappier, Agre'ge de l'Universite, Professeur au Lyce'e de Caen,
Docteur es Lettres. Die freien Rhythmen in der deutschen Lyrik, ihre
Rechtfertigung und Entwicklung. Halle a. d. S., Max Niemeyer, 1905.
(IV u.) 88 S. 8°.
Die Zeilen in Klopstocks Frühlingsfeier, in Goethes Prometheus, in Heines
Nordsee, sind sie »Verse«, und wodurch sind sie es?
Was macht den Vers aus? was unterscheidet ihn von der Prosa?
Diese Frage hat man oft unklar beantwortet, weil man das Wort »Rhythmus«
schwankend bald in dem engeren, bald in dem weiteren Sinne gebrauchte. Man
sagte also: der Vers hat Rhythmus, die Prosa nicht. Aber dann hinkte gewöhnlich
nach: die Prosa hat auch ihren Rhythmus, nur einen anderen als der Vers; mit
diesem prosaischen Rhythmus muß sich der versmäßige abfinden. Und um das
Maß voll zu machen, fügte man noch bei: es gibt zwischen der Poesie und Prosa
noch etwas, die »rhythmische Prosa«!
Versteht man unter »Rhythmus« die metrische Ordnung, die geregelte Zeit-
gliederung, wie dies die alten Griechen und der noch heute herrschende Sprach-
gebrauch tun, dann ist jener Satz richtig: -der Vers hat Rhythmus« — nur darf
man dann nicht nachtragen, die Prosa habe eigentlich und gewissermaßen auch
einen Rhythmus! Vielmehr gebührt dann der Prosa die Rhythmuslosigkeit, die
Arrhythmie.
Aber es ist nicht ratsam, das positive Phänomen einer ungeordneten Zeitgliede-
rung, wie wir es z. B. im Rollen des Donners oder in einem beliebigen Stück Prosa
vor uns haben, durch die Negation »Rhythmuslosigkeit« zu bezeichnen. Man mache
sich klar, daß Rhythmus« im engeren Sinne (= metrisch geordneter) nur eine be-
sondere Art, eine Unterabteilung ist des allgemeinen Phänomens: Gliederung der
Zeit in sinnlich meßbare Teile. Gebrauchen wir für diese allgemeine Erscheinung
den Namen Rhythmus, so werden wir sagen: Prosa wie Vers besitzen Rhythmus;
der Rhythmus der Prosa ist ungeordnet, der des Verses geordnet: d. h. im Prosa-
rhythmus kommen keine rationalen Zeitverhältnisse zur Wahrnehmung, der Vers-
Woher aber die höchste Schönheit der Natur, der Landschaft, die keiner Regel und
Bildungsform gehorcht? In ihr sehen wir die zielsetzende Idee nicht mehr, aber
wir ahnen sie, wir ahnen Gott in der Natur. — Wird hier das Prinzip nur noch
durch den deus ex machina gerettet, so wird vollends die Schönheit des Zweck-
mäßigen, der schnellen und gewandten Bewegung, der prägnanten Sprache, der
geistvoll ersonnenen Maschine äußerlich angeflickt, ohne daß die systembildende
Kraft zu ihrer Verarbeitung ausreicht.
Die Gattungsideen aber bilden eine Leiter, die zu einem höchsten Ziele, der
Vollkommenheit, zumal zum Werden des Geistes emporführt. Die Darstellung
dieses Zieles ergibt eine neue Form von Schönheit, die geistige. So wird die Welt
in ihrer Entwickelung immer schöner, die biologische Reihe wird es in ihren auf-
steigenden Formen, am meisten ist es der Mensch in der Blüte seines Intellekts,
Gemüts und Willens. Schönheit erscheint als letzter Zweck des Weltgeschehens.
Die platonische Ästhetik mündet in eine teleologische Metaphysik. All unser
Wissen, nicht nur das metaphysische, gründet sich auf Postulate des Gemütes; der
reine Intellekt würde unrettbar der Skepsis verfallen. Das ästhetische Gefühl aber
fordert, als sein Postulat, den Zweck in allem Geschehen, das Emporstreben zur
Vollkommenheit, eine zwecksetzende, die Welt zu sich selbst emporziehende Gottheit.
Berlin. Richard Baerwald.
Louis Benoist-Hanappier, Agre'ge de l'Universite, Professeur au Lyce'e de Caen,
Docteur es Lettres. Die freien Rhythmen in der deutschen Lyrik, ihre
Rechtfertigung und Entwicklung. Halle a. d. S., Max Niemeyer, 1905.
(IV u.) 88 S. 8°.
Die Zeilen in Klopstocks Frühlingsfeier, in Goethes Prometheus, in Heines
Nordsee, sind sie »Verse«, und wodurch sind sie es?
Was macht den Vers aus? was unterscheidet ihn von der Prosa?
Diese Frage hat man oft unklar beantwortet, weil man das Wort »Rhythmus«
schwankend bald in dem engeren, bald in dem weiteren Sinne gebrauchte. Man
sagte also: der Vers hat Rhythmus, die Prosa nicht. Aber dann hinkte gewöhnlich
nach: die Prosa hat auch ihren Rhythmus, nur einen anderen als der Vers; mit
diesem prosaischen Rhythmus muß sich der versmäßige abfinden. Und um das
Maß voll zu machen, fügte man noch bei: es gibt zwischen der Poesie und Prosa
noch etwas, die »rhythmische Prosa«!
Versteht man unter »Rhythmus« die metrische Ordnung, die geregelte Zeit-
gliederung, wie dies die alten Griechen und der noch heute herrschende Sprach-
gebrauch tun, dann ist jener Satz richtig: -der Vers hat Rhythmus« — nur darf
man dann nicht nachtragen, die Prosa habe eigentlich und gewissermaßen auch
einen Rhythmus! Vielmehr gebührt dann der Prosa die Rhythmuslosigkeit, die
Arrhythmie.
Aber es ist nicht ratsam, das positive Phänomen einer ungeordneten Zeitgliede-
rung, wie wir es z. B. im Rollen des Donners oder in einem beliebigen Stück Prosa
vor uns haben, durch die Negation »Rhythmuslosigkeit« zu bezeichnen. Man mache
sich klar, daß Rhythmus« im engeren Sinne (= metrisch geordneter) nur eine be-
sondere Art, eine Unterabteilung ist des allgemeinen Phänomens: Gliederung der
Zeit in sinnlich meßbare Teile. Gebrauchen wir für diese allgemeine Erscheinung
den Namen Rhythmus, so werden wir sagen: Prosa wie Vers besitzen Rhythmus;
der Rhythmus der Prosa ist ungeordnet, der des Verses geordnet: d. h. im Prosa-
rhythmus kommen keine rationalen Zeitverhältnisse zur Wahrnehmung, der Vers-