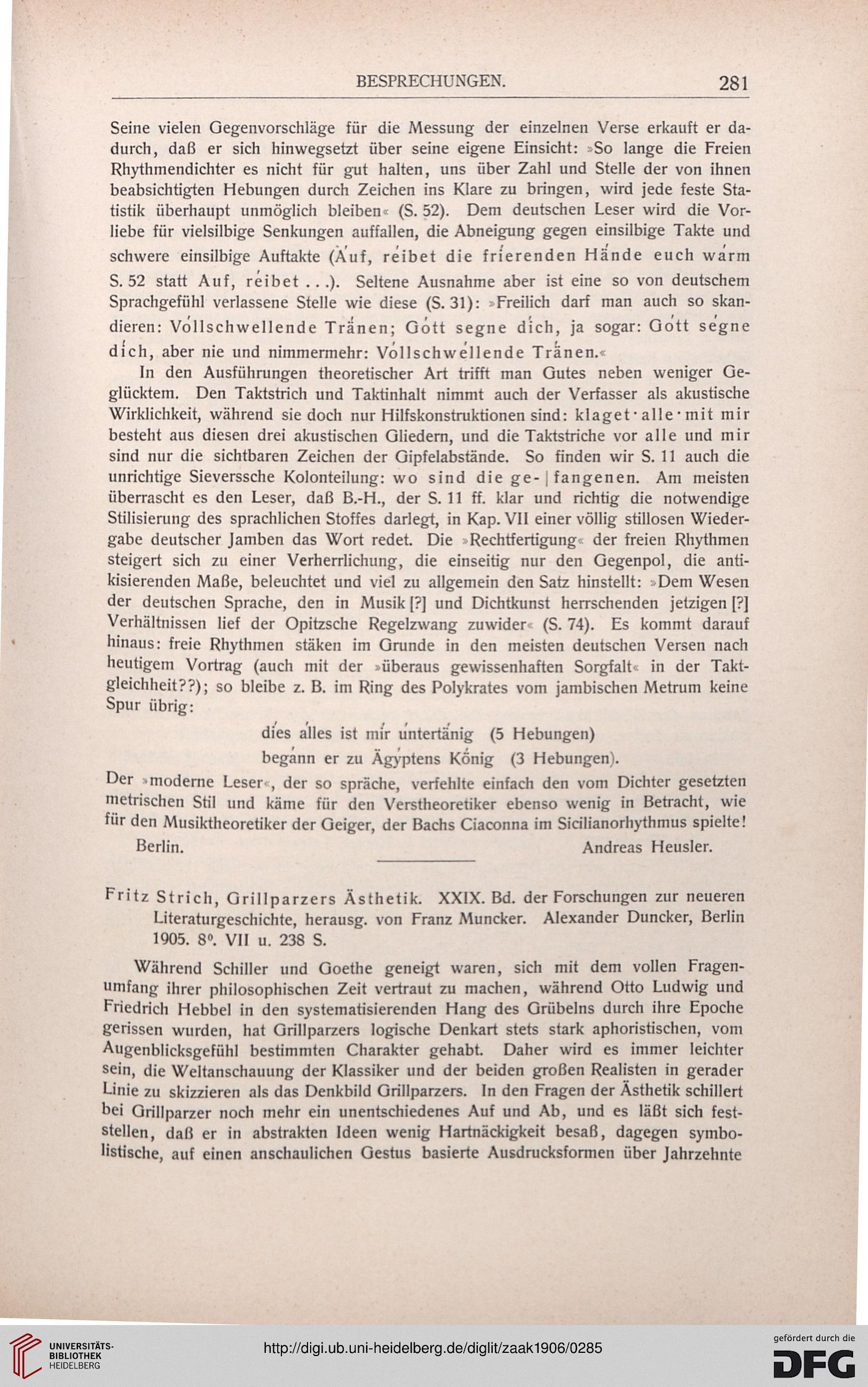BESPRECHUNGEN. 281
Seine vielen Gegenvorschläge für die Messung der einzelnen Verse erkauft er da-
durch, daß er sich hinwegsetzt über seine eigene Einsicht: So lange die Freien
Rhythmendichter es nicht für gut halten, uns über Zahl und Stelle der von ihnen
beabsichtigten Hebungen durch Zeichen ins Klare zu bringen, wird jede feste Sta-
tistik überhaupt unmöglich bleiben (S. 52). Dem deutschen Leser wird die Vor-
liebe für vielsilbige Senkungen auffallen, die Abneigung gegen einsilbige Takte und
schwere einsilbige Auftakte (Auf, reibet die frierenden Hände euch warm
S. 52 statt Auf, reibet . . .). Seltene Ausnahme aber ist eine so von deutschem
Sprachgefühl verlassene Stelle wie diese (S. 31): Freilich darf man auch so skan-
dieren: Vollschwellende Tranen; Gott segne dich, ja sogar: Gott segne
dich, aber nie und nimmermehr: Vollschwe'llende Tranen.<
In den Ausführungen theoretischer Art trifft man Gutes neben weniger Ge-
glücktem. Den Taktstrich und Taktinhalt nimmt auch der Verfasser als akustische
Wirklichkeit, während sie doch nur Hilfskonstruktionen sind: klaget • alle- mit mir
besteht aus diesen drei akustischen Gliedern, und die Taktstriche vor alle und mir
sind nur die sichtbaren Zeichen der Gipfelabstände. So finden wir S. 11 auch die
unrichtige Sieverssche Kolonteilung: wo sind die ge-1 fangenen. Am meisten
überrascht es den Leser, daß B.-H., der S. 11 ff. klar und richtig die notwendige
Stilisierung des sprachlichen Stoffes darlegt, in Kap. VII einer völlig stillosen Wieder-
gabe deutscher Jamben das Wort redet. Die Rechtfertigung der freien Rhythmen
steigert sich zu einer Verherrlichung, die einseitig nur den Gegenpol, die anti-
kisierenden Maße, beleuchtet und viel zu allgemein den Satz hinstellt: -Dem Wesen
der deutschen Sprache, den in Musik [?] und Dichtkunst herrschenden jetzigen [?]
Verhältnissen lief der Opitzsche Regelzwang zuwider- (S. 74). Es kommt darauf
hinaus: freie Rhythmen stäken im Grunde in den meisten deutschen Versen nach
heutigem Vortrag (auch mit der »überaus gewissenhaften Sorgfalt« in der Takt-
gleichheit??); so bleibe z. B. im Ring des Polykrates vom jambischen Metrum keine
Spur übrig:
dies alles ist mir untertanig (5 Hebungen)
begann er zu Ägyptens Konig (3 Hebungen).
Der moderne Leser , der so spräche, verfehlte einfach den vom Dichter gesetzten
metrischen Stil und käme für den Verstheoretiker ebenso wenig in Betracht, wie
für den Musiktheoretiker der Geiger, der Bachs Ciaconna im Sicilianorhythmus spielte!
Berlin. Andreas Heusler.
Fritz Strich, Grillparzers Ästhetik. XXIX. Bd. der Forschungen zur neueren
Literaturgeschichte, herausg. von Franz Muncker. Alexander Duncker, Berlin
1905. 8°. VII u. 238 S.
Während Schiller und Goethe geneigt waren, sich mit dem vollen Fragen-
umfang ihrer philosophischen Zeit vertraut zu machen, während Otto Ludwig und
Friedrich Hebbel in den systematisierenden Hang des Grübelns durch ihre Epoche
gerissen wurden, hat Grillparzers logische Denkart stets stark aphoristischen, vom
Augenblicksgefühl bestimmten Charakter gehabt. Daher wird es immer leichter
sein, die Weltanschauung der Klassiker und der beiden großen Realisten in gerader
Linie zu skizzieren als das Denkbild Grillparzers. In den Fragen der Ästhetik schillert
bei Grillparzer noch mehr ein unentschiedenes Auf und Ab, und es läßt sich fest-
stellen, daß er in abstrakten Ideen wenig Hartnäckigkeit besaß, dagegen symbo-
listische, auf einen anschaulichen Gestus basierte Ausdrucksformen über Jahrzehnte
Seine vielen Gegenvorschläge für die Messung der einzelnen Verse erkauft er da-
durch, daß er sich hinwegsetzt über seine eigene Einsicht: So lange die Freien
Rhythmendichter es nicht für gut halten, uns über Zahl und Stelle der von ihnen
beabsichtigten Hebungen durch Zeichen ins Klare zu bringen, wird jede feste Sta-
tistik überhaupt unmöglich bleiben (S. 52). Dem deutschen Leser wird die Vor-
liebe für vielsilbige Senkungen auffallen, die Abneigung gegen einsilbige Takte und
schwere einsilbige Auftakte (Auf, reibet die frierenden Hände euch warm
S. 52 statt Auf, reibet . . .). Seltene Ausnahme aber ist eine so von deutschem
Sprachgefühl verlassene Stelle wie diese (S. 31): Freilich darf man auch so skan-
dieren: Vollschwellende Tranen; Gott segne dich, ja sogar: Gott segne
dich, aber nie und nimmermehr: Vollschwe'llende Tranen.<
In den Ausführungen theoretischer Art trifft man Gutes neben weniger Ge-
glücktem. Den Taktstrich und Taktinhalt nimmt auch der Verfasser als akustische
Wirklichkeit, während sie doch nur Hilfskonstruktionen sind: klaget • alle- mit mir
besteht aus diesen drei akustischen Gliedern, und die Taktstriche vor alle und mir
sind nur die sichtbaren Zeichen der Gipfelabstände. So finden wir S. 11 auch die
unrichtige Sieverssche Kolonteilung: wo sind die ge-1 fangenen. Am meisten
überrascht es den Leser, daß B.-H., der S. 11 ff. klar und richtig die notwendige
Stilisierung des sprachlichen Stoffes darlegt, in Kap. VII einer völlig stillosen Wieder-
gabe deutscher Jamben das Wort redet. Die Rechtfertigung der freien Rhythmen
steigert sich zu einer Verherrlichung, die einseitig nur den Gegenpol, die anti-
kisierenden Maße, beleuchtet und viel zu allgemein den Satz hinstellt: -Dem Wesen
der deutschen Sprache, den in Musik [?] und Dichtkunst herrschenden jetzigen [?]
Verhältnissen lief der Opitzsche Regelzwang zuwider- (S. 74). Es kommt darauf
hinaus: freie Rhythmen stäken im Grunde in den meisten deutschen Versen nach
heutigem Vortrag (auch mit der »überaus gewissenhaften Sorgfalt« in der Takt-
gleichheit??); so bleibe z. B. im Ring des Polykrates vom jambischen Metrum keine
Spur übrig:
dies alles ist mir untertanig (5 Hebungen)
begann er zu Ägyptens Konig (3 Hebungen).
Der moderne Leser , der so spräche, verfehlte einfach den vom Dichter gesetzten
metrischen Stil und käme für den Verstheoretiker ebenso wenig in Betracht, wie
für den Musiktheoretiker der Geiger, der Bachs Ciaconna im Sicilianorhythmus spielte!
Berlin. Andreas Heusler.
Fritz Strich, Grillparzers Ästhetik. XXIX. Bd. der Forschungen zur neueren
Literaturgeschichte, herausg. von Franz Muncker. Alexander Duncker, Berlin
1905. 8°. VII u. 238 S.
Während Schiller und Goethe geneigt waren, sich mit dem vollen Fragen-
umfang ihrer philosophischen Zeit vertraut zu machen, während Otto Ludwig und
Friedrich Hebbel in den systematisierenden Hang des Grübelns durch ihre Epoche
gerissen wurden, hat Grillparzers logische Denkart stets stark aphoristischen, vom
Augenblicksgefühl bestimmten Charakter gehabt. Daher wird es immer leichter
sein, die Weltanschauung der Klassiker und der beiden großen Realisten in gerader
Linie zu skizzieren als das Denkbild Grillparzers. In den Fragen der Ästhetik schillert
bei Grillparzer noch mehr ein unentschiedenes Auf und Ab, und es läßt sich fest-
stellen, daß er in abstrakten Ideen wenig Hartnäckigkeit besaß, dagegen symbo-
listische, auf einen anschaulichen Gestus basierte Ausdrucksformen über Jahrzehnte