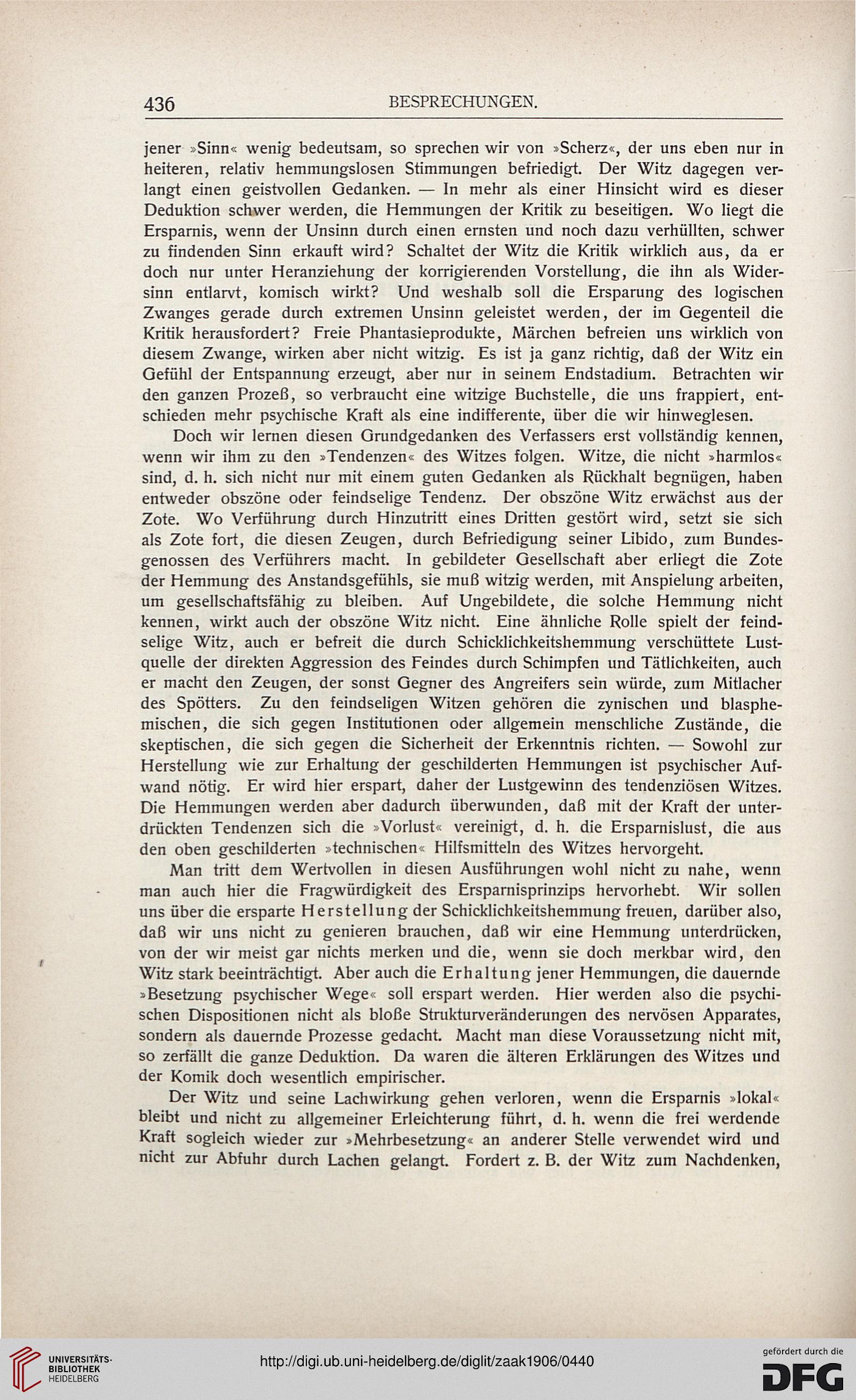436 BESPRECHUNGEN.
jener »Sinn« wenig bedeutsam, so sprechen wir von »Scherz«, der uns eben nur in
heiteren, relativ hemmungslosen Stimmungen befriedigt. Der Witz dagegen ver-
langt einen geistvollen Gedanken. — In mehr als einer Hinsicht wird es dieser
Deduktion schwer werden, die Hemmungen der Kritik zu beseitigen. Wo liegt die
Ersparnis, wenn der Unsinn durch einen ernsten und noch dazu verhüllten, schwer
zu findenden Sinn erkauft wird? Schaltet der Witz die Kritik wirklich aus, da er
doch nur unter Heranziehung der korrigierenden Vorstellung, die ihn als Wider-
sinn entlarvt, komisch wirkt? Und weshalb soll die Ersparung des logischen
Zwanges gerade durch extremen Unsinn geleistet werden, der im Gegenteil die
Kritik herausfordert? Freie Phantasieprodukte, Märchen befreien uns wirklich von
diesem Zwange, wirken aber nicht witzig. Es ist ja ganz richtig, daß der Witz ein
Gefühl der Entspannung erzeugt, aber nur in seinem Endstadium. Betrachten wir
den ganzen Prozeß, so verbraucht eine witzige Buchstelle, die uns frappiert, ent-
schieden mehr psychische Kraft als eine indifferente, über die wir hinweglesen.
Doch wir lernen diesen Grundgedanken des Verfassers erst vollständig kennen,
wenn wir ihm zu den »Tendenzen« des Witzes folgen. Witze, die nicht »harmlos«
sind, d. h. sich nicht nur mit einem guten Gedanken als Rückhalt begnügen, haben
entweder obszöne oder feindselige Tendenz. Der obszöne Witz erwächst aus der
Zote. Wo Verführung durch Hinzutritt eines Dritten gestört wird, setzt sie sich
als Zote fort, die diesen Zeugen, durch Befriedigung seiner Libido, zum Bundes-
genossen des Verführers macht. In gebildeter Gesellschaft aber erliegt die Zote
der Hemmung des Anstandsgefühls, sie muß witzig werden, mit Anspielung arbeiten,
um gesellschaftsfähig zu bleiben. Auf Ungebildete, die solche Hemmung nicht
kennen, wirkt auch der obszöne Witz nicht. Eine ähnliche Rolle spielt der feind-
selige Witz, auch er befreit die durch Schicklichkeitshemmung verschüttete Lust-
quelle der direkten Aggression des Feindes durch Schimpfen und Tätlichkeiten, auch
er macht den Zeugen, der sonst Gegner des Angreifers sein würde, zum Mitlacher
des Spötters. Zu den feindseligen Witzen gehören die zynischen und blasphe-
mischen, die sich gegen Institutionen oder allgemein menschliche Zustände, die
skeptischen, die sich gegen die Sicherheit der Erkenntnis richten. — Sowohl zur
Herstellung wie zur Erhaltung der geschilderten Hemmungen ist psychischer Auf-
wand nötig. Er wird hier erspart, daher der Lustgewinn des tendenziösen Witzes.
Die Hemmungen werden aber dadurch überwunden, daß mit der Kraft der unter-
drückten Tendenzen sich die »Vorlust« vereinigt, d. h. die Ersparnislust, die aus
den oben geschilderten »technischen« Hilfsmitteln des Witzes hervorgeht.
Man tritt dem Wertvollen in diesen Ausführungen wohl nicht zu nahe, wenn
man auch hier die Fragwürdigkeit des Ersparnisprinzips hervorhebt. Wir sollen
uns über die ersparte Herstellung der Schicklichkeitshemmung freuen, darüber also,
daß wir uns nicht zu genieren brauchen, daß wir eine Hemmung unterdrücken,
von der wir meist gar nichts merken und die, wenn sie doch merkbar wird, den
Witz stark beeinträchtigt. Aber auch die Erhaltung jener Hemmungen, die dauernde
»Besetzung psychischer Wege« soll erspart werden. Hier werden also die psychi-
schen Dispositionen nicht als bloße Strukturveränderungen des nervösen Apparates,
sondern als dauernde Prozesse gedacht. Macht man diese Voraussetzung nicht mit,
so zerfällt die ganze Deduktion. Da waren die älteren Erklärungen des Witzes und
der Komik doch wesentlich empirischer.
Der Witz und seine Lach Wirkung gehen verloren, wenn die Ersparnis »lokal«
bleibt und nicht zu allgemeiner Erleichterung führt, d. h. wenn die frei werdende
Kraft sogleich wieder zur »Mehrbesetzung« an anderer Stelle verwendet wird und
nicht zur Abfuhr durch Lachen gelangt. Fordert z. B. der Witz zum Nachdenken,
jener »Sinn« wenig bedeutsam, so sprechen wir von »Scherz«, der uns eben nur in
heiteren, relativ hemmungslosen Stimmungen befriedigt. Der Witz dagegen ver-
langt einen geistvollen Gedanken. — In mehr als einer Hinsicht wird es dieser
Deduktion schwer werden, die Hemmungen der Kritik zu beseitigen. Wo liegt die
Ersparnis, wenn der Unsinn durch einen ernsten und noch dazu verhüllten, schwer
zu findenden Sinn erkauft wird? Schaltet der Witz die Kritik wirklich aus, da er
doch nur unter Heranziehung der korrigierenden Vorstellung, die ihn als Wider-
sinn entlarvt, komisch wirkt? Und weshalb soll die Ersparung des logischen
Zwanges gerade durch extremen Unsinn geleistet werden, der im Gegenteil die
Kritik herausfordert? Freie Phantasieprodukte, Märchen befreien uns wirklich von
diesem Zwange, wirken aber nicht witzig. Es ist ja ganz richtig, daß der Witz ein
Gefühl der Entspannung erzeugt, aber nur in seinem Endstadium. Betrachten wir
den ganzen Prozeß, so verbraucht eine witzige Buchstelle, die uns frappiert, ent-
schieden mehr psychische Kraft als eine indifferente, über die wir hinweglesen.
Doch wir lernen diesen Grundgedanken des Verfassers erst vollständig kennen,
wenn wir ihm zu den »Tendenzen« des Witzes folgen. Witze, die nicht »harmlos«
sind, d. h. sich nicht nur mit einem guten Gedanken als Rückhalt begnügen, haben
entweder obszöne oder feindselige Tendenz. Der obszöne Witz erwächst aus der
Zote. Wo Verführung durch Hinzutritt eines Dritten gestört wird, setzt sie sich
als Zote fort, die diesen Zeugen, durch Befriedigung seiner Libido, zum Bundes-
genossen des Verführers macht. In gebildeter Gesellschaft aber erliegt die Zote
der Hemmung des Anstandsgefühls, sie muß witzig werden, mit Anspielung arbeiten,
um gesellschaftsfähig zu bleiben. Auf Ungebildete, die solche Hemmung nicht
kennen, wirkt auch der obszöne Witz nicht. Eine ähnliche Rolle spielt der feind-
selige Witz, auch er befreit die durch Schicklichkeitshemmung verschüttete Lust-
quelle der direkten Aggression des Feindes durch Schimpfen und Tätlichkeiten, auch
er macht den Zeugen, der sonst Gegner des Angreifers sein würde, zum Mitlacher
des Spötters. Zu den feindseligen Witzen gehören die zynischen und blasphe-
mischen, die sich gegen Institutionen oder allgemein menschliche Zustände, die
skeptischen, die sich gegen die Sicherheit der Erkenntnis richten. — Sowohl zur
Herstellung wie zur Erhaltung der geschilderten Hemmungen ist psychischer Auf-
wand nötig. Er wird hier erspart, daher der Lustgewinn des tendenziösen Witzes.
Die Hemmungen werden aber dadurch überwunden, daß mit der Kraft der unter-
drückten Tendenzen sich die »Vorlust« vereinigt, d. h. die Ersparnislust, die aus
den oben geschilderten »technischen« Hilfsmitteln des Witzes hervorgeht.
Man tritt dem Wertvollen in diesen Ausführungen wohl nicht zu nahe, wenn
man auch hier die Fragwürdigkeit des Ersparnisprinzips hervorhebt. Wir sollen
uns über die ersparte Herstellung der Schicklichkeitshemmung freuen, darüber also,
daß wir uns nicht zu genieren brauchen, daß wir eine Hemmung unterdrücken,
von der wir meist gar nichts merken und die, wenn sie doch merkbar wird, den
Witz stark beeinträchtigt. Aber auch die Erhaltung jener Hemmungen, die dauernde
»Besetzung psychischer Wege« soll erspart werden. Hier werden also die psychi-
schen Dispositionen nicht als bloße Strukturveränderungen des nervösen Apparates,
sondern als dauernde Prozesse gedacht. Macht man diese Voraussetzung nicht mit,
so zerfällt die ganze Deduktion. Da waren die älteren Erklärungen des Witzes und
der Komik doch wesentlich empirischer.
Der Witz und seine Lach Wirkung gehen verloren, wenn die Ersparnis »lokal«
bleibt und nicht zu allgemeiner Erleichterung führt, d. h. wenn die frei werdende
Kraft sogleich wieder zur »Mehrbesetzung« an anderer Stelle verwendet wird und
nicht zur Abfuhr durch Lachen gelangt. Fordert z. B. der Witz zum Nachdenken,