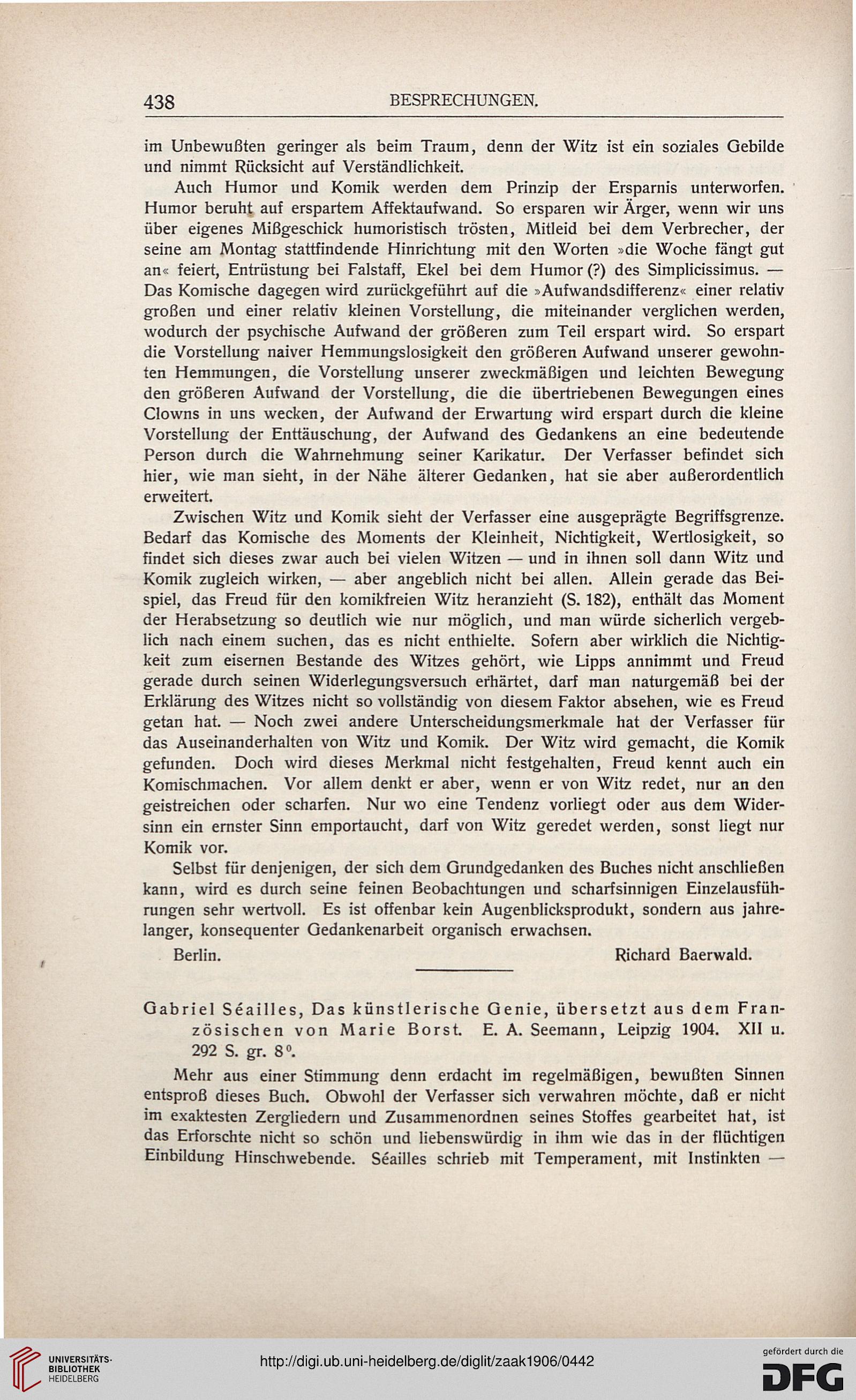438 BESPRECHUNGEN.
im Unbewußten geringer als beim Traum, denn der Witz ist ein soziales Gebilde
und nimmt Rücksicht auf Verständlichkeit.
Auch Humor und Komik werden dem Prinzip der Ersparnis unterworfen.
Humor beruht auf erspartem Affektaufwand. So ersparen wir Ärger, wenn wir uns
über eigenes Mißgeschick humoristisch trösten, Mitleid bei dem Verbrecher, der
seine am Montag stattfindende Hinrichtung mit den Worten »die Woche fängt gut
an« feiert, Entrüstung bei Falstaff, Ekel bei dem Humor (?) des Simplicissimus. —
Das Komische dagegen wird zurückgeführt auf die »Aufwandsdifferenz« einer relativ
großen und einer relativ kleinen Vorstellung, die miteinander verglichen werden,
wodurch der psychische Aufwand der größeren zum Teil erspart wird. So erspart
die Vorstellung naiver Hemmungslosigkeit den größeren Aufwand unserer gewohn-
ten Hemmungen, die Vorstellung unserer zweckmäßigen und leichten Bewegung
den größeren Aufwand der Vorstellung, die die übertriebenen Bewegungen eines
Clowns in uns wecken, der Aufwand der Erwartung wird erspart durch die kleine
Vorstellung der Enttäuschung, der Aufwand des Gedankens an eine bedeutende
Person durch die Wahrnehmung seiner Karikatur. Der Verfasser befindet sich
hier, wie man sieht, in der Nähe älterer Gedanken, hat sie aber außerordentlich
erweitert.
Zwischen Witz und Komik sieht der Verfasser eine ausgeprägte Begriffsgrenze.
Bedarf das Komische des Moments der Kleinheit, Nichtigkeit, Wertlosigkeit, so
findet sich dieses zwar auch bei vielen Witzen — und in ihnen soll dann Witz und
Komik zugleich wirken, — aber angeblich nicht bei allen. Allein gerade das Bei-
spiel, das Freud für den komikfreien Witz heranzieht (S. 182), enthält das Moment
der Herabsetzung so deutlich wie nur möglich, und man würde sicherlich vergeb-
lich nach einem suchen, das es nicht enthielte. Sofern aber wirklich die Nichtig-
keit zum eisernen Bestände des Witzes gehört, wie Lipps annimmt und Freud
gerade durch seinen Widerlegungsversuch erhärtet, darf man naturgemäß bei der
Erklärung des Witzes nicht so vollständig von diesem Faktor absehen, wie es Freud
getan hat. — Noch zwei andere Unterscheidungsmerkmale hat der Verfasser für
das Auseinanderhalten von Witz und Komik. Der Witz wird gemacht, die Komik
gefunden. Doch wird dieses Merkmal nicht festgehalten, Freud kennt auch ein
Komischmachen. Vor allem denkt er aber, wenn er von Witz redet, nur an den
geistreichen oder scharfen. Nur wo eine Tendenz vorliegt oder aus dem Wider-
sinn ein ernster Sinn emportaucht, darf von Witz geredet werden, sonst liegt nur
Komik vor.
Selbst für denjenigen, der sich dem Grundgedanken des Buches nicht anschließen
kann, wird es durch seine feinen Beobachtungen und scharfsinnigen Einzelausfüh-
rungen sehr wertvoll. Es ist offenbar kein Augenblicksprodukt, sondern aus jahre-
langer, konsequenter Gedankenarbeit organisch erwachsen.
Berlin. Richard Baerwald.
Gabriel Seailles, Das künstlerische Genie, übersetzt aus dem Fran-
zösischen von Marie Borst. E. A. Seemann, Leipzig 1904. XII u.
292 S. gr. 8°.
Mehr aus einer Stimmung denn erdacht im regelmäßigen, bewußten Sinnen
entsproß dieses Buch. Obwohl der Verfasser sich verwahren möchte, daß er nicht
im exaktesten Zergliedern und Zusammenordnen seines Stoffes gearbeitet hat, ist
das Erforschte nicht so schön und liebenswürdig in ihm wie das in der flüchtigen
Einbildung Hinschwebende. Seailles schrieb mit Temperament, mit Instinkten —
im Unbewußten geringer als beim Traum, denn der Witz ist ein soziales Gebilde
und nimmt Rücksicht auf Verständlichkeit.
Auch Humor und Komik werden dem Prinzip der Ersparnis unterworfen.
Humor beruht auf erspartem Affektaufwand. So ersparen wir Ärger, wenn wir uns
über eigenes Mißgeschick humoristisch trösten, Mitleid bei dem Verbrecher, der
seine am Montag stattfindende Hinrichtung mit den Worten »die Woche fängt gut
an« feiert, Entrüstung bei Falstaff, Ekel bei dem Humor (?) des Simplicissimus. —
Das Komische dagegen wird zurückgeführt auf die »Aufwandsdifferenz« einer relativ
großen und einer relativ kleinen Vorstellung, die miteinander verglichen werden,
wodurch der psychische Aufwand der größeren zum Teil erspart wird. So erspart
die Vorstellung naiver Hemmungslosigkeit den größeren Aufwand unserer gewohn-
ten Hemmungen, die Vorstellung unserer zweckmäßigen und leichten Bewegung
den größeren Aufwand der Vorstellung, die die übertriebenen Bewegungen eines
Clowns in uns wecken, der Aufwand der Erwartung wird erspart durch die kleine
Vorstellung der Enttäuschung, der Aufwand des Gedankens an eine bedeutende
Person durch die Wahrnehmung seiner Karikatur. Der Verfasser befindet sich
hier, wie man sieht, in der Nähe älterer Gedanken, hat sie aber außerordentlich
erweitert.
Zwischen Witz und Komik sieht der Verfasser eine ausgeprägte Begriffsgrenze.
Bedarf das Komische des Moments der Kleinheit, Nichtigkeit, Wertlosigkeit, so
findet sich dieses zwar auch bei vielen Witzen — und in ihnen soll dann Witz und
Komik zugleich wirken, — aber angeblich nicht bei allen. Allein gerade das Bei-
spiel, das Freud für den komikfreien Witz heranzieht (S. 182), enthält das Moment
der Herabsetzung so deutlich wie nur möglich, und man würde sicherlich vergeb-
lich nach einem suchen, das es nicht enthielte. Sofern aber wirklich die Nichtig-
keit zum eisernen Bestände des Witzes gehört, wie Lipps annimmt und Freud
gerade durch seinen Widerlegungsversuch erhärtet, darf man naturgemäß bei der
Erklärung des Witzes nicht so vollständig von diesem Faktor absehen, wie es Freud
getan hat. — Noch zwei andere Unterscheidungsmerkmale hat der Verfasser für
das Auseinanderhalten von Witz und Komik. Der Witz wird gemacht, die Komik
gefunden. Doch wird dieses Merkmal nicht festgehalten, Freud kennt auch ein
Komischmachen. Vor allem denkt er aber, wenn er von Witz redet, nur an den
geistreichen oder scharfen. Nur wo eine Tendenz vorliegt oder aus dem Wider-
sinn ein ernster Sinn emportaucht, darf von Witz geredet werden, sonst liegt nur
Komik vor.
Selbst für denjenigen, der sich dem Grundgedanken des Buches nicht anschließen
kann, wird es durch seine feinen Beobachtungen und scharfsinnigen Einzelausfüh-
rungen sehr wertvoll. Es ist offenbar kein Augenblicksprodukt, sondern aus jahre-
langer, konsequenter Gedankenarbeit organisch erwachsen.
Berlin. Richard Baerwald.
Gabriel Seailles, Das künstlerische Genie, übersetzt aus dem Fran-
zösischen von Marie Borst. E. A. Seemann, Leipzig 1904. XII u.
292 S. gr. 8°.
Mehr aus einer Stimmung denn erdacht im regelmäßigen, bewußten Sinnen
entsproß dieses Buch. Obwohl der Verfasser sich verwahren möchte, daß er nicht
im exaktesten Zergliedern und Zusammenordnen seines Stoffes gearbeitet hat, ist
das Erforschte nicht so schön und liebenswürdig in ihm wie das in der flüchtigen
Einbildung Hinschwebende. Seailles schrieb mit Temperament, mit Instinkten —