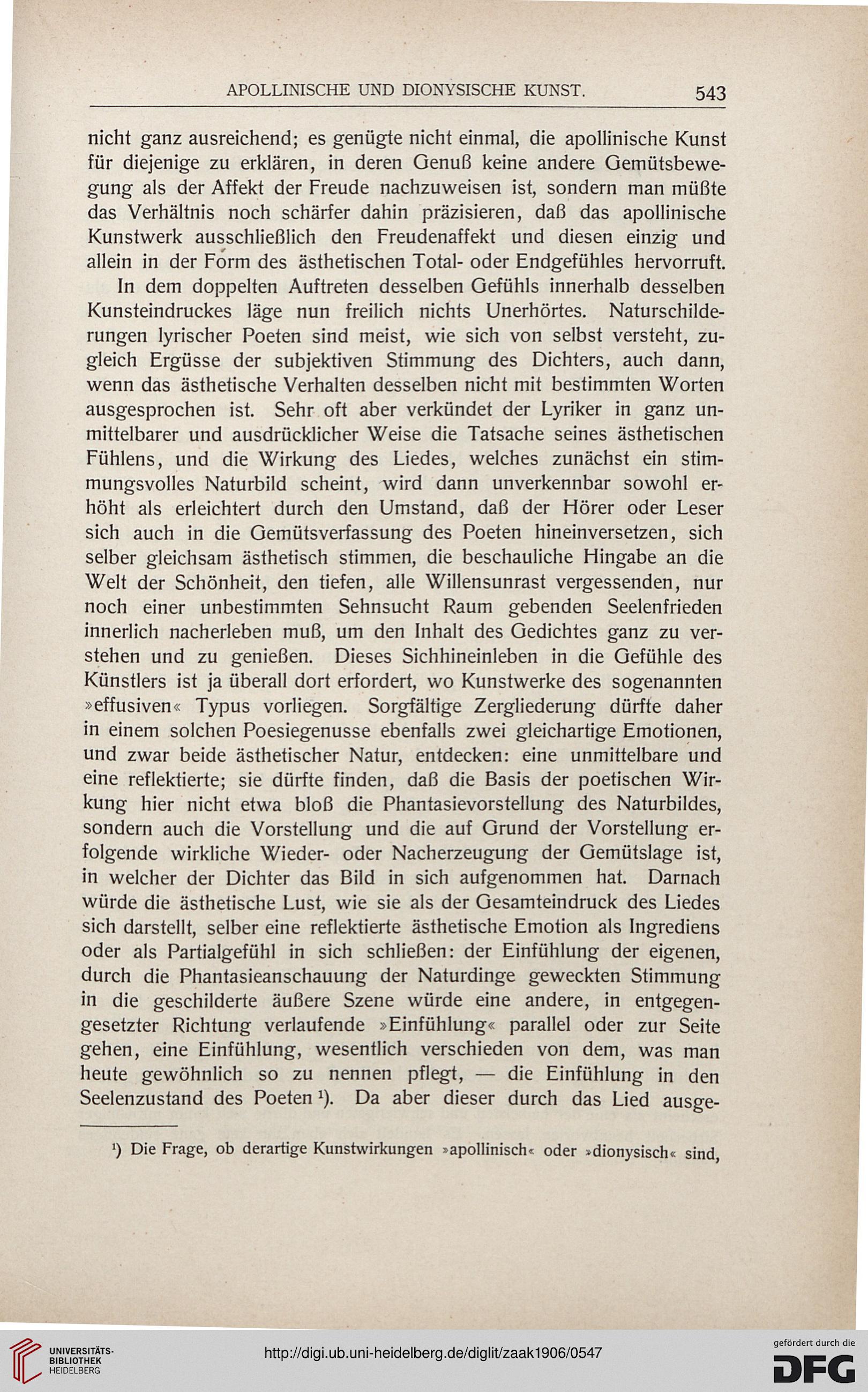APOLLINISCHE UND DIONYSISCHE KUNST. 543
nicht ganz ausreichend; es genügte nicht einmal, die apollinische Kunst
für diejenige zu erklären, in deren Genuß keine andere Gemütsbewe-
gung als der Affekt der Freude nachzuweisen ist, sondern man müßte
das Verhältnis noch schärfer dahin präzisieren, daß das apollinische
Kunstwerk ausschließlich den Freudenaffekt und diesen einzig und
allein in der Form des ästhetischen Total- oder Endgefühles hervorruft.
In dem doppelten Auftreten desselben Gefühls innerhalb desselben
Kunsteindruckes läge nun freilich nichts Unerhörtes. Naturschilde-
rungen lyrischer Poeten sind meist, wie sich von selbst versteht, zu-
gleich Ergüsse der subjektiven Stimmung des Dichters, auch dann,
wenn das ästhetische Verhalten desselben nicht mit bestimmten Worten
ausgesprochen ist. Sehr oft aber verkündet der Lyriker in ganz un-
mittelbarer und ausdrücklicher Weise die Tatsache seines ästhetischen
Fühlens, und die Wirkung des Liedes, welches zunächst ein stim-
mungsvolles Naturbild scheint, wird dann unverkennbar sowohl er-
höht als erleichtert durch den Umstand, daß der Hörer oder Leser
sich auch in die Gemütsverfassung des Poeten hineinversetzen, sich
selber gleichsam ästhetisch stimmen, die beschauliche Hingabe an die
Welt der Schönheit, den tiefen, alle Willensunrast vergessenden, nur
noch einer unbestimmten Sehnsucht Raum gebenden Seelenfrieden
innerlich nacherleben muß, um den Inhalt des Gedichtes ganz zu ver-
stehen und zu genießen. Dieses Sichhineinleben in die Gefühle des
Künstlers ist ja überall dort erfordert, wo Kunstwerke des sogenannten
»effusiven« Typus vorliegen. Sorgfältige Zergliederung dürfte daher
in einem solchen Poesiegenusse ebenfalls zwei gleichartige Emotionen,
und zwar beide ästhetischer Natur, entdecken: eine unmittelbare und
eine reflektierte; sie dürfte finden, daß die Basis der poetischen Wir-
kung hier nicht etwa bloß die Phantasievorstellung des Naturbildes,
sondern auch die Vorstellung und die auf Grund der Vorstellung er-
folgende wirkliche Wieder- oder Nacherzeugung der Gemütslage ist,
in welcher der Dichter das Bild in sich aufgenommen hat. Darnach
würde die ästhetische Lust, wie sie als der Gesamteindruck des Liedes
sich darstellt, selber eine reflektierte ästhetische Emotion als Ingrediens
oder als Partialgefühl in sich schließen: der Einfühlung der eigenen,
durch die Phantasieanschauung der Naturdinge geweckten Stimmung
in die geschilderte äußere Szene würde eine andere, in entgegen-
gesetzter Richtung verlaufende »Einfühlung« parallel oder zur Seite
gehen, eine Einfühlung, wesentlich verschieden von dem, was man
heute gewöhnlich so zu nennen pflegt, — die Einfühlung in den
Seelenzustand des Poetenx). Da aber dieser durch das Lied ausge-
») Die Frage, ob derartige Kunstwirkungen »apollinische oder »dionysisch« sind
nicht ganz ausreichend; es genügte nicht einmal, die apollinische Kunst
für diejenige zu erklären, in deren Genuß keine andere Gemütsbewe-
gung als der Affekt der Freude nachzuweisen ist, sondern man müßte
das Verhältnis noch schärfer dahin präzisieren, daß das apollinische
Kunstwerk ausschließlich den Freudenaffekt und diesen einzig und
allein in der Form des ästhetischen Total- oder Endgefühles hervorruft.
In dem doppelten Auftreten desselben Gefühls innerhalb desselben
Kunsteindruckes läge nun freilich nichts Unerhörtes. Naturschilde-
rungen lyrischer Poeten sind meist, wie sich von selbst versteht, zu-
gleich Ergüsse der subjektiven Stimmung des Dichters, auch dann,
wenn das ästhetische Verhalten desselben nicht mit bestimmten Worten
ausgesprochen ist. Sehr oft aber verkündet der Lyriker in ganz un-
mittelbarer und ausdrücklicher Weise die Tatsache seines ästhetischen
Fühlens, und die Wirkung des Liedes, welches zunächst ein stim-
mungsvolles Naturbild scheint, wird dann unverkennbar sowohl er-
höht als erleichtert durch den Umstand, daß der Hörer oder Leser
sich auch in die Gemütsverfassung des Poeten hineinversetzen, sich
selber gleichsam ästhetisch stimmen, die beschauliche Hingabe an die
Welt der Schönheit, den tiefen, alle Willensunrast vergessenden, nur
noch einer unbestimmten Sehnsucht Raum gebenden Seelenfrieden
innerlich nacherleben muß, um den Inhalt des Gedichtes ganz zu ver-
stehen und zu genießen. Dieses Sichhineinleben in die Gefühle des
Künstlers ist ja überall dort erfordert, wo Kunstwerke des sogenannten
»effusiven« Typus vorliegen. Sorgfältige Zergliederung dürfte daher
in einem solchen Poesiegenusse ebenfalls zwei gleichartige Emotionen,
und zwar beide ästhetischer Natur, entdecken: eine unmittelbare und
eine reflektierte; sie dürfte finden, daß die Basis der poetischen Wir-
kung hier nicht etwa bloß die Phantasievorstellung des Naturbildes,
sondern auch die Vorstellung und die auf Grund der Vorstellung er-
folgende wirkliche Wieder- oder Nacherzeugung der Gemütslage ist,
in welcher der Dichter das Bild in sich aufgenommen hat. Darnach
würde die ästhetische Lust, wie sie als der Gesamteindruck des Liedes
sich darstellt, selber eine reflektierte ästhetische Emotion als Ingrediens
oder als Partialgefühl in sich schließen: der Einfühlung der eigenen,
durch die Phantasieanschauung der Naturdinge geweckten Stimmung
in die geschilderte äußere Szene würde eine andere, in entgegen-
gesetzter Richtung verlaufende »Einfühlung« parallel oder zur Seite
gehen, eine Einfühlung, wesentlich verschieden von dem, was man
heute gewöhnlich so zu nennen pflegt, — die Einfühlung in den
Seelenzustand des Poetenx). Da aber dieser durch das Lied ausge-
») Die Frage, ob derartige Kunstwirkungen »apollinische oder »dionysisch« sind