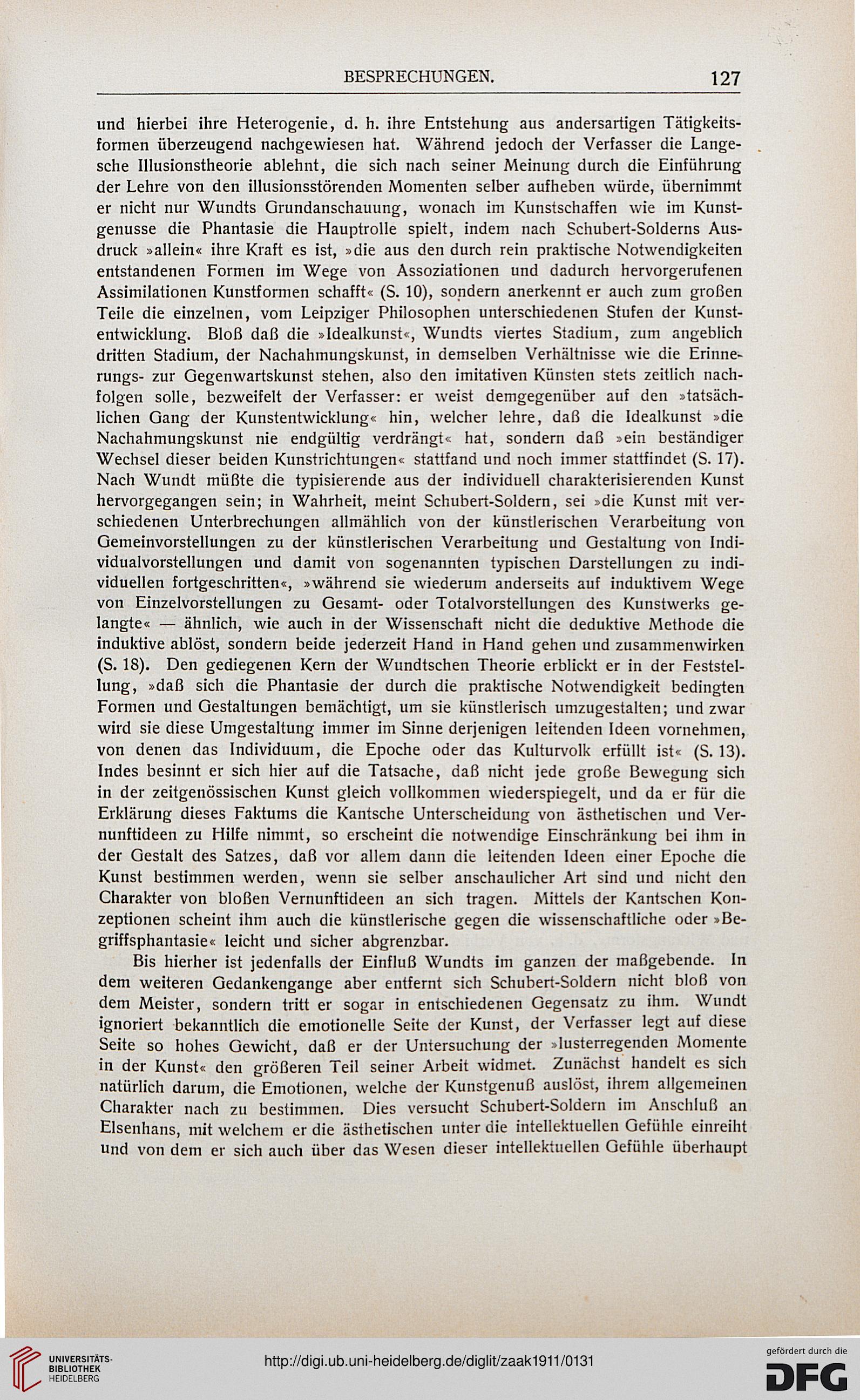BESPRECHUNGEN. 127
und hierbei ihre Heterogenie, d. h. ihre Entstehung aus andersartigen Tätigkeits-
formen überzeugend nachgewiesen hat. Während jedoch der Verfasser die Lange-
sche Illusionstheorie ablehnt, die sich nach seiner Meinung durch die Einführung
der Lehre von den illusionsstörenden Momenten selber aufheben würde, übernimmt
er nicht nur Wundts Grundanschauung, wonach im Kunstschaffen wie im Kunst-
genüsse die Phantasie die Hauptrolle spielt, indem nach Schubert-Solderns Aus-
druck »allein« ihre Kraft es ist, »die aus den durch rein praktische Notwendigkeiten
entstandenen Formen im Wege von Assoziationen und dadurch hervorgerufenen
Assimilationen Kunstformen schafft« (S. 10), sondern anerkennt er auch zum großen
Teile die einzelnen, vom Leipziger Philosophen unterschiedenen Stufen der Kunst-
entwicklung. Bloß daß die »Idealkunst«, Wundts viertes Stadium, zum angeblich
dritten Stadium, der Nachahmungskunst, in demselben Verhältnisse wie die Erinne-
rungs- zur Gegenwartskunst stehen, also den imitativen Künsten stets zeitlich nach-
folgen solle, bezweifelt der Verfasser: er weist demgegenüber auf den »tatsäch-
lichen Gang der Kunstentwicklung« hin, welcher lehre, daß die Idealkunst »die
Nachahmungskunst nie endgültig verdrängt« hat, sondern daß »ein beständiger
Wechsel dieser beiden Kunstrichtungen« stattfand und noch immer stattfindet (S. 17).
Nach Wundt müßte die typisierende aus der individuell charakterisierenden Kunst
hervorgegangen sein; in Wahrheit, meint Schubert-Soldern, sei »die Kunst mit ver-
schiedenen Unterbrechungen allmählich von der künstlerischen Verarbeitung von
Gemeinvorstellungen zu der künstlerischen Verarbeitung und Gestaltung von Indi-
vidualvorstellungen und damit von sogenannten typischen Darstellungen zu indi-
viduellen fortgeschritten«, »während sie wiederum anderseits auf induktivem Wege
von Einzelvorstellungen zu Gesamt- oder Totalvorstellungen des Kunstwerks ge-
langte« — ähnlich, wie auch in der Wissenschaft nicht die deduktive Methode die
induktive ablöst, sondern beide jederzeit Hand in Hand gehen und zusammenwirken
(S. IS). Den gediegenen Kern der Wundtschen Theorie erblickt er in der Feststel-
lung, »daß sich die Phantasie der durch die praktische Notwendigkeit bedingten
Formen und Gestaltungen bemächtigt, um sie künstlerisch umzugestalten; und zwar
wird sie diese Umgestaltung immer im Sinne derjenigen leitenden Ideen vornehmen,
von denen das Individuum, die Epoche oder das Kulturvolk erfüllt ist« (S. 13).
Indes besinnt er sich hier auf die Tatsache, daß nicht jede große Bewegung sich
in der zeitgenössischen Kunst gleich vollkommen wiederspiegelt, und da er für die
Erklärung dieses Faktums die Kantsche Unterscheidung von ästhetischen und Ver-
nunftideen zu Hilfe nimmt, so erscheint die notwendige Einschränkung bei ihm in
der Gestalt des Satzes, daß vor allem dann die leitenden Ideen einer Epoche die
Kunst bestimmen werden, wenn sie selber anschaulicher Art sind und nicht den
Charakter von bloßen Vernunftideen an sich tragen. Mittels der Kantschen Kon-
zeptionen scheint ihm auch die künstlerische gegen die wissenschaftliche oder >Be-
griffsphantasie« leicht und sicher abgrenzbar.
Bis hierher ist jedenfalls der Einfluß Wundts im ganzen der maßgebende. In
dem weiteren Gedankengange aber entfernt sich Schubert-Soldern nicht bloß von
dem Meister, sondern tritt er sogar in entschiedenen Gegensatz zu ihm. Wundt
ignoriert bekanntlich die emotionelle Seite der Kunst, der Verfasser legt auf diese
Seite so hohes Gewicht, daß er der Untersuchung der »lusterregenden Momente
in der Kunst« den größeren Teil seiner Arbeit widmet. Zunächst handelt es sich
natürlich darum, die Emotionen, welche der Kunstgenuß auslöst, ihrem allgemeinen
Charakter nach zu bestimmen. Dies versucht Schubert-Soldern im Anschluß an
Elsenhans, mit welchem er die ästhetischen unter die intellektuellen Gefühle einreiht
und von dem er sich auch über das Wesen dieser intellektuellen Gefühle überhaupt
und hierbei ihre Heterogenie, d. h. ihre Entstehung aus andersartigen Tätigkeits-
formen überzeugend nachgewiesen hat. Während jedoch der Verfasser die Lange-
sche Illusionstheorie ablehnt, die sich nach seiner Meinung durch die Einführung
der Lehre von den illusionsstörenden Momenten selber aufheben würde, übernimmt
er nicht nur Wundts Grundanschauung, wonach im Kunstschaffen wie im Kunst-
genüsse die Phantasie die Hauptrolle spielt, indem nach Schubert-Solderns Aus-
druck »allein« ihre Kraft es ist, »die aus den durch rein praktische Notwendigkeiten
entstandenen Formen im Wege von Assoziationen und dadurch hervorgerufenen
Assimilationen Kunstformen schafft« (S. 10), sondern anerkennt er auch zum großen
Teile die einzelnen, vom Leipziger Philosophen unterschiedenen Stufen der Kunst-
entwicklung. Bloß daß die »Idealkunst«, Wundts viertes Stadium, zum angeblich
dritten Stadium, der Nachahmungskunst, in demselben Verhältnisse wie die Erinne-
rungs- zur Gegenwartskunst stehen, also den imitativen Künsten stets zeitlich nach-
folgen solle, bezweifelt der Verfasser: er weist demgegenüber auf den »tatsäch-
lichen Gang der Kunstentwicklung« hin, welcher lehre, daß die Idealkunst »die
Nachahmungskunst nie endgültig verdrängt« hat, sondern daß »ein beständiger
Wechsel dieser beiden Kunstrichtungen« stattfand und noch immer stattfindet (S. 17).
Nach Wundt müßte die typisierende aus der individuell charakterisierenden Kunst
hervorgegangen sein; in Wahrheit, meint Schubert-Soldern, sei »die Kunst mit ver-
schiedenen Unterbrechungen allmählich von der künstlerischen Verarbeitung von
Gemeinvorstellungen zu der künstlerischen Verarbeitung und Gestaltung von Indi-
vidualvorstellungen und damit von sogenannten typischen Darstellungen zu indi-
viduellen fortgeschritten«, »während sie wiederum anderseits auf induktivem Wege
von Einzelvorstellungen zu Gesamt- oder Totalvorstellungen des Kunstwerks ge-
langte« — ähnlich, wie auch in der Wissenschaft nicht die deduktive Methode die
induktive ablöst, sondern beide jederzeit Hand in Hand gehen und zusammenwirken
(S. IS). Den gediegenen Kern der Wundtschen Theorie erblickt er in der Feststel-
lung, »daß sich die Phantasie der durch die praktische Notwendigkeit bedingten
Formen und Gestaltungen bemächtigt, um sie künstlerisch umzugestalten; und zwar
wird sie diese Umgestaltung immer im Sinne derjenigen leitenden Ideen vornehmen,
von denen das Individuum, die Epoche oder das Kulturvolk erfüllt ist« (S. 13).
Indes besinnt er sich hier auf die Tatsache, daß nicht jede große Bewegung sich
in der zeitgenössischen Kunst gleich vollkommen wiederspiegelt, und da er für die
Erklärung dieses Faktums die Kantsche Unterscheidung von ästhetischen und Ver-
nunftideen zu Hilfe nimmt, so erscheint die notwendige Einschränkung bei ihm in
der Gestalt des Satzes, daß vor allem dann die leitenden Ideen einer Epoche die
Kunst bestimmen werden, wenn sie selber anschaulicher Art sind und nicht den
Charakter von bloßen Vernunftideen an sich tragen. Mittels der Kantschen Kon-
zeptionen scheint ihm auch die künstlerische gegen die wissenschaftliche oder >Be-
griffsphantasie« leicht und sicher abgrenzbar.
Bis hierher ist jedenfalls der Einfluß Wundts im ganzen der maßgebende. In
dem weiteren Gedankengange aber entfernt sich Schubert-Soldern nicht bloß von
dem Meister, sondern tritt er sogar in entschiedenen Gegensatz zu ihm. Wundt
ignoriert bekanntlich die emotionelle Seite der Kunst, der Verfasser legt auf diese
Seite so hohes Gewicht, daß er der Untersuchung der »lusterregenden Momente
in der Kunst« den größeren Teil seiner Arbeit widmet. Zunächst handelt es sich
natürlich darum, die Emotionen, welche der Kunstgenuß auslöst, ihrem allgemeinen
Charakter nach zu bestimmen. Dies versucht Schubert-Soldern im Anschluß an
Elsenhans, mit welchem er die ästhetischen unter die intellektuellen Gefühle einreiht
und von dem er sich auch über das Wesen dieser intellektuellen Gefühle überhaupt