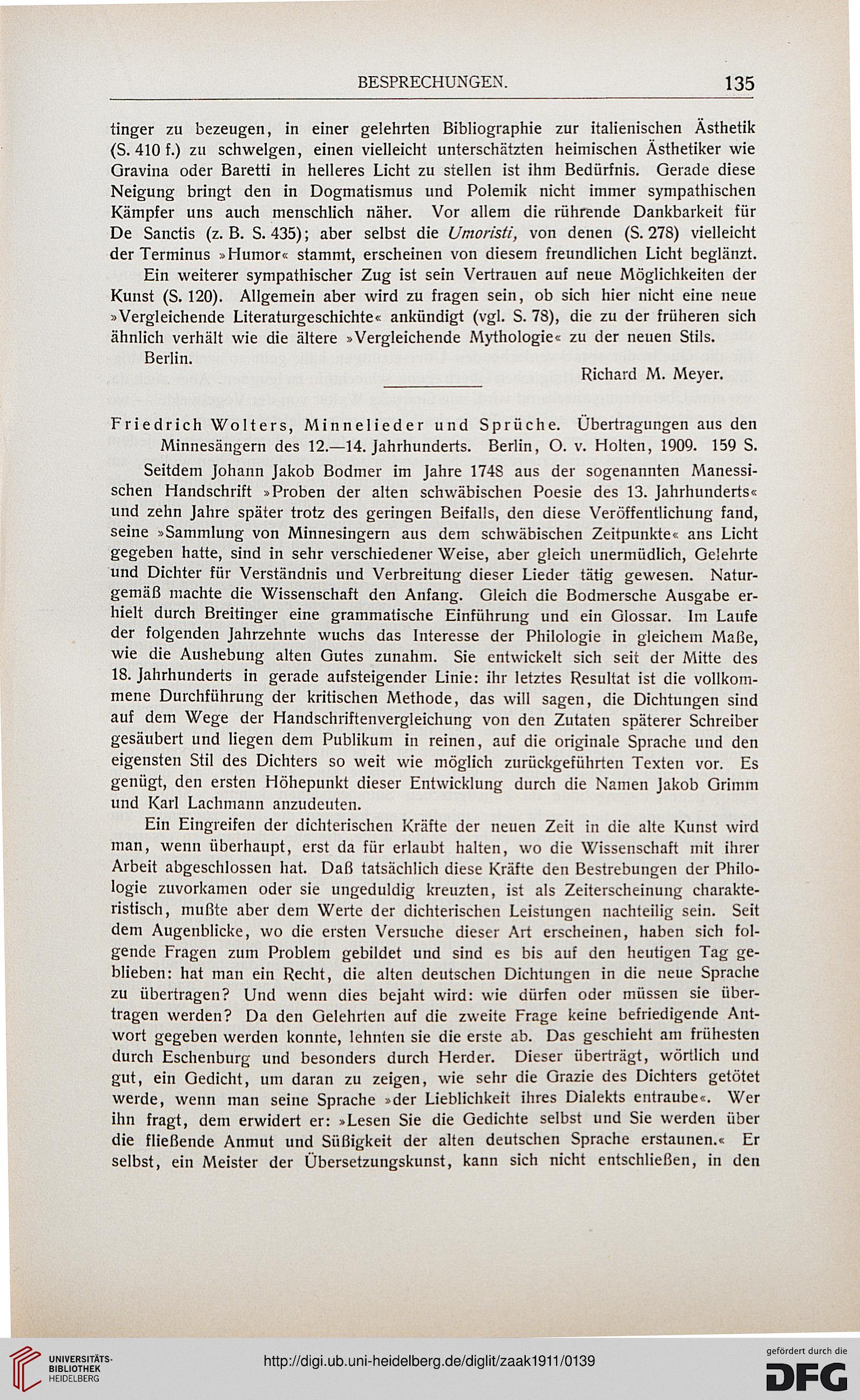BESPRECHUNGEN. 135
tinger zu bezeugen, in einer gelehrten Bibliographie zur italienischen Ästhetik
(S. 410 f.) zu schwelgen, einen vielleicht unterschätzten heimischen Ästhetiker wie
Gravina oder Baretti in helleres Licht zu stellen ist ihm Bedürfnis. Gerade diese
Neigung bringt den in Dogmatismus und Polemik nicht immer sympathischen
Kämpfer uns auch menschlich näher. Vor allem die rührende Dankbarkeit für
De Sanctis (z.B. S. 435); aber selbst die Umoristi, von denen (S. 278) vielleicht
der Terminus »Humor« stammt, erscheinen von diesem freundlichen Licht beglänzt.
Ein weiterer sympathischer Zug ist sein Vertrauen auf neue Möglichkeiten der
Kunst (S. 120). Allgemein aber wird zu fragen sein, ob sich hier nicht eine neue
»Vergleichende Literaturgeschichte« ankündigt (vgl. S. 78), die zu der früheren sich
ähnlich verhält wie die ältere »Vergleichende Mythologiec zu der neuen Stils.
Berlin.
Richard M. Meyer.
Friedrich Wolters, Minnelieder und Sprüche. Übertragungen aus den
Minnesängern des 12.—14. Jahrhunderts. Berlin, O. v. Holten, 1909. 159 S.
Seitdem Johann Jakob Bodmer im Jahre 174S aus der sogenannten Manessi-
schen Handschrift »Proben der alten schwäbischen Poesie des 13. Jahrhunderts«
und zehn Jahre später trotz des geringen Beifalls, den diese Veröffentlichung fand,
seine »Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkte« ans Licht
gegeben hatte, sind in sehr verschiedener Weise, aber gleich unermüdlich, Gelehrte
und Dichter für Verständnis und Verbreitung dieser Lieder tätig gewesen. Natur-
gemäß machte die Wissenschaft den Anfang. Gleich die Bodmersche Ausgabe er-
hielt durch Breitinger eine grammatische Einführung und ein Glossar. Im Laufe
der folgenden Jahrzehnte wuchs das Interesse der Philologie in gleichem Maße,
wie die Aushebung alten Gutes zunahm. Sie entwickelt sich seit der Mitte des
18. Jahrhunderts in gerade aufsteigender Linie: ihr letztes Resultat ist die vollkom-
mene Durchführung der kritischen Methode, das will sagen, die Dichtungen sind
auf dem Wege der Handschriftenvergleichung von den Zutaten späterer Schreiber
gesäubert und liegen dem Publikum in reinen, auf die originale Sprache und den
eigensten Stil des Dichters so weit wie möglich zurückgeführten Texten vor. Es
genügt, den ersten Höhepunkt dieser Entwicklung durch die Namen Jakob Grimm
und Karl Lachmann anzudeuten.
Ein Eingreifen der dichterischen Kräfte der neuen Zeit in die alte Kunst wird
man, wenn überhaupt, erst da für erlaubt halten, wo die Wissenschaft mit ihrer
Arbeit abgeschlossen hat. Daß tatsächlich diese Kräfte den Bestrebungen der Philo-
logie zuvorkamen oder sie ungeduldig kreuzten, ist als Zeiterscheinung charakte-
ristisch, mußte aber dem Werte der dichterischen Leistungen nachteilig sein. Seit
dem Augenblicke, wo die ersten Versuche dieser Art erscheinen, haben sich fol-
gende Fragen zum Problem gebildet und sind es bis auf den heutigen Tag ge-
blieben: hat man ein Recht, die alten deutschen Dichtungen in die neue Sprache
zu übertragen? Und wenn dies bejaht wird: wie dürfen oder müssen sie über-
tragen werden? Da den Gelehrten auf die zweite Frage keine befriedigende Ant-
wort gegeben werden konnte, lehnten sie die erste ab. Das geschieht am frühesten
durch Eschenburg und besonders durch Herder. Dieser überträgt, wörtlich und
gut, ein Gedicht, um daran zu zeigen, wie sehr die Grazie des Dichters getötet
werde, wenn man seine Sprache »der Lieblichkeit ihres Dialekts entraube«. Wer
ihn fragt, dem erwidert er: »Lesen Sie die Gedichte selbst und Sie werden über
die fließende Anmut und Süßigkeit der alten deutschen Sprache erstaunen.« Er
selbst, ein Meister der Übersetzungskunst, kann sich nicht entschließen, in den
tinger zu bezeugen, in einer gelehrten Bibliographie zur italienischen Ästhetik
(S. 410 f.) zu schwelgen, einen vielleicht unterschätzten heimischen Ästhetiker wie
Gravina oder Baretti in helleres Licht zu stellen ist ihm Bedürfnis. Gerade diese
Neigung bringt den in Dogmatismus und Polemik nicht immer sympathischen
Kämpfer uns auch menschlich näher. Vor allem die rührende Dankbarkeit für
De Sanctis (z.B. S. 435); aber selbst die Umoristi, von denen (S. 278) vielleicht
der Terminus »Humor« stammt, erscheinen von diesem freundlichen Licht beglänzt.
Ein weiterer sympathischer Zug ist sein Vertrauen auf neue Möglichkeiten der
Kunst (S. 120). Allgemein aber wird zu fragen sein, ob sich hier nicht eine neue
»Vergleichende Literaturgeschichte« ankündigt (vgl. S. 78), die zu der früheren sich
ähnlich verhält wie die ältere »Vergleichende Mythologiec zu der neuen Stils.
Berlin.
Richard M. Meyer.
Friedrich Wolters, Minnelieder und Sprüche. Übertragungen aus den
Minnesängern des 12.—14. Jahrhunderts. Berlin, O. v. Holten, 1909. 159 S.
Seitdem Johann Jakob Bodmer im Jahre 174S aus der sogenannten Manessi-
schen Handschrift »Proben der alten schwäbischen Poesie des 13. Jahrhunderts«
und zehn Jahre später trotz des geringen Beifalls, den diese Veröffentlichung fand,
seine »Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkte« ans Licht
gegeben hatte, sind in sehr verschiedener Weise, aber gleich unermüdlich, Gelehrte
und Dichter für Verständnis und Verbreitung dieser Lieder tätig gewesen. Natur-
gemäß machte die Wissenschaft den Anfang. Gleich die Bodmersche Ausgabe er-
hielt durch Breitinger eine grammatische Einführung und ein Glossar. Im Laufe
der folgenden Jahrzehnte wuchs das Interesse der Philologie in gleichem Maße,
wie die Aushebung alten Gutes zunahm. Sie entwickelt sich seit der Mitte des
18. Jahrhunderts in gerade aufsteigender Linie: ihr letztes Resultat ist die vollkom-
mene Durchführung der kritischen Methode, das will sagen, die Dichtungen sind
auf dem Wege der Handschriftenvergleichung von den Zutaten späterer Schreiber
gesäubert und liegen dem Publikum in reinen, auf die originale Sprache und den
eigensten Stil des Dichters so weit wie möglich zurückgeführten Texten vor. Es
genügt, den ersten Höhepunkt dieser Entwicklung durch die Namen Jakob Grimm
und Karl Lachmann anzudeuten.
Ein Eingreifen der dichterischen Kräfte der neuen Zeit in die alte Kunst wird
man, wenn überhaupt, erst da für erlaubt halten, wo die Wissenschaft mit ihrer
Arbeit abgeschlossen hat. Daß tatsächlich diese Kräfte den Bestrebungen der Philo-
logie zuvorkamen oder sie ungeduldig kreuzten, ist als Zeiterscheinung charakte-
ristisch, mußte aber dem Werte der dichterischen Leistungen nachteilig sein. Seit
dem Augenblicke, wo die ersten Versuche dieser Art erscheinen, haben sich fol-
gende Fragen zum Problem gebildet und sind es bis auf den heutigen Tag ge-
blieben: hat man ein Recht, die alten deutschen Dichtungen in die neue Sprache
zu übertragen? Und wenn dies bejaht wird: wie dürfen oder müssen sie über-
tragen werden? Da den Gelehrten auf die zweite Frage keine befriedigende Ant-
wort gegeben werden konnte, lehnten sie die erste ab. Das geschieht am frühesten
durch Eschenburg und besonders durch Herder. Dieser überträgt, wörtlich und
gut, ein Gedicht, um daran zu zeigen, wie sehr die Grazie des Dichters getötet
werde, wenn man seine Sprache »der Lieblichkeit ihres Dialekts entraube«. Wer
ihn fragt, dem erwidert er: »Lesen Sie die Gedichte selbst und Sie werden über
die fließende Anmut und Süßigkeit der alten deutschen Sprache erstaunen.« Er
selbst, ein Meister der Übersetzungskunst, kann sich nicht entschließen, in den