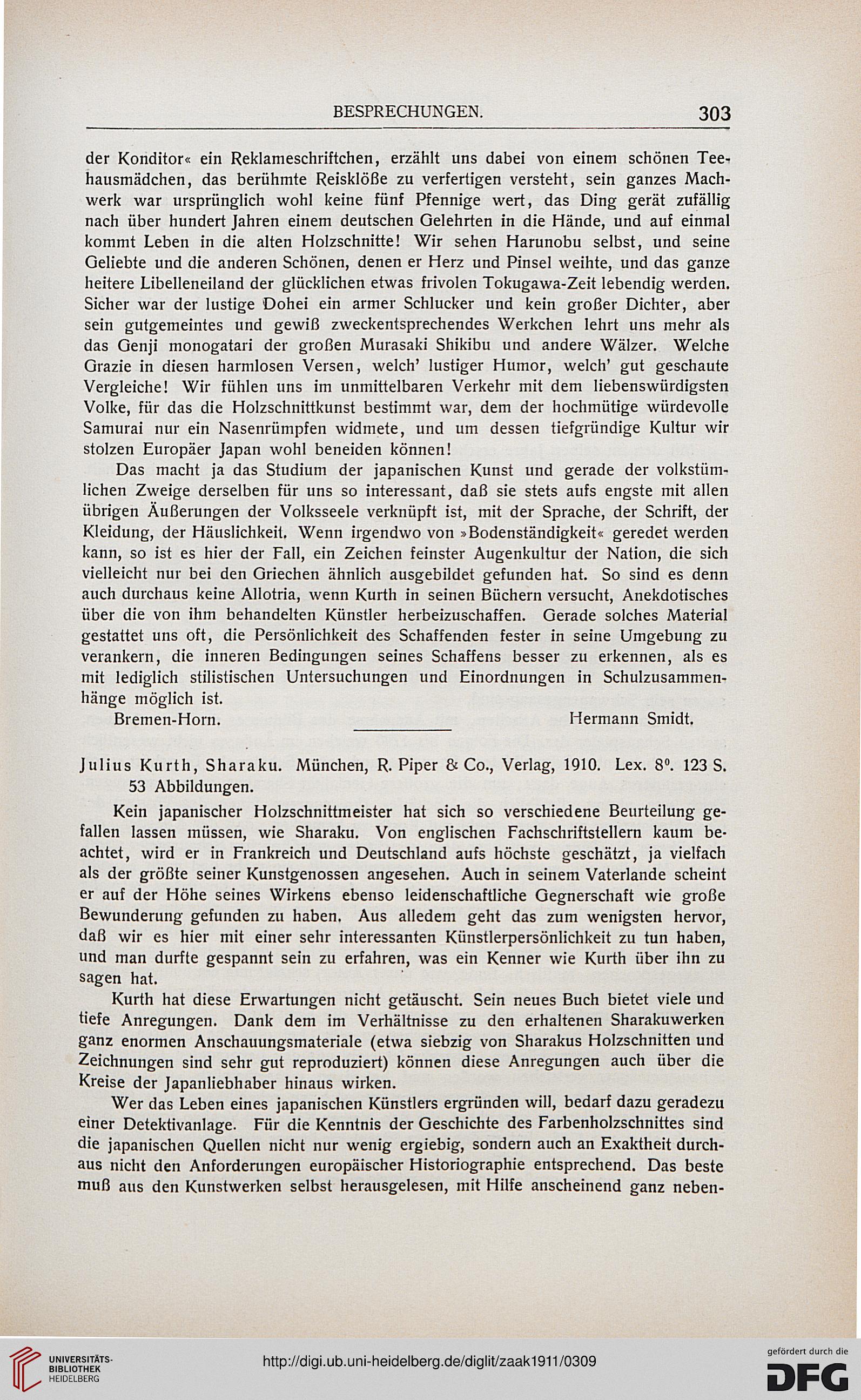BESPRECHUNGEN. 303
der Konditor« ein Reklameschriftchen, erzählt uns dabei von einem schönen Tee-
hausmädchen, das berühmte Reisklöße zu verfertigen versteht, sein ganzes Mach-
werk war ursprünglich wohl keine fünf Pfennige wert, das Ding gerät zufällig
nach über hundert Jahren einem deutschen Gelehrten in die Hände, und auf einmal
kommt Leben in die alten Holzschnitte! Wir sehen Harunobu selbst, und seine
Geliebte und die anderen Schönen, denen er Herz und Pinsel weihte, und das ganze
heitere Libelleneiland der glücklichen etwas frivolen Tokugawa-Zeit lebendig werden.
Sicher war der lustige Dohei ein armer Schlucker und kein großer Dichter, aber
sein gutgemeintes und gewiß zweckentsprechendes Werkchen lehrt uns mehr als
das Genji monogatari der großen Murasaki Shikibu und andere Wälzer. Welche
Grazie in diesen harmlosen Versen, welch' lustiger Humor, welch' gut geschaute
Vergleiche! Wir fühlen uns im unmittelbaren Verkehr mit dem liebenswürdigsten
Volke, für das die Holzschnittkunst bestimmt war, dem der hochmütige würdevolle
Samurai nur ein Nasenrümpfen widmete, und um dessen tiefgründige Kultur wir
stolzen Europäer Japan wohl beneiden können!
Das macht ja das Studium der japanischen Kunst und gerade der volkstüm-
lichen Zweige derselben für uns so interessant, daß sie stets aufs engste mit allen
übrigen Äußerungen der Volksseele verknüpft ist, mit der Sprache, der Schrift, der
Kleidung, der Häuslichkeit. Wenn irgendwo von »Bodenständigkeit« geredet werden
kann, so ist es hier der Fall, ein Zeichen feinster Augenkultur der Nation, die sich
vielleicht nur bei den Griechen ähnlich ausgebildet gefunden hat. So sind es denn
auch durchaus keine Allotria, wenn Kurth in seinen Büchern versucht, Anekdotisches
über die von ihm behandelten Künstler herbeizuschaffen. Gerade solches Material
gestattet uns oft, die Persönlichkeit des Schaffenden fester in seine Umgebung zu
verankern, die inneren Bedingungen seines Schaffens besser zu erkennen, als es
mit lediglich stilistischen Untersuchungen und Einordnungen in Schulzusammen-
hänge möglich ist.
Bremen-Horn. Hermann Smidt.
Julius Kurth, Sharaku. München, R.Piper & Co., Verlag, 1910. Lex. 8°. 123 S.
53 Abbildungen.
Kein japanischer Holzschnittmeister hat sich so verschiedene Beurteilung ge-
fallen lassen müssen, wie Sharaku. Von englischen Fachschriftstellern kaum be-
achtet, wird er in Frankreich und Deutschland aufs höchste geschätzt, ja vielfach
als der größte seiner Kunstgenossen angesehen. Auch in seinem Vaterlande scheint
er auf der Höhe seines Wirkens ebenso leidenschaftliche Gegnerschaft wie große
Bewunderung gefunden zu haben. Aus alledem geht das zum wenigsten hervor,
daß wir es hier mit einer sehr interessanten Künstlerpersönlichkeit zu tun haben,
und man durfte gespannt sein zu erfahren, was ein Kenner wie Kurth über ihn zu
sagen hat.
Kurth hat diese Erwartungen nicht getäuscht. Sein neues Buch bietet viele und
tiefe Anregungen. Dank dem im Verhältnisse zu den erhaltenen Sharakuwerken
ganz enormen Anschauungsmateriale (etwa siebzig von Sharakus Holzschnitten und
Zeichnungen sind sehr gut reproduziert) können diese Anregungen auch über die
Kreise der Japanliebhaber hinaus wirken.
Wer das Leben eines japanischen Künstlers ergründen will, bedarf dazu geradezu
einer Detektivanlage. Für die Kenntnis der Geschichte des Farbenholzschnittes sind
die japanischen Quellen nicht nur wenig ergiebig, sondern auch an Exaktheit durch-
aus nicht den Anforderungen europäischer Historiographie entsprechend. Das beste
muß aus den Kunstwerken selbst herausgelesen, mit Hilfe anscheinend ganz neben-
der Konditor« ein Reklameschriftchen, erzählt uns dabei von einem schönen Tee-
hausmädchen, das berühmte Reisklöße zu verfertigen versteht, sein ganzes Mach-
werk war ursprünglich wohl keine fünf Pfennige wert, das Ding gerät zufällig
nach über hundert Jahren einem deutschen Gelehrten in die Hände, und auf einmal
kommt Leben in die alten Holzschnitte! Wir sehen Harunobu selbst, und seine
Geliebte und die anderen Schönen, denen er Herz und Pinsel weihte, und das ganze
heitere Libelleneiland der glücklichen etwas frivolen Tokugawa-Zeit lebendig werden.
Sicher war der lustige Dohei ein armer Schlucker und kein großer Dichter, aber
sein gutgemeintes und gewiß zweckentsprechendes Werkchen lehrt uns mehr als
das Genji monogatari der großen Murasaki Shikibu und andere Wälzer. Welche
Grazie in diesen harmlosen Versen, welch' lustiger Humor, welch' gut geschaute
Vergleiche! Wir fühlen uns im unmittelbaren Verkehr mit dem liebenswürdigsten
Volke, für das die Holzschnittkunst bestimmt war, dem der hochmütige würdevolle
Samurai nur ein Nasenrümpfen widmete, und um dessen tiefgründige Kultur wir
stolzen Europäer Japan wohl beneiden können!
Das macht ja das Studium der japanischen Kunst und gerade der volkstüm-
lichen Zweige derselben für uns so interessant, daß sie stets aufs engste mit allen
übrigen Äußerungen der Volksseele verknüpft ist, mit der Sprache, der Schrift, der
Kleidung, der Häuslichkeit. Wenn irgendwo von »Bodenständigkeit« geredet werden
kann, so ist es hier der Fall, ein Zeichen feinster Augenkultur der Nation, die sich
vielleicht nur bei den Griechen ähnlich ausgebildet gefunden hat. So sind es denn
auch durchaus keine Allotria, wenn Kurth in seinen Büchern versucht, Anekdotisches
über die von ihm behandelten Künstler herbeizuschaffen. Gerade solches Material
gestattet uns oft, die Persönlichkeit des Schaffenden fester in seine Umgebung zu
verankern, die inneren Bedingungen seines Schaffens besser zu erkennen, als es
mit lediglich stilistischen Untersuchungen und Einordnungen in Schulzusammen-
hänge möglich ist.
Bremen-Horn. Hermann Smidt.
Julius Kurth, Sharaku. München, R.Piper & Co., Verlag, 1910. Lex. 8°. 123 S.
53 Abbildungen.
Kein japanischer Holzschnittmeister hat sich so verschiedene Beurteilung ge-
fallen lassen müssen, wie Sharaku. Von englischen Fachschriftstellern kaum be-
achtet, wird er in Frankreich und Deutschland aufs höchste geschätzt, ja vielfach
als der größte seiner Kunstgenossen angesehen. Auch in seinem Vaterlande scheint
er auf der Höhe seines Wirkens ebenso leidenschaftliche Gegnerschaft wie große
Bewunderung gefunden zu haben. Aus alledem geht das zum wenigsten hervor,
daß wir es hier mit einer sehr interessanten Künstlerpersönlichkeit zu tun haben,
und man durfte gespannt sein zu erfahren, was ein Kenner wie Kurth über ihn zu
sagen hat.
Kurth hat diese Erwartungen nicht getäuscht. Sein neues Buch bietet viele und
tiefe Anregungen. Dank dem im Verhältnisse zu den erhaltenen Sharakuwerken
ganz enormen Anschauungsmateriale (etwa siebzig von Sharakus Holzschnitten und
Zeichnungen sind sehr gut reproduziert) können diese Anregungen auch über die
Kreise der Japanliebhaber hinaus wirken.
Wer das Leben eines japanischen Künstlers ergründen will, bedarf dazu geradezu
einer Detektivanlage. Für die Kenntnis der Geschichte des Farbenholzschnittes sind
die japanischen Quellen nicht nur wenig ergiebig, sondern auch an Exaktheit durch-
aus nicht den Anforderungen europäischer Historiographie entsprechend. Das beste
muß aus den Kunstwerken selbst herausgelesen, mit Hilfe anscheinend ganz neben-