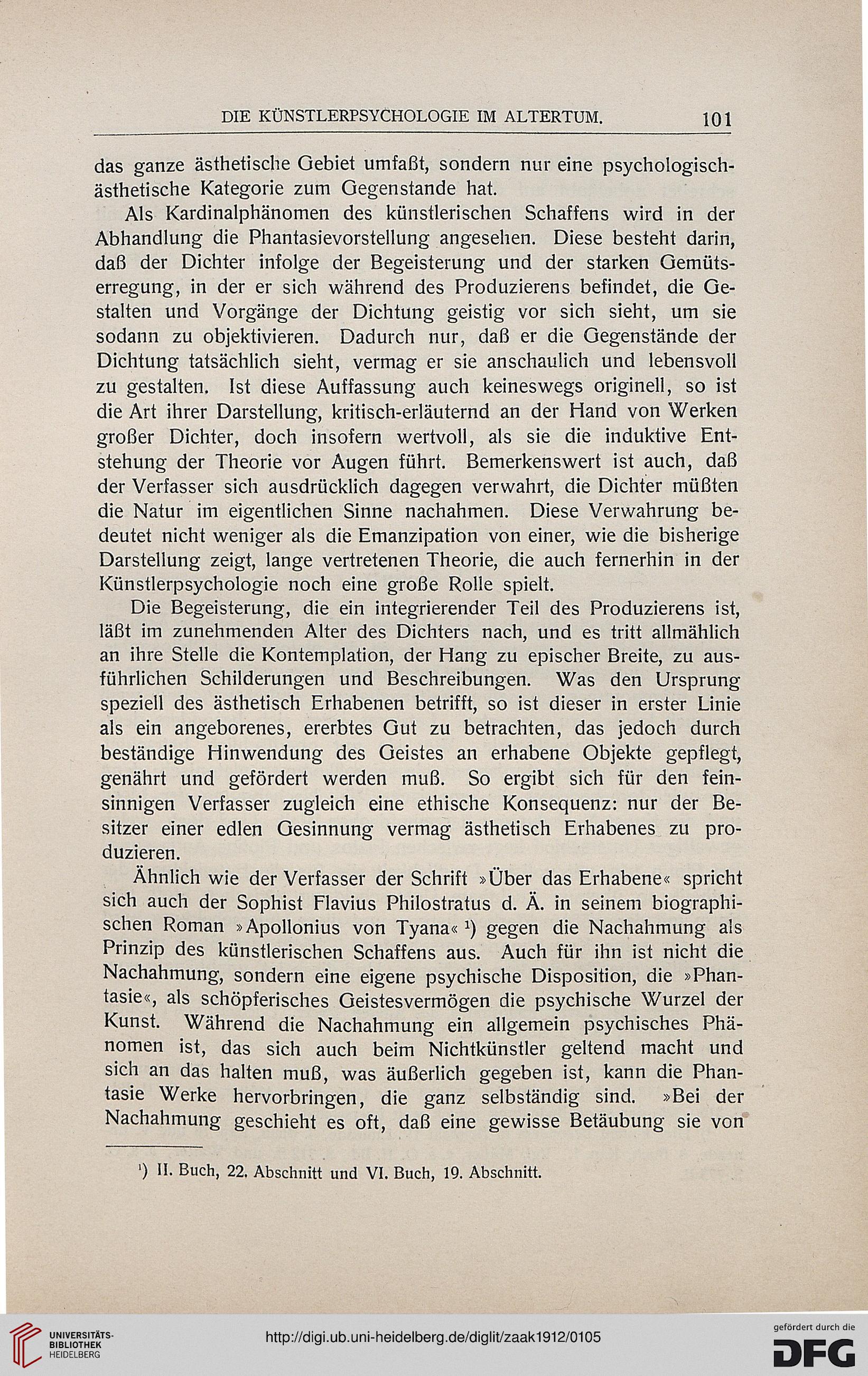DIE KÜNSTLERPSYCHOLOGIE IM ALTERTUM. 101
das ganze ästhetische Gebiet umfaßt, sondern nur eine psychologisch-
ästhetische Kategorie zum Gegen stände hat.
Als Kardinalphänomen des künstlerischen Schaffens wird in der
Abhandlung die Phantasievorstellung angesehen. Diese besteht darin,
daß der Dichter infolge der Begeisterung und der starken Gemüts-
erregung, in der er sich während des Produzierens befindet, die Ge-
stalten und Vorgänge der Dichtung geistig vor sich sieht, um sie
sodann zu objektivieren. Dadurch nur, daß er die Gegenstände der
Dichtung tatsächlich sieht, vermag er sie anschaulich und lebensvoll
zu gestalten. Ist diese Auffassung auch keineswegs originell, so ist
die Art ihrer Darstellung, kritisch-erläuternd an der Hand von Werken
großer Dichter, doch insofern wertvoll, als sie die induktive Ent-
stehung der Theorie vor Augen führt. Bemerkenswert ist auch, daß
der Verfasser sich ausdrücklich dagegen verwahrt, die Dichter müßten
die Natur im eigentlichen Sinne nachahmen. Diese Verwahrung be-
deutet nicht weniger als die Emanzipation von einer, wie die bisherige
Darstellung zeigt, lange vertretenen Theorie, die auch fernerhin in der
Künstlerpsychologie noch eine große Rolle spielt.
Die Begeisterung, die ein integrierender Teil des Produzierens ist,
läßt im zunehmenden Alter des Dichters nach, und es tritt allmählich
an ihre Stelle die Kontemplation, der Hang zu epischer Breite, zu aus-
führlichen Schilderungen und Beschreibungen. Was den Ursprung
speziell des ästhetisch Erhabenen betrifft, so ist dieser in erster Linie
als ein angeborenes, ererbtes Gut zu betrachten, das jedoch durch
beständige Hinwendung des Geistes an erhabene Objekte gepflegt,
genährt und gefördert werden muß. So ergibt sich für den fein-
sinnigen Verfasser zugleich eine ethische Konsequenz: nur der Be-
sitzer einer edlen Gesinnung vermag ästhetisch Erhabenes zu pro-
duzieren.
Ähnlich wie der Verfasser der Schrift »Über das Erhabene« spricht
sich auch der Sophist Flavius Philostratus d. Ä. in seinem biographi-
schen Roman »Apollonius von Tyana« *) gegen die Nachahmung als
Prinzip des künstlerischen Schaffens aus. Auch für ihn ist nicht die
Nachahmung, sondern eine eigene psychische Disposition, die »Phan-
tasie«, als schöpferisches Geistesvermögen die psychische Wurzel der
Kunst. Während die Nachahmung ein allgemein psychisches Phä-
nomen ist, das sich auch beim Nichtkünstler geltend macht und
sich an das halten muß, was äußerlich gegeben ist, kann die Phan-
tasie Werke hervorbringen, die ganz selbständig sind. »Bei der
Nachahmung geschieht es oft, daß eine gewisse Betäubung sie von
') II. Buch, 22. Abschnitt und VI. Buch, 19. Abschnitt.
das ganze ästhetische Gebiet umfaßt, sondern nur eine psychologisch-
ästhetische Kategorie zum Gegen stände hat.
Als Kardinalphänomen des künstlerischen Schaffens wird in der
Abhandlung die Phantasievorstellung angesehen. Diese besteht darin,
daß der Dichter infolge der Begeisterung und der starken Gemüts-
erregung, in der er sich während des Produzierens befindet, die Ge-
stalten und Vorgänge der Dichtung geistig vor sich sieht, um sie
sodann zu objektivieren. Dadurch nur, daß er die Gegenstände der
Dichtung tatsächlich sieht, vermag er sie anschaulich und lebensvoll
zu gestalten. Ist diese Auffassung auch keineswegs originell, so ist
die Art ihrer Darstellung, kritisch-erläuternd an der Hand von Werken
großer Dichter, doch insofern wertvoll, als sie die induktive Ent-
stehung der Theorie vor Augen führt. Bemerkenswert ist auch, daß
der Verfasser sich ausdrücklich dagegen verwahrt, die Dichter müßten
die Natur im eigentlichen Sinne nachahmen. Diese Verwahrung be-
deutet nicht weniger als die Emanzipation von einer, wie die bisherige
Darstellung zeigt, lange vertretenen Theorie, die auch fernerhin in der
Künstlerpsychologie noch eine große Rolle spielt.
Die Begeisterung, die ein integrierender Teil des Produzierens ist,
läßt im zunehmenden Alter des Dichters nach, und es tritt allmählich
an ihre Stelle die Kontemplation, der Hang zu epischer Breite, zu aus-
führlichen Schilderungen und Beschreibungen. Was den Ursprung
speziell des ästhetisch Erhabenen betrifft, so ist dieser in erster Linie
als ein angeborenes, ererbtes Gut zu betrachten, das jedoch durch
beständige Hinwendung des Geistes an erhabene Objekte gepflegt,
genährt und gefördert werden muß. So ergibt sich für den fein-
sinnigen Verfasser zugleich eine ethische Konsequenz: nur der Be-
sitzer einer edlen Gesinnung vermag ästhetisch Erhabenes zu pro-
duzieren.
Ähnlich wie der Verfasser der Schrift »Über das Erhabene« spricht
sich auch der Sophist Flavius Philostratus d. Ä. in seinem biographi-
schen Roman »Apollonius von Tyana« *) gegen die Nachahmung als
Prinzip des künstlerischen Schaffens aus. Auch für ihn ist nicht die
Nachahmung, sondern eine eigene psychische Disposition, die »Phan-
tasie«, als schöpferisches Geistesvermögen die psychische Wurzel der
Kunst. Während die Nachahmung ein allgemein psychisches Phä-
nomen ist, das sich auch beim Nichtkünstler geltend macht und
sich an das halten muß, was äußerlich gegeben ist, kann die Phan-
tasie Werke hervorbringen, die ganz selbständig sind. »Bei der
Nachahmung geschieht es oft, daß eine gewisse Betäubung sie von
') II. Buch, 22. Abschnitt und VI. Buch, 19. Abschnitt.