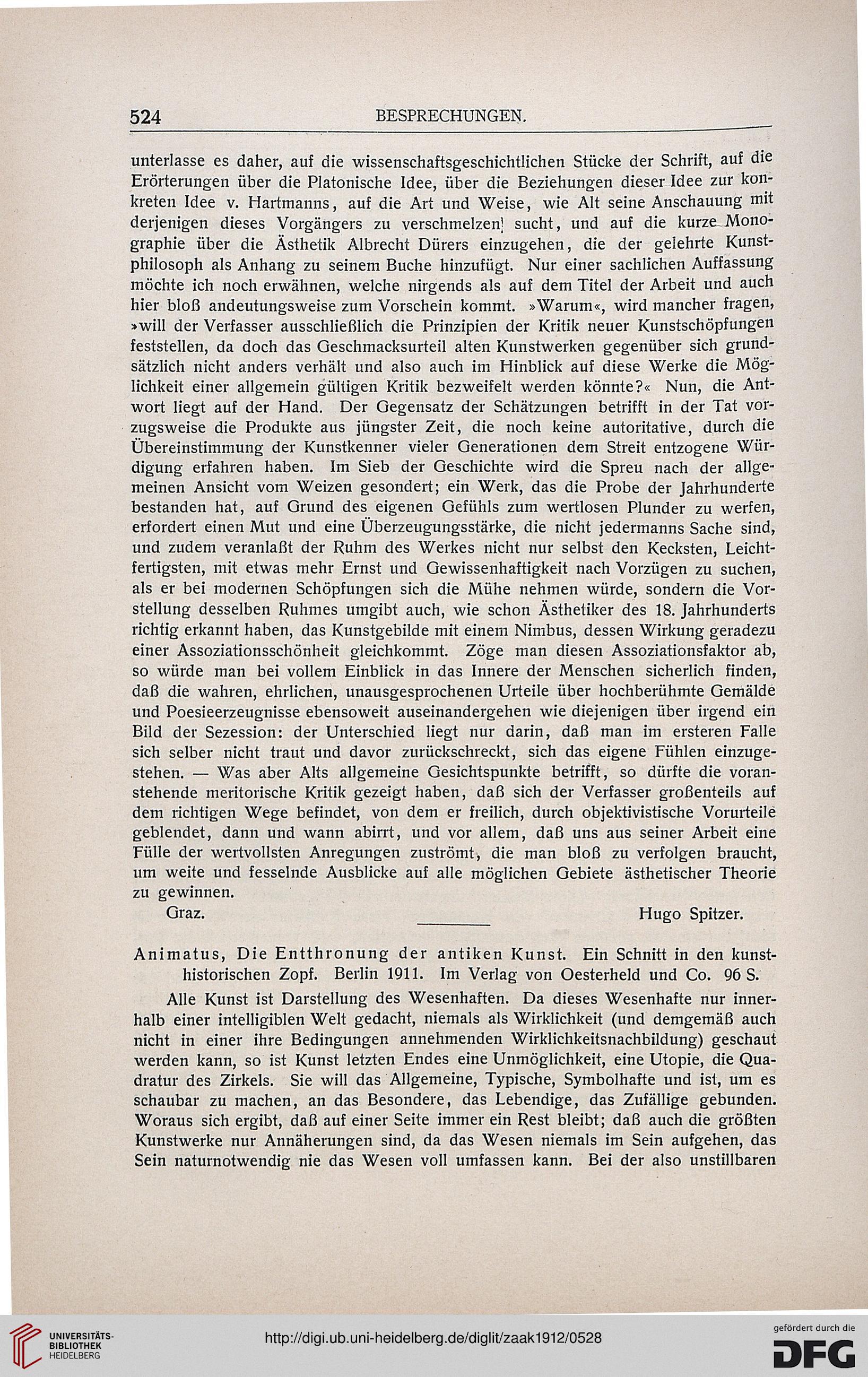524 BESPRECHUNGEN.
unterlasse es daher, auf die wissenschaftsgeschichtlichen Stücke der Schrift, auf die
Erörterungen über die Platonische Idee, über die Beziehungen dieser Idee zur kon-
kreten Idee v. Hartmanns, auf die Art und Weise, wie Alt seine Anschauung mit
derjenigen dieses Vorgängers zu verschmelzen' sucht, und auf die kurze Mono-
graphie über die Ästhetik Albrecht Dürers einzugehen, die der gelehrte Kunst-
philosoph als Anhang zu seinem Buche hinzufügt. Nur einer sachlichen Auffassung
möchte ich noch erwähnen, welche nirgends als auf dem Titel der Arbeit und auch
hier bloß andeutungsweise zum Vorschein kommt. »Warum«, wird mancher fragen,
»will der Verfasser ausschließlich die Prinzipien der Kritik neuer Kunstschöpfungen
feststellen, da doch das Geschmacksurteil alten Kunstwerken gegenüber sich grund-
sätzlich nicht anders verhält und also auch im Hinblick auf diese Werke die Mög-
lichkeit einer allgemein gültigen Kritik bezweifelt werden könnte?« Nun, die Ant-
wort liegt auf der Hand. Der Gegensatz der Schätzungen betrifft in der Tat vor-
zugsweise die Produkte aus jüngster Zeit, die noch keine autoritative, durch die
Übereinstimmung der Kunstkenner vieler Generationen dem Streit entzogene Wür-
digung erfahren haben. Im Sieb der Geschichte wird die Spreu nach der allge-
meinen Ansicht vom Weizen gesondert; ein Werk, das die Probe der Jahrhunderte
bestanden hat, auf Grund des eigenen Gefühls zum wertlosen Plunder zu werfen,
erfordert einen Mut und eine Überzeugungsstärke, die nicht jedermanns Sache sind,
und zudem veranlaßt der Ruhm des Werkes nicht nur selbst den Kecksten, Leicht-
fertigsten, mit etwas mehr Ernst und Gewissenhaftigkeit nach Vorzügen zu suchen,
als er bei modernen Schöpfungen sich die Mühe nehmen würde, sondern die Vor-
stellung desselben Ruhmes umgibt auch, wie schon Ästhetiker des 18. Jahrhunderts
richtig erkannt haben, das Kunstgebilde mit einem Nimbus, dessen Wirkung geradezu
einer Assoziationsschönheit gleichkommt. Zöge man diesen Assoziationsfaktor ab,
so würde man bei vollem Einblick in das Innere der Menschen sicherlich finden,
daß die wahren, ehrlichen, unausgesprochenen Urteile über hochberühmte Gemälde
und Poesieerzeugnisse ebensoweit auseinandergehen wie diejenigen über irgend ein
Bild der Sezession: der Unterschied liegt nur darin, daß man im ersteren Falle
sich selber nicht traut und davor zurückschreckt, sich das eigene Fühlen einzuge-
stehen. — Was aber Alts allgemeine Gesichtspunkte betrifft, so dürfte die voran-
stehende meritorische Kritik gezeigt haben, daß sich der Verfasser großenteils auf
dem richtigen Wege befindet, von dem er freilich, durch objektivistische Vorurteile
geblendet, dann und wann abirrt, und vor allem, daß uns aus seiner Arbeit eine
Fülle der wertvollsten Anregungen zuströmt, die man bloß zu verfolgen braucht,
um weite und fesselnde Ausblicke auf alle möglichen Gebiete ästhetischer Theorie
zu gewinnen.
Graz. ________ Hugo Spitzer.
Animatus, Die Entthronung der antiken Kunst. Ein Schnitt in den kunst-
historischen Zopf. Berlin 1911. Im Verlag von Oesterheld und Co. 96 S.
Alle Kunst ist Darstellung des Wesenhaften. Da dieses Wesenhafte nur inner-
halb einer intelligiblen Welt gedacht, niemals als Wirklichkeit (und demgemäß auch
nicht in einer ihre Bedingungen annehmenden Wirklichkeitsnachbildung) geschaut
werden kann, so ist Kunst letzten Endes eine Unmöglichkeit, eine Utopie, die Qua-
dratur des Zirkels. Sie will das Allgemeine, Typische, Symbolhafte und ist, um es
schaubar zu machen, an das Besondere, das Lebendige, das Zufällige gebunden.
Woraus sich ergibt, daß auf einer Seite immer ein Rest bleibt; daß auch die größten
Kunstwerke nur Annäherungen sind, da das Wesen niemals im Sein aufgehen, das
Sein naturnotwendig nie das Wesen voll umfassen kann. Bei der also unstillbaren
unterlasse es daher, auf die wissenschaftsgeschichtlichen Stücke der Schrift, auf die
Erörterungen über die Platonische Idee, über die Beziehungen dieser Idee zur kon-
kreten Idee v. Hartmanns, auf die Art und Weise, wie Alt seine Anschauung mit
derjenigen dieses Vorgängers zu verschmelzen' sucht, und auf die kurze Mono-
graphie über die Ästhetik Albrecht Dürers einzugehen, die der gelehrte Kunst-
philosoph als Anhang zu seinem Buche hinzufügt. Nur einer sachlichen Auffassung
möchte ich noch erwähnen, welche nirgends als auf dem Titel der Arbeit und auch
hier bloß andeutungsweise zum Vorschein kommt. »Warum«, wird mancher fragen,
»will der Verfasser ausschließlich die Prinzipien der Kritik neuer Kunstschöpfungen
feststellen, da doch das Geschmacksurteil alten Kunstwerken gegenüber sich grund-
sätzlich nicht anders verhält und also auch im Hinblick auf diese Werke die Mög-
lichkeit einer allgemein gültigen Kritik bezweifelt werden könnte?« Nun, die Ant-
wort liegt auf der Hand. Der Gegensatz der Schätzungen betrifft in der Tat vor-
zugsweise die Produkte aus jüngster Zeit, die noch keine autoritative, durch die
Übereinstimmung der Kunstkenner vieler Generationen dem Streit entzogene Wür-
digung erfahren haben. Im Sieb der Geschichte wird die Spreu nach der allge-
meinen Ansicht vom Weizen gesondert; ein Werk, das die Probe der Jahrhunderte
bestanden hat, auf Grund des eigenen Gefühls zum wertlosen Plunder zu werfen,
erfordert einen Mut und eine Überzeugungsstärke, die nicht jedermanns Sache sind,
und zudem veranlaßt der Ruhm des Werkes nicht nur selbst den Kecksten, Leicht-
fertigsten, mit etwas mehr Ernst und Gewissenhaftigkeit nach Vorzügen zu suchen,
als er bei modernen Schöpfungen sich die Mühe nehmen würde, sondern die Vor-
stellung desselben Ruhmes umgibt auch, wie schon Ästhetiker des 18. Jahrhunderts
richtig erkannt haben, das Kunstgebilde mit einem Nimbus, dessen Wirkung geradezu
einer Assoziationsschönheit gleichkommt. Zöge man diesen Assoziationsfaktor ab,
so würde man bei vollem Einblick in das Innere der Menschen sicherlich finden,
daß die wahren, ehrlichen, unausgesprochenen Urteile über hochberühmte Gemälde
und Poesieerzeugnisse ebensoweit auseinandergehen wie diejenigen über irgend ein
Bild der Sezession: der Unterschied liegt nur darin, daß man im ersteren Falle
sich selber nicht traut und davor zurückschreckt, sich das eigene Fühlen einzuge-
stehen. — Was aber Alts allgemeine Gesichtspunkte betrifft, so dürfte die voran-
stehende meritorische Kritik gezeigt haben, daß sich der Verfasser großenteils auf
dem richtigen Wege befindet, von dem er freilich, durch objektivistische Vorurteile
geblendet, dann und wann abirrt, und vor allem, daß uns aus seiner Arbeit eine
Fülle der wertvollsten Anregungen zuströmt, die man bloß zu verfolgen braucht,
um weite und fesselnde Ausblicke auf alle möglichen Gebiete ästhetischer Theorie
zu gewinnen.
Graz. ________ Hugo Spitzer.
Animatus, Die Entthronung der antiken Kunst. Ein Schnitt in den kunst-
historischen Zopf. Berlin 1911. Im Verlag von Oesterheld und Co. 96 S.
Alle Kunst ist Darstellung des Wesenhaften. Da dieses Wesenhafte nur inner-
halb einer intelligiblen Welt gedacht, niemals als Wirklichkeit (und demgemäß auch
nicht in einer ihre Bedingungen annehmenden Wirklichkeitsnachbildung) geschaut
werden kann, so ist Kunst letzten Endes eine Unmöglichkeit, eine Utopie, die Qua-
dratur des Zirkels. Sie will das Allgemeine, Typische, Symbolhafte und ist, um es
schaubar zu machen, an das Besondere, das Lebendige, das Zufällige gebunden.
Woraus sich ergibt, daß auf einer Seite immer ein Rest bleibt; daß auch die größten
Kunstwerke nur Annäherungen sind, da das Wesen niemals im Sein aufgehen, das
Sein naturnotwendig nie das Wesen voll umfassen kann. Bei der also unstillbaren