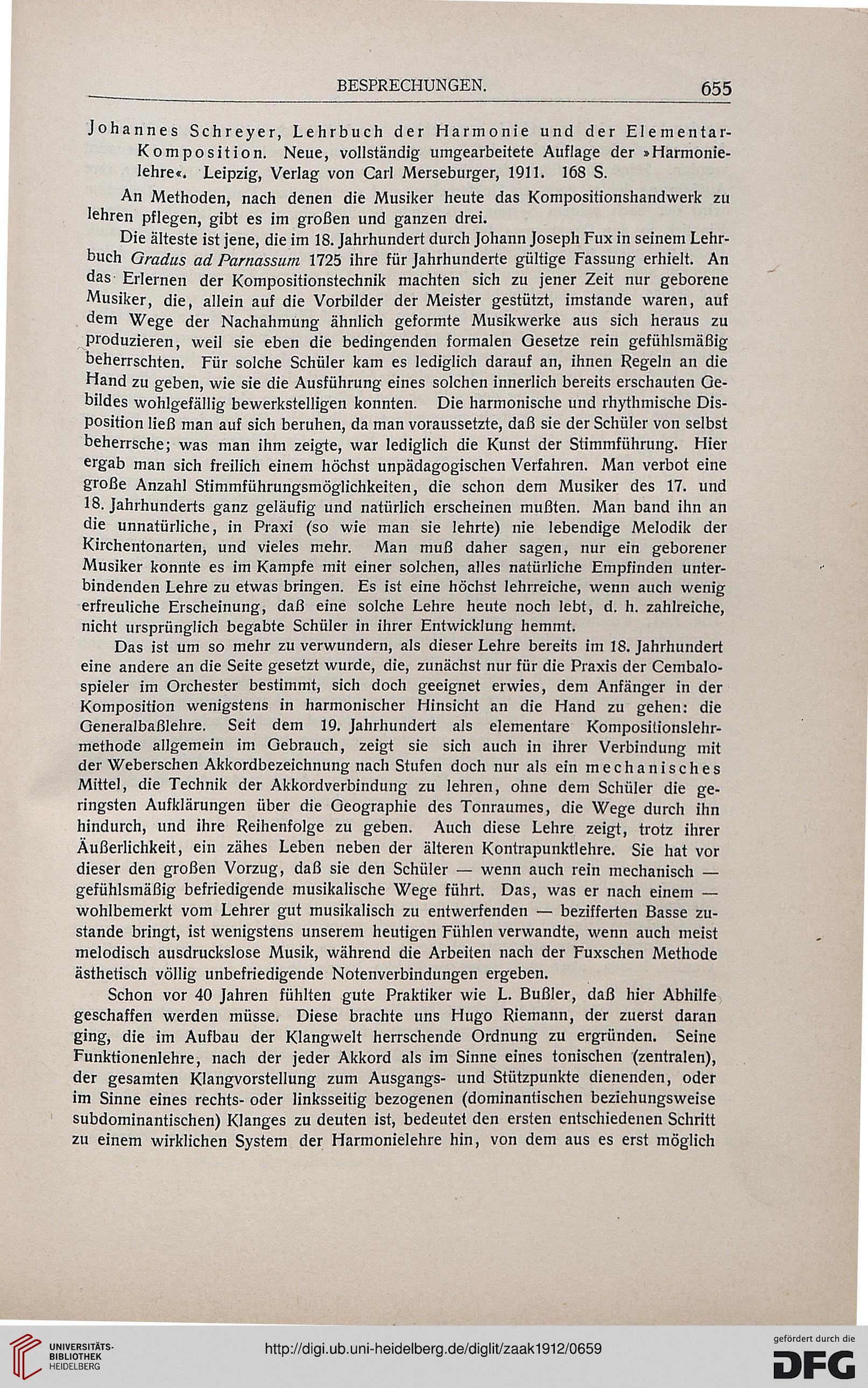BESPRECHUNGEN. 655
Johannes Schreyer, Lehrbuch der Harmonie und der Elementar-
Komposition. Neue, vollständig umgearbeitete Auflage der »Harmonie-
lehre«. Leipzig, Verlag von Carl Merseburger, 1911. 168 S.
An Methoden, nach denen die Musiker heute das Kompositionshandwerk zu
lehren pflegen, gibt es im großen und ganzen drei.
Die älteste ist jene, die im 18. Jahrhundert durch Johann Joseph Fux in seinem Lehr-
buch Qradus ad Parnassum 1725 ihre für Jahrhunderte gültige Fassung erhielt. An
das Erlernen der Kompositionstechnik machten sich zu jener Zeit nur geborene
Musiker, die, allein auf die Vorbilder der Meister gestützt, imstande waren, auf
dem Wege der Nachahmung ähnlich geformte Musikwerke aus sich heraus zu
produzieren, weil sie eben die bedingenden formalen Gesetze rein gefühlsmäßig
beherrschten. Für solche Schüler kam es lediglich darauf an, ihnen Regeln an die
Hand zu geben, wie sie die Ausführung eines solchen innerlich bereits erschauten Ge-
bildes wohlgefällig bewerkstelligen konnten. Die harmonische und rhythmische Dis-
position ließ man auf sich beruhen, da man voraussetzte, daß sie der Schüler von selbst
beherrsche; was man ihm zeigte, war lediglich die Kunst der Stimmführung. Hier
ergab man sich freilich einem höchst unpädagogischen Verfahren. Man verbot eine
große Anzahl Stimmführungsmöglichkeiten, die schon dem Musiker des 17. und
18. Jahrhunderts ganz geläufig und natürlich erscheinen mußten. Man band ihn an
die unnatürliche, in Praxi (so wie man sie lehrte) nie lebendige Melodik der
Kirchentonarten, und vieles mehr. Man muß daher sagen, nur ein geborener
Musiker konnte es im Kampfe mit einer solchen, alles natürliche Empfinden unter-
bindenden Lehre zu etwas bringen. Es ist eine höchst lehrreiche, wenn auch wenig
erfreuliche Erscheinung, daß eine solche Lehre heute noch lebt, d. h. zahlreiche,
nicht ursprünglich begabte Schüler in ihrer Entwicklung hemmt.
Das ist um so mehr zu verwundern, als dieser Lehre bereits im 18. Jahrhundert
eine andere an die Seite gesetzt wurde, die, zunächst nur für die Praxis der Cembalo-
spieler im Orchester bestimmt, sich doch geeignet erwies, dem Anfänger in der
Komposition wenigstens in harmonischer Hinsicht an die Hand zu gehen: die
Generalbaßlehre. Seit dem 19. Jahrhundert als elementare Kompositionslehr-
methode allgemein im Gebrauch, zeigt sie sich auch in ihrer Verbindung mit
der Weberschen Akkordbezeichnung nach Stufen doch nur als ein mechanisches
Mittel, die Technik der Akkordverbindung zu lehren, ohne dem Schüler die ge-
ringsten Aufklärungen über die Geographie des Tonraumes, die Wege durch ihn
hindurch, und ihre Reihenfolge zu geben. Auch diese Lehre zeigt, trotz ihrer
Äußerlichkeit, ein zähes Leben neben der älteren Kontrapunktlehre. Sie hat vor
dieser den großen Vorzug, daß sie den Schüler — wenn auch rein mechanisch —
gefühlsmäßig befriedigende musikalische Wege führt. Das, was er nach einem —
wohlbemerkt vom Lehrer gut musikalisch zu entwerfenden — bezifferten Basse zu-
stande bringt, ist wenigstens unserem heutigen Fühlen verwandte, wenn auch meist
melodisch ausdruckslose Musik, während die Arbeiten nach der Fuxschen Methode
ästhetisch völlig unbefriedigende Notenverbindungen ergeben.
Schon vor 40 Jahren fühlten gute Praktiker wie L. Bußler, daß hier Abhilfe,
geschaffen werden müsse. Diese brachte uns Hugo Riemann, der zuerst daran
ging, die im Aufbau der Klangwelt herrschende Ordnung zu ergründen. Seine
Funktionenlehre, nach der jeder Akkord als im Sinne eines tonischen (zentralen),
der gesamten Klangvorstellung zum Ausgangs- und Stützpunkte dienenden, oder
im Sinne eines rechts- oder linksseitig bezogenen (dominantischen beziehungsweise
subdominantischen) Klanges zu deuten ist, bedeutet den ersten entschiedenen Schritt
zu einem wirklichen System der Harmonielehre hin, von dem aus es erst möglich