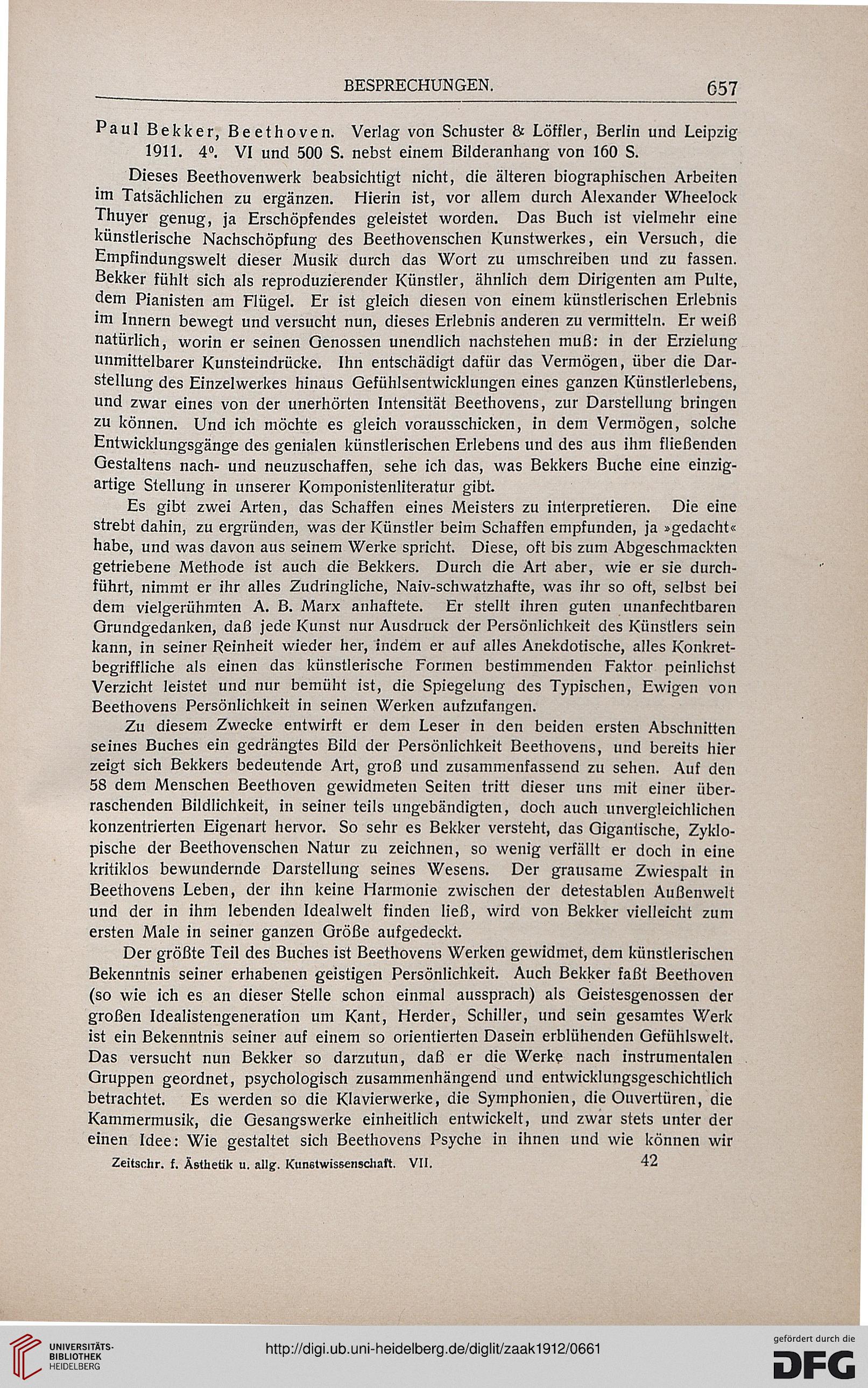BESPRECHUNGEN. 657
Paul Bekker, Beethoven. Verlag von Schuster & Löffler, Berlin und Leipzig
1911. 4°. VI und 500 S. nebst einem Bilderanhang von 160 S.
Dieses Beethovenwerk beabsichtigt nicht, die älteren biographischen Arbeiten
im Tatsächlichen zu ergänzen. Hierin ist, vor allem durch Alexander Wheelock
Thuyer genug, ja Erschöpfendes geleistet worden. Das Buch ist vielmehr eine
künstlerische Nachschöpfung des Beethovenschen Kunstwerkes, ein Versuch, die
Empfindungswelt dieser Musik durch das Wort zu umschreiben und zu fassen.
Bekker fühlt sich als reproduzierender Künstler, ähnlich dem Dirigenten am Pulte,
dem Pianisten am Flügel. Er ist gleich diesen von einem künstlerischen Erlebnis
im Innern bewegt und versucht nun, dieses Erlebnis anderen zu vermitteln. Er weiß
natürlich, worin er seinen Genossen unendlich nachstehen muß: in der Erzielung
unmittelbarer Kunsteindrücke. Ihn entschädigt dafür das Vermögen, über die Dar-
stellung des Einzelwerkes hinaus Gefühlsentwicklungen eines ganzen Künstlerlebens,
und zwar eines von der unerhörten Intensität Beethovens, zur Darstellung bringen
zu können. Und ich möchte es gleich vorausschicken, in dem Vermögen, solche
Entwicklungsgänge des genialen künstlerischen Erlebens und des aus ihm fließenden
Gestaltens nach- und neuzuschaffen, sehe ich das, was Bekkers Buche eine einzig-
artige Stellung in unserer Komponistenliteratur gibt.
Es gibt zwei Arten, das Schaffen eines Meisters zu interpretieren. Die eine
strebt dahin, zu ergründen, was der Künstler beim Schaffen empfunden, ja »gedacht«
habe, und was davon aus seinem Werke spricht. Diese, oft bis zum Abgeschmackten
getriebene Methode ist auch die Bekkers. Durch die Art aber, wie er sie durch-
führt, nimmt er ihr alles Zudringliche, Naiv-schwatzhafte, was ihr so oft, selbst bei
dem vielgerühmten A. B. Marx anhaftete. Er stellt ihren guten unanfechtbaren
Grundgedanken, daß jede Kunst nur Ausdruck der Persönlichkeit des Künstlers sein
kann, in seiner Reinheit wieder her, indem er auf alles Anekdotische, alles Konkret-
begriffliche als einen das künstlerische Formen bestimmenden Faktor peinlichst
Verzicht leistet und nur bemüht ist, die Spiegelung des Typischen, Ewigen von
Beethovens Persönlichkeit in seinen Werken aufzufangen.
Zu diesem Zwecke entwirft er dem Leser in den beiden ersten Abschnitten
seines Buches ein gedrängtes Bild der Persönlichkeit Beethovens, und bereits hier
zeigt sich Bekkers bedeutende Art, groß und zusammenfassend zu sehen. Auf den
58 dem Menschen Beethoven gewidmeten Seiten tritt dieser uns mit einer über-
raschenden Bildlichkeit, in seiner teils ungebändigten, doch auch unvergleichlichen
konzentrierten Eigenart hervor. So sehr es Bekker versteht, das Gigantische, Zyklo-
pische der Beethovenschen Natur zu zeichnen, so wenig verfällt er doch in eine
kritiklos bewundernde Darstellung seines Wesens. Der grausame Zwiespalt in
Beethovens Leben, der ihn keine Harmonie zwischen der detestablen Außenwelt
und der in ihm lebenden Idealwelt finden ließ, wird von Bekker vielleicht zum
ersten Male in seiner ganzen Größe aufgedeckt.
Der größte Teil des Buches ist Beethovens Werken gewidmet, dem künstlerischen
Bekenntnis seiner erhabenen geistigen Persönlichkeit. Auch Bekker faßt Beethoven
(so wie ich es an dieser Stelle schon einmal aussprach) als Geistesgenossen der
großen Idealistengeneration um Kant, Herder, Schiller, und sein gesamtes Werk
ist ein Bekenntnis seiner auf einem so orientierten Dasein erblühenden Gefühlswelt.
Das versucht nun Bekker so darzutun, daß er die Werke nach instrumentalen
Gruppen geordnet, psychologisch zusammenhängend und entwicklungsgeschichtlich
betrachtet. Es werden so die Klavierwerke, die Symphonien, die Ouvertüren, die
Kammermusik, die Gesangswerke einheitlich entwickelt, und zwar stets unter der
einen Idee: Wie gestaltet sich Beethovens Psyche in ihnen und wie können wir
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. VII. 42
Paul Bekker, Beethoven. Verlag von Schuster & Löffler, Berlin und Leipzig
1911. 4°. VI und 500 S. nebst einem Bilderanhang von 160 S.
Dieses Beethovenwerk beabsichtigt nicht, die älteren biographischen Arbeiten
im Tatsächlichen zu ergänzen. Hierin ist, vor allem durch Alexander Wheelock
Thuyer genug, ja Erschöpfendes geleistet worden. Das Buch ist vielmehr eine
künstlerische Nachschöpfung des Beethovenschen Kunstwerkes, ein Versuch, die
Empfindungswelt dieser Musik durch das Wort zu umschreiben und zu fassen.
Bekker fühlt sich als reproduzierender Künstler, ähnlich dem Dirigenten am Pulte,
dem Pianisten am Flügel. Er ist gleich diesen von einem künstlerischen Erlebnis
im Innern bewegt und versucht nun, dieses Erlebnis anderen zu vermitteln. Er weiß
natürlich, worin er seinen Genossen unendlich nachstehen muß: in der Erzielung
unmittelbarer Kunsteindrücke. Ihn entschädigt dafür das Vermögen, über die Dar-
stellung des Einzelwerkes hinaus Gefühlsentwicklungen eines ganzen Künstlerlebens,
und zwar eines von der unerhörten Intensität Beethovens, zur Darstellung bringen
zu können. Und ich möchte es gleich vorausschicken, in dem Vermögen, solche
Entwicklungsgänge des genialen künstlerischen Erlebens und des aus ihm fließenden
Gestaltens nach- und neuzuschaffen, sehe ich das, was Bekkers Buche eine einzig-
artige Stellung in unserer Komponistenliteratur gibt.
Es gibt zwei Arten, das Schaffen eines Meisters zu interpretieren. Die eine
strebt dahin, zu ergründen, was der Künstler beim Schaffen empfunden, ja »gedacht«
habe, und was davon aus seinem Werke spricht. Diese, oft bis zum Abgeschmackten
getriebene Methode ist auch die Bekkers. Durch die Art aber, wie er sie durch-
führt, nimmt er ihr alles Zudringliche, Naiv-schwatzhafte, was ihr so oft, selbst bei
dem vielgerühmten A. B. Marx anhaftete. Er stellt ihren guten unanfechtbaren
Grundgedanken, daß jede Kunst nur Ausdruck der Persönlichkeit des Künstlers sein
kann, in seiner Reinheit wieder her, indem er auf alles Anekdotische, alles Konkret-
begriffliche als einen das künstlerische Formen bestimmenden Faktor peinlichst
Verzicht leistet und nur bemüht ist, die Spiegelung des Typischen, Ewigen von
Beethovens Persönlichkeit in seinen Werken aufzufangen.
Zu diesem Zwecke entwirft er dem Leser in den beiden ersten Abschnitten
seines Buches ein gedrängtes Bild der Persönlichkeit Beethovens, und bereits hier
zeigt sich Bekkers bedeutende Art, groß und zusammenfassend zu sehen. Auf den
58 dem Menschen Beethoven gewidmeten Seiten tritt dieser uns mit einer über-
raschenden Bildlichkeit, in seiner teils ungebändigten, doch auch unvergleichlichen
konzentrierten Eigenart hervor. So sehr es Bekker versteht, das Gigantische, Zyklo-
pische der Beethovenschen Natur zu zeichnen, so wenig verfällt er doch in eine
kritiklos bewundernde Darstellung seines Wesens. Der grausame Zwiespalt in
Beethovens Leben, der ihn keine Harmonie zwischen der detestablen Außenwelt
und der in ihm lebenden Idealwelt finden ließ, wird von Bekker vielleicht zum
ersten Male in seiner ganzen Größe aufgedeckt.
Der größte Teil des Buches ist Beethovens Werken gewidmet, dem künstlerischen
Bekenntnis seiner erhabenen geistigen Persönlichkeit. Auch Bekker faßt Beethoven
(so wie ich es an dieser Stelle schon einmal aussprach) als Geistesgenossen der
großen Idealistengeneration um Kant, Herder, Schiller, und sein gesamtes Werk
ist ein Bekenntnis seiner auf einem so orientierten Dasein erblühenden Gefühlswelt.
Das versucht nun Bekker so darzutun, daß er die Werke nach instrumentalen
Gruppen geordnet, psychologisch zusammenhängend und entwicklungsgeschichtlich
betrachtet. Es werden so die Klavierwerke, die Symphonien, die Ouvertüren, die
Kammermusik, die Gesangswerke einheitlich entwickelt, und zwar stets unter der
einen Idee: Wie gestaltet sich Beethovens Psyche in ihnen und wie können wir
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. VII. 42