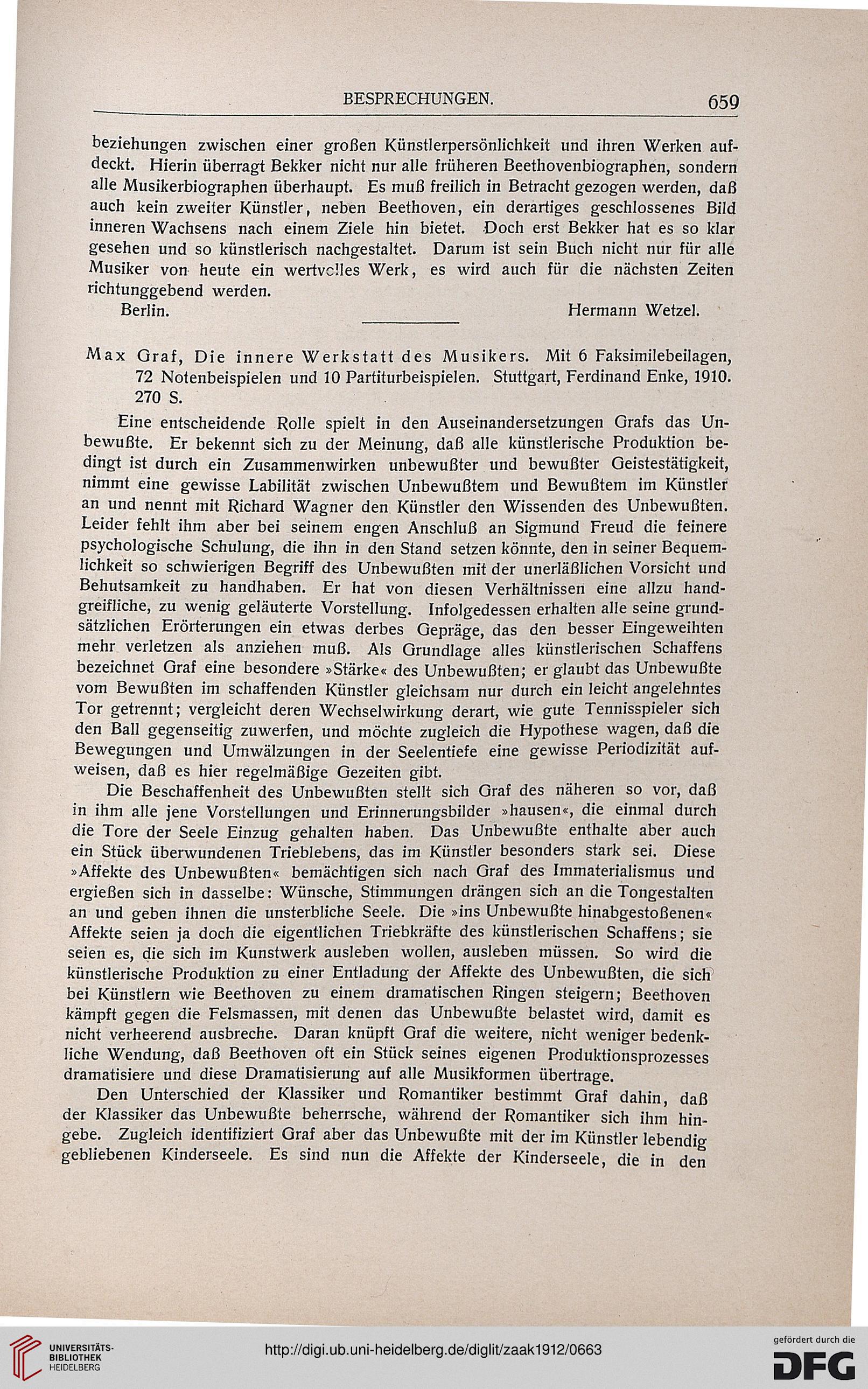BESPRECHUNGEN. 659
beziehungen zwischen einer großen Künstlerpersönlichkeit und ihren Werken auf-
deckt. Hierin überragt Bekker nicht nur alle früheren Beethovenbiographen, sondern
alle Musikerbiographen überhaupt. Es muß freilich in Betracht gezogen werden, daß
auch kein zweiter Künstler, neben Beethoven, ein derartiges geschlossenes Bild
inneren Wachsens nach einem Ziele hin bietet. Doch erst Bekker hat es so klar
gesehen und so künstlerisch nachgestaltet. Darum ist sein Buch nicht nur für alle
Musiker von heute ein wertvclles Werk, es wird auch für die nächsten Zeiten
richtunggebend werden.
Berlin. Hermann Wetzel.
Max Graf, Die innere Werkstatt des Musikers. Mit 6 Faksimilebeilagen,
72 Notenbeispielen und 10 Partiturbeispielen. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1910.
270 S.
Eine entscheidende Rolle spielt in den Auseinandersetzungen Grafs das Un-
bewußte. Er bekennt sich zu der Meinung, daß alle künstlerische Produktion be-
dingt ist durch ein Zusammenwirken unbewußter und bewußter Geistestätigkeit,
nimmt eine gewisse Labilität zwischen Unbewußtem und Bewußtem im Künstler
an und nennt mit Richard Wagner den Künstler den Wissenden des Unbewußten.
Leider fehlt ihm aber bei seinem engen Anschluß an Sigmund Freud die feinere
psychologische Schulung, die ihn in den Stand setzen könnte, den in seiner Bequem-
lichkeit so schwierigen Begriff des Unbewußten mit der unerläßlichen Vorsicht und
Behutsamkeit zu handhaben. Er hat von diesen Verhältnissen eine allzu hand-
greifliche, zu wenig geläuterte Vorstellung. Infolgedessen erhalten alle seine grund-
sätzlichen Erörterungen ein etwas derbes Gepräge, das den besser Eingeweihten
mehr verletzen als anziehen muß. Als Grundlage alles künstlerischen Schaffens
bezeichnet Graf eine besondere »Stärke« des Unbewußten; er glaubt das Unbewußte
vom Bewußten im schaffenden Künstler gleichsam nur durch ein leicht angelehntes
Tor getrennt; vergleicht deren Wechselwirkung derart, wie gute Tennisspieler sich
den Ball gegenseitig zuwerfen, und möchte zugleich die Hypothese wagen, daß die
Bewegungen und Umwälzungen in der Seelentiefe eine gewisse Periodizität auf-
weisen, daß es hier regelmäßige Gezeiten gibt.
Die Beschaffenheit des Unbewußten stellt sich Graf des näheren so vor, daß
in ihm alle jene Vorstellungen und Erinnerungsbilder »hausen«, die einmal durch
die Tore der Seele Einzug gehalten haben. Das Unbewußte enthalte aber auch
ein Stück überwundenen Trieblebens, das im Künstler besonders stark sei. Diese
»Affekte des Unbewußten« bemächtigen sich nach Graf des Immaterialismus und
ergießen sich in dasselbe: Wünsche, Stimmungen drängen sich an die Tongestalten
an und geben ihnen die unsterbliche Seele. Die »ins Unbewußte hinabgestoßenen«
Affekte seien ja doch die eigentlichen Triebkräfte des künstlerischen Schaffens; sie
seien es, die sich im Kunstwerk ausleben wollen, ausleben müssen. So wird die
künstlerische Produktion zu einer Entladung der Affekte des Unbewußten, die sich"
bei Künstlern wie Beethoven zu einem dramatischen Ringen steigern; Beethoven
kämpft gegen die Felsmassen, mit denen das Unbewußte belastet wird, damit es
nicht verheerend ausbreche. Daran knüpft Graf die weitere, nicht weniger bedenk-
liche Wendung, daß Beethoven oft ein Stück seines eigenen Produktionsprozesses
dramatisiere und diese Dramatisierung auf alle Musikformen übertrage.
Den Unterschied der Klassiker und Romantiker bestimmt Graf dahin, daß
der Klassiker das Unbewußte beherrsche, während der Romantiker sich ihm hin-
gebe. Zugleich identifiziert Graf aber das Unbewußte mit der im Künstler lebendig
gebliebenen Kinderseele. Es sind nun die Affekte der Kinderseele, die in den
beziehungen zwischen einer großen Künstlerpersönlichkeit und ihren Werken auf-
deckt. Hierin überragt Bekker nicht nur alle früheren Beethovenbiographen, sondern
alle Musikerbiographen überhaupt. Es muß freilich in Betracht gezogen werden, daß
auch kein zweiter Künstler, neben Beethoven, ein derartiges geschlossenes Bild
inneren Wachsens nach einem Ziele hin bietet. Doch erst Bekker hat es so klar
gesehen und so künstlerisch nachgestaltet. Darum ist sein Buch nicht nur für alle
Musiker von heute ein wertvclles Werk, es wird auch für die nächsten Zeiten
richtunggebend werden.
Berlin. Hermann Wetzel.
Max Graf, Die innere Werkstatt des Musikers. Mit 6 Faksimilebeilagen,
72 Notenbeispielen und 10 Partiturbeispielen. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1910.
270 S.
Eine entscheidende Rolle spielt in den Auseinandersetzungen Grafs das Un-
bewußte. Er bekennt sich zu der Meinung, daß alle künstlerische Produktion be-
dingt ist durch ein Zusammenwirken unbewußter und bewußter Geistestätigkeit,
nimmt eine gewisse Labilität zwischen Unbewußtem und Bewußtem im Künstler
an und nennt mit Richard Wagner den Künstler den Wissenden des Unbewußten.
Leider fehlt ihm aber bei seinem engen Anschluß an Sigmund Freud die feinere
psychologische Schulung, die ihn in den Stand setzen könnte, den in seiner Bequem-
lichkeit so schwierigen Begriff des Unbewußten mit der unerläßlichen Vorsicht und
Behutsamkeit zu handhaben. Er hat von diesen Verhältnissen eine allzu hand-
greifliche, zu wenig geläuterte Vorstellung. Infolgedessen erhalten alle seine grund-
sätzlichen Erörterungen ein etwas derbes Gepräge, das den besser Eingeweihten
mehr verletzen als anziehen muß. Als Grundlage alles künstlerischen Schaffens
bezeichnet Graf eine besondere »Stärke« des Unbewußten; er glaubt das Unbewußte
vom Bewußten im schaffenden Künstler gleichsam nur durch ein leicht angelehntes
Tor getrennt; vergleicht deren Wechselwirkung derart, wie gute Tennisspieler sich
den Ball gegenseitig zuwerfen, und möchte zugleich die Hypothese wagen, daß die
Bewegungen und Umwälzungen in der Seelentiefe eine gewisse Periodizität auf-
weisen, daß es hier regelmäßige Gezeiten gibt.
Die Beschaffenheit des Unbewußten stellt sich Graf des näheren so vor, daß
in ihm alle jene Vorstellungen und Erinnerungsbilder »hausen«, die einmal durch
die Tore der Seele Einzug gehalten haben. Das Unbewußte enthalte aber auch
ein Stück überwundenen Trieblebens, das im Künstler besonders stark sei. Diese
»Affekte des Unbewußten« bemächtigen sich nach Graf des Immaterialismus und
ergießen sich in dasselbe: Wünsche, Stimmungen drängen sich an die Tongestalten
an und geben ihnen die unsterbliche Seele. Die »ins Unbewußte hinabgestoßenen«
Affekte seien ja doch die eigentlichen Triebkräfte des künstlerischen Schaffens; sie
seien es, die sich im Kunstwerk ausleben wollen, ausleben müssen. So wird die
künstlerische Produktion zu einer Entladung der Affekte des Unbewußten, die sich"
bei Künstlern wie Beethoven zu einem dramatischen Ringen steigern; Beethoven
kämpft gegen die Felsmassen, mit denen das Unbewußte belastet wird, damit es
nicht verheerend ausbreche. Daran knüpft Graf die weitere, nicht weniger bedenk-
liche Wendung, daß Beethoven oft ein Stück seines eigenen Produktionsprozesses
dramatisiere und diese Dramatisierung auf alle Musikformen übertrage.
Den Unterschied der Klassiker und Romantiker bestimmt Graf dahin, daß
der Klassiker das Unbewußte beherrsche, während der Romantiker sich ihm hin-
gebe. Zugleich identifiziert Graf aber das Unbewußte mit der im Künstler lebendig
gebliebenen Kinderseele. Es sind nun die Affekte der Kinderseele, die in den