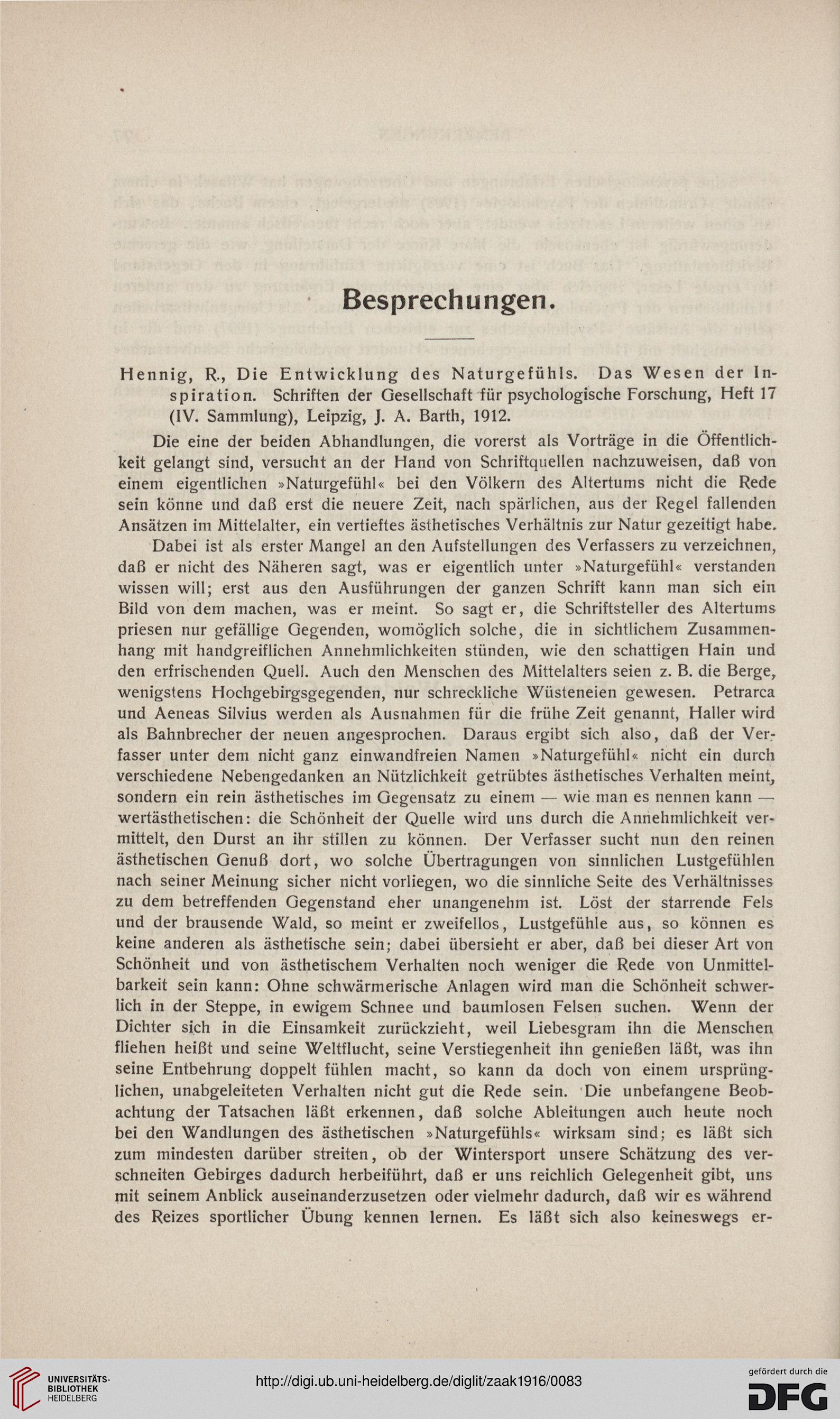Besprechungen.
Hennig, R., Die Entwicklung des Naturgefühls. Das Wesen der In-
spiration. Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung, Heft 17
(IV. Sammlung), Leipzig, J. A. Barth, 1912.
Die eine der beiden Abhandlungen, die vorerst als Vorträge in die Öffentlich-
keit gelangt sind, versucht an der Hand von Schriftquellen nachzuweisen, daß von
einem eigentlichen »Naturgefühl« bei den Völkern des Altertums nicht die Rede
sein könne und daß erst die neuere Zeit, nach spärlichen, aus der Regel fallenden
Ansätzen im Mittelalter, ein vertieftes ästhetisches Verhältnis zur Natur gezeitigt habe.
Dabei ist als erster Mangel an den Aufstellungen des Verfassers zu verzeichnen,
daß er nicht des Näheren sagt, was er eigentlich unter »Naturgefühl« verstanden
wissen will; erst aus den Ausführungen der ganzen Schrift kann man sich ein
Bild von dem machen, was er meint. So sagt er, die Schriftsteller des Altertums
priesen nur gefällige Gegenden, womöglich solche, die in sichtlichem Zusammen-
hang mit handgreiflichen Annehmlichkeiten stünden, wie den schattigen Hain und
den erfrischenden Quell. Auch den Menschen des Mittelalters seien z. B. die Berge,
wenigstens Hochgebirgsgegenden, nur schreckliche Wüsteneien gewesen. Petrarca
und Aeneas Silvius werden als Ausnahmen für die frühe Zeit genannt, Haller wird
als Bahnbrecher der neuen angesprochen. Daraus ergibt sich also, daß der Ver-
fasser unter dem nicht ganz einwandfreien Namen »Naturgefühl« nicht ein durch
verschiedene Nebengedanken an Nützlichkeit getrübtes ästhetisches Verhalten meint,
sondern ein rein ästhetisches im Gegensatz zu einem — wie man es nennen kann —
wertästhetischen: die Schönheit der Quelle wird uns durch die Annehmlichkeit ver-
mittelt, den Durst an ihr stillen zu können. Der Verfasser sucht nun den reinen
ästhetischen Genuß dort, wo solche Übertragungen von sinnlichen Lustgefühlen
nach seiner Meinung sicher nicht vorliegen, wo die sinnliche Seite des Verhältnisses
zu dem betreffenden Gegenstand eher unangenehm ist. Löst der starrende Fels
und der brausende Wald, so meint er zweifellos, Lustgefühle aus, so können es
keine anderen als ästhetische sein; dabei übersieht er aber, daß bei dieser Art von
Schönheit und von ästhetischem Verhalten noch weniger die Rede von Unmittel-
barkeit sein kann: Ohne schwärmerische Anlagen wird man die Schönheit schwer-
lich in der Steppe, in ewigem Schnee und baumlosen Felsen suchen. Wenn der
Dichter sich in die Einsamkeit zurückzieht, weil Liebesgram ihn die Menschen
fliehen heißt und seine Weltflucht, seine Verstiegenheit ihn genießen läßt, was ihn
seine Entbehrung doppelt fühlen macht, so kann da doch von einem ursprüng-
lichen, unabgeleiteten Verhalten nicht gut die Rede sein. Die unbefangene Beob-
achtung der Tatsachen läßt erkennen, daß solche Ableitungen auch heute noch
bei den Wandlungen des ästhetischen »Naturgefühls« wirksam sind; es läßt sich
zum mindesten darüber streiten, ob der Wintersport unsere Schätzung des ver-
schneiten Gebirges dadurch herbeiführt, daß er uns reichlich Gelegenheit gibt, uns
mit seinem Anblick auseinanderzusetzen oder vielmehr dadurch, daß wir es während
des Reizes sportlicher Übung kennen lernen. Es läßt sich also keineswegs er-
Hennig, R., Die Entwicklung des Naturgefühls. Das Wesen der In-
spiration. Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung, Heft 17
(IV. Sammlung), Leipzig, J. A. Barth, 1912.
Die eine der beiden Abhandlungen, die vorerst als Vorträge in die Öffentlich-
keit gelangt sind, versucht an der Hand von Schriftquellen nachzuweisen, daß von
einem eigentlichen »Naturgefühl« bei den Völkern des Altertums nicht die Rede
sein könne und daß erst die neuere Zeit, nach spärlichen, aus der Regel fallenden
Ansätzen im Mittelalter, ein vertieftes ästhetisches Verhältnis zur Natur gezeitigt habe.
Dabei ist als erster Mangel an den Aufstellungen des Verfassers zu verzeichnen,
daß er nicht des Näheren sagt, was er eigentlich unter »Naturgefühl« verstanden
wissen will; erst aus den Ausführungen der ganzen Schrift kann man sich ein
Bild von dem machen, was er meint. So sagt er, die Schriftsteller des Altertums
priesen nur gefällige Gegenden, womöglich solche, die in sichtlichem Zusammen-
hang mit handgreiflichen Annehmlichkeiten stünden, wie den schattigen Hain und
den erfrischenden Quell. Auch den Menschen des Mittelalters seien z. B. die Berge,
wenigstens Hochgebirgsgegenden, nur schreckliche Wüsteneien gewesen. Petrarca
und Aeneas Silvius werden als Ausnahmen für die frühe Zeit genannt, Haller wird
als Bahnbrecher der neuen angesprochen. Daraus ergibt sich also, daß der Ver-
fasser unter dem nicht ganz einwandfreien Namen »Naturgefühl« nicht ein durch
verschiedene Nebengedanken an Nützlichkeit getrübtes ästhetisches Verhalten meint,
sondern ein rein ästhetisches im Gegensatz zu einem — wie man es nennen kann —
wertästhetischen: die Schönheit der Quelle wird uns durch die Annehmlichkeit ver-
mittelt, den Durst an ihr stillen zu können. Der Verfasser sucht nun den reinen
ästhetischen Genuß dort, wo solche Übertragungen von sinnlichen Lustgefühlen
nach seiner Meinung sicher nicht vorliegen, wo die sinnliche Seite des Verhältnisses
zu dem betreffenden Gegenstand eher unangenehm ist. Löst der starrende Fels
und der brausende Wald, so meint er zweifellos, Lustgefühle aus, so können es
keine anderen als ästhetische sein; dabei übersieht er aber, daß bei dieser Art von
Schönheit und von ästhetischem Verhalten noch weniger die Rede von Unmittel-
barkeit sein kann: Ohne schwärmerische Anlagen wird man die Schönheit schwer-
lich in der Steppe, in ewigem Schnee und baumlosen Felsen suchen. Wenn der
Dichter sich in die Einsamkeit zurückzieht, weil Liebesgram ihn die Menschen
fliehen heißt und seine Weltflucht, seine Verstiegenheit ihn genießen läßt, was ihn
seine Entbehrung doppelt fühlen macht, so kann da doch von einem ursprüng-
lichen, unabgeleiteten Verhalten nicht gut die Rede sein. Die unbefangene Beob-
achtung der Tatsachen läßt erkennen, daß solche Ableitungen auch heute noch
bei den Wandlungen des ästhetischen »Naturgefühls« wirksam sind; es läßt sich
zum mindesten darüber streiten, ob der Wintersport unsere Schätzung des ver-
schneiten Gebirges dadurch herbeiführt, daß er uns reichlich Gelegenheit gibt, uns
mit seinem Anblick auseinanderzusetzen oder vielmehr dadurch, daß wir es während
des Reizes sportlicher Übung kennen lernen. Es läßt sich also keineswegs er-