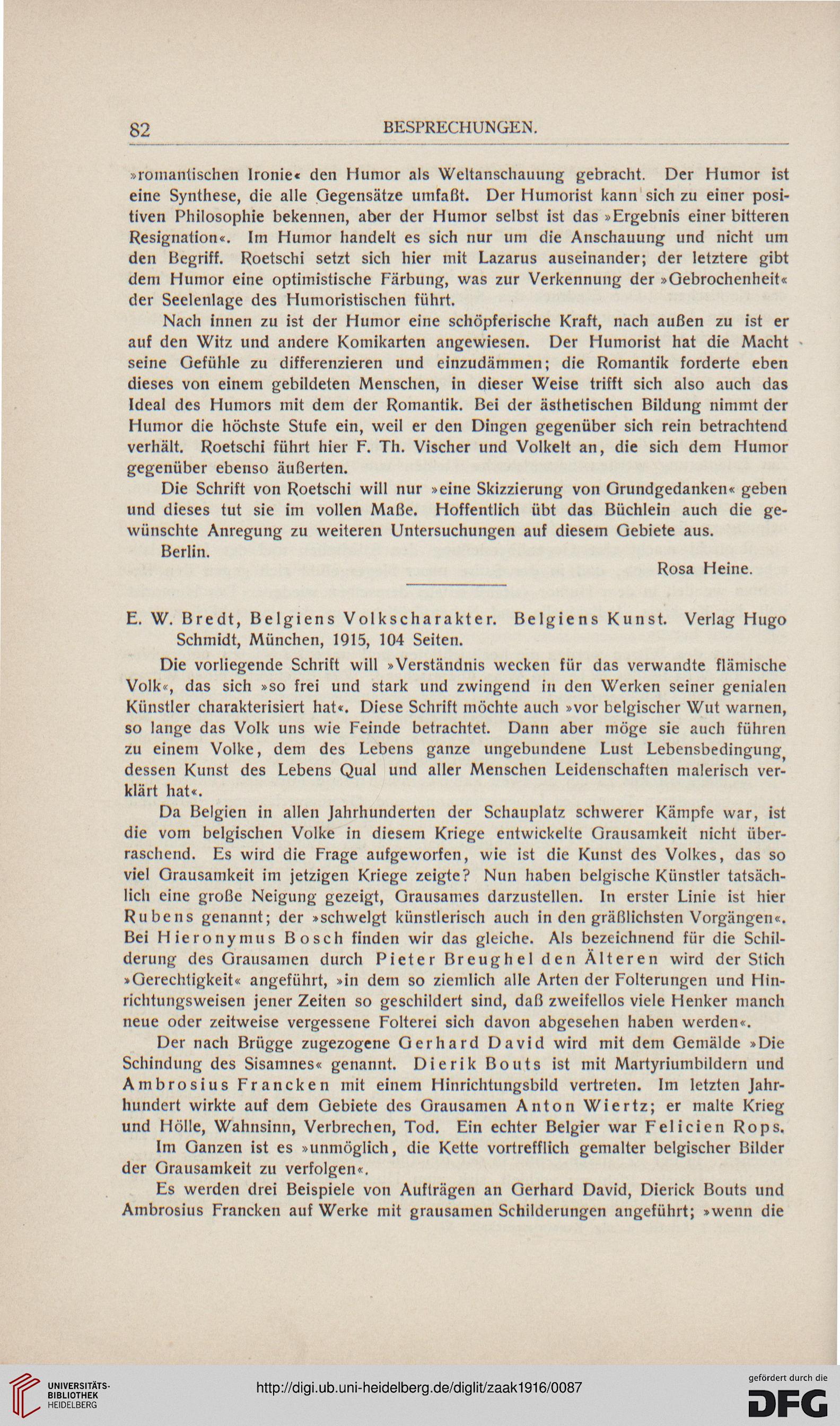82 BESPRECHUNGEN.
»romantischen Ironie« den Humor als Weltanschauung gebracht. Der Humor ist
eine Synthese, die alle Gegensätze umfaßt. Der Humorist kann sich zu einer posi-
tiven Philosophie bekennen, aber der Humor selbst ist das »Ergebnis einerbitteren
Resignation«. Im Humor handelt es sich nur um die Anschauung und nicht um
den Begriff. Roetschi setzt sich hier mit Lazarus auseinander; der letztere gibt
dem Humor eine optimistische Färbung, was zur Verkennung der »Gebrochenheit«
der Seelenlage des Humoristischen führt.
Nach innen zu ist der Humor eine schöpferische Kraft, nach außen zu ist er
auf den Witz und andere Komikarten angewiesen. Der Humorist hat die Macht
seine Gefühle zu differenzieren und einzudämmen; die Romantik forderte eben
dieses von einem gebildeten Menschen, in dieser Weise trifft sich also auch das
Ideal des Humors mit dem der Romantik. Bei der ästhetischen Bildung nimmt der
Humor die höchste Stufe ein, weil er den Dingen gegenüber sich rein betrachtend
verhält. Roetschi führt hier F. Th. Vischer und Volkelt an, die sich dem Humor
gegenüber ebenso äußerten.
Die Schrift von Roetschi will nur »eine Skizzierung von Grundgedanken« geben
und dieses tut sie im vollen Maße. Hoffentlich übt das Büchlein auch die ge-
wünschte Anregung zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete aus.
Berlin.
Rosa Heine.
E. W. Bredt, Belgiens Volkscharakter. Belgiens Kunst. Verlag Hugo
Schmidt, München, 1915, 104 Seiten.
Die vorliegende Schrift will »Verständnis wecken für das verwandte flämische
Volk«, das sich »so frei und stark und zwingend in den Werken seiner genialen
Künstler charakterisiert hat«. Diese Schrift möchte auch »vor belgischer Wut warnen,
so lange das Volk uns wie Feinde betrachtet. Dann aber möge sie auch führen
zu einem Volke, dem des Lebens ganze ungebundene Lust Lebensbedingung
dessen Kunst des Lebens Qual und aller Menschen Leidenschaften malerisch ver-
klärt hat«.
Da Belgien in allen Jahrhunderten der Schauplatz schwerer Kämpfe war, ist
die vom belgischen Volke in diesem Kriege entwickelte Grausamkeit nicht über-
raschend. Es wird die Frage aufgeworfen, wie ist die Kunst des Volkes, das so
viel Grausamkeit im jetzigen Kriege zeigte? Nun haben belgische Künstler tatsäch-
lich eine große Neigung gezeigt, Grausames darzustellen. In erster Linie ist hier
Rubens genannt; der »schwelgt künstlerisch auch in den gräßlichsten Vorgängen«.
Bei Hieronymus Bosch finden wir das gleiche. Als bezeichnend für die Schil-
derung des Grausamen durch Pieter Breughel den Älteren wird der Stich
»Gerechtigkeit« angeführt, »in dem so ziemlich alle Arten der Folterungen und Hin-
richtungsweisen jener Zeiten so geschildert sind, daß zweifellos viele Henker manch
neue oder zeitweise vergessene Folterei sich davon abgesehen haben werden«.
Der nach Brügge zugezogene Gerhard David wird mit dem Gemälde »Die
Schindung des Sisamnes« genannt. Dierik Bouts ist mit Martyriumbildern und
Ambrosius Francken tritt einem Hinrichtungsbild vertreten. Im letzten Jahr-
hundert wirkte auf dem Gebiete des Grausamen Anton Wiertz; er malte Krieg
und Hölle, Wahnsinn, Verbrechen, Tod. Ein echter Belgier war Felicien Rops.
Im Ganzen ist es »unmöglich, die Kette vortrefflich gemalter belgischer Bilder
der Grausamkeit zu verfolgen«.
Es werden drei Beispiele von Aufträgen an Gerhard David, Dierick Bouts und
Ambrosius Francken auf Werke mit grausamen Schilderungen angeführt; »wenn die
»romantischen Ironie« den Humor als Weltanschauung gebracht. Der Humor ist
eine Synthese, die alle Gegensätze umfaßt. Der Humorist kann sich zu einer posi-
tiven Philosophie bekennen, aber der Humor selbst ist das »Ergebnis einerbitteren
Resignation«. Im Humor handelt es sich nur um die Anschauung und nicht um
den Begriff. Roetschi setzt sich hier mit Lazarus auseinander; der letztere gibt
dem Humor eine optimistische Färbung, was zur Verkennung der »Gebrochenheit«
der Seelenlage des Humoristischen führt.
Nach innen zu ist der Humor eine schöpferische Kraft, nach außen zu ist er
auf den Witz und andere Komikarten angewiesen. Der Humorist hat die Macht
seine Gefühle zu differenzieren und einzudämmen; die Romantik forderte eben
dieses von einem gebildeten Menschen, in dieser Weise trifft sich also auch das
Ideal des Humors mit dem der Romantik. Bei der ästhetischen Bildung nimmt der
Humor die höchste Stufe ein, weil er den Dingen gegenüber sich rein betrachtend
verhält. Roetschi führt hier F. Th. Vischer und Volkelt an, die sich dem Humor
gegenüber ebenso äußerten.
Die Schrift von Roetschi will nur »eine Skizzierung von Grundgedanken« geben
und dieses tut sie im vollen Maße. Hoffentlich übt das Büchlein auch die ge-
wünschte Anregung zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete aus.
Berlin.
Rosa Heine.
E. W. Bredt, Belgiens Volkscharakter. Belgiens Kunst. Verlag Hugo
Schmidt, München, 1915, 104 Seiten.
Die vorliegende Schrift will »Verständnis wecken für das verwandte flämische
Volk«, das sich »so frei und stark und zwingend in den Werken seiner genialen
Künstler charakterisiert hat«. Diese Schrift möchte auch »vor belgischer Wut warnen,
so lange das Volk uns wie Feinde betrachtet. Dann aber möge sie auch führen
zu einem Volke, dem des Lebens ganze ungebundene Lust Lebensbedingung
dessen Kunst des Lebens Qual und aller Menschen Leidenschaften malerisch ver-
klärt hat«.
Da Belgien in allen Jahrhunderten der Schauplatz schwerer Kämpfe war, ist
die vom belgischen Volke in diesem Kriege entwickelte Grausamkeit nicht über-
raschend. Es wird die Frage aufgeworfen, wie ist die Kunst des Volkes, das so
viel Grausamkeit im jetzigen Kriege zeigte? Nun haben belgische Künstler tatsäch-
lich eine große Neigung gezeigt, Grausames darzustellen. In erster Linie ist hier
Rubens genannt; der »schwelgt künstlerisch auch in den gräßlichsten Vorgängen«.
Bei Hieronymus Bosch finden wir das gleiche. Als bezeichnend für die Schil-
derung des Grausamen durch Pieter Breughel den Älteren wird der Stich
»Gerechtigkeit« angeführt, »in dem so ziemlich alle Arten der Folterungen und Hin-
richtungsweisen jener Zeiten so geschildert sind, daß zweifellos viele Henker manch
neue oder zeitweise vergessene Folterei sich davon abgesehen haben werden«.
Der nach Brügge zugezogene Gerhard David wird mit dem Gemälde »Die
Schindung des Sisamnes« genannt. Dierik Bouts ist mit Martyriumbildern und
Ambrosius Francken tritt einem Hinrichtungsbild vertreten. Im letzten Jahr-
hundert wirkte auf dem Gebiete des Grausamen Anton Wiertz; er malte Krieg
und Hölle, Wahnsinn, Verbrechen, Tod. Ein echter Belgier war Felicien Rops.
Im Ganzen ist es »unmöglich, die Kette vortrefflich gemalter belgischer Bilder
der Grausamkeit zu verfolgen«.
Es werden drei Beispiele von Aufträgen an Gerhard David, Dierick Bouts und
Ambrosius Francken auf Werke mit grausamen Schilderungen angeführt; »wenn die