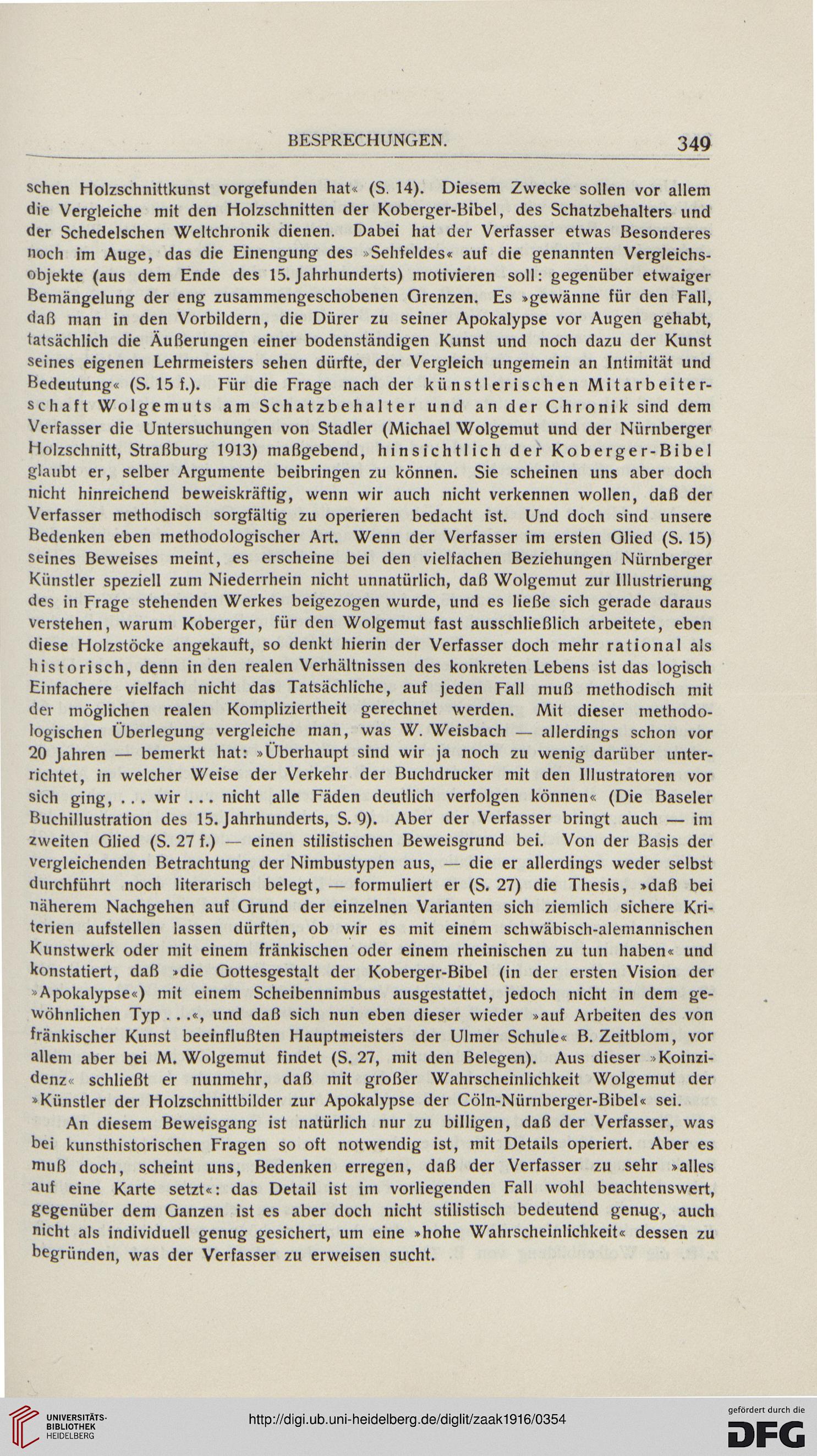BESPRECHUNGEN. 349
sehen Holzschnittkunst vorgefunden hat« (S. 14). Diesem Zwecke sollen vor allem
die Vergleiche mit den Holzschnitten der Koberger-Bibel, des Schatzbehalters und
der Schedeischen Weltchronik dienen. Dabei hat der Verfasser etwas Besonderes
noch im Auge, das die Einengung des Sehfeldes« auf die genannten Vergleichs-
objekte (aus dem Ende des 15. Jahrhunderts) motivieren soll: gegenüber etwaiger
Bemängelung der eng zusammengeschobenen Grenzen. Es »gewänne für den Fall,
daß man in den Vorbildern, die Dürer zu seiner Apokalypse vor Augen gehabt,
latsächlich die Äußerungen einer bodenständigen Kunst und noch dazu der Kunst
seines eigenen Lehrmeisters sehen dürfte, der Vergleich ungemein an Intimität und
Bedeutung« (S. 15 f.). Für die Frage nach der künstlerischen Mitarbeiter-
schaft Wolgemuts am Schatzbehalter und an der Chronik sind dem
Verfasser die Untersuchungen von Stadler (Michael Wolgemut und der Nürnberger
Holzschnitt, Straßburg 1913) maßgebend, hinsichtlich der Koberger-Bibel
glaubt er, selber Argumente beibringen zu können. Sie scheinen uns aber doch
nicht hinreichend beweiskräftig, wenn wir auch nicht verkennen wollen, daß der
Verfasser methodisch sorgfältig zu operieren bedacht ist. Und doch sind unsere
Bedenken eben methodologischer Art. Wenn der Verfasser im ersten Glied (S. 15)
seines Beweises meint, es erscheine bei den vielfachen Beziehungen Nürnberger
Künstler speziell zum Niederrhein nicht unnatürlich, daß Wolgemut zur Illustrierung
des in Frage stehenden Werkes beigezogen wurde, und es ließe sich gerade daraus
verstehen, warum Koberger, für den Wolgemut fast ausschließlich arbeitete, eben
diese Holzstöcke angekauft, so denkt hierin der Verfasser doch mehr rational als
historisch, denn in den realen Verhältnissen des konkreten Lebens ist das logisch
Einfachere vielfach nicht das Tatsächliche, auf jeden Fall muß methodisch mit
der möglichen realen Kompliziertheit gerechnet werden. Mit dieser methodo-
logischen Überlegung vergleiche man, was W. Weisbach — allerdings schon vor
20 Jahren — bemerkt hat: »Überhaupt sind wir ja noch zu wenig darüber unter-
richtet, in welcher Weise der Verkehr der Buchdrucker mit den Illustratoren vor
sich ging, .. . wir . .. nicht alle Fäden deutlich verfolgen können« (Die Baseler
Buchillustration des 15. Jahrhunderts, S. 9). Aber der Verfasser bringt auch — im
zweiten Glied (S. 27 f.) — einen stilistischen Beweisgrund bei. Von der Basis der
vergleichenden Betrachtung der Nimbustypen aus, — die er allerdings weder selbst
durchführt noch literarisch belegt, — formuliert er (S. 27) die Thesis, »daß bei
näherem Nachgehen auf Grund der einzelnen Varianten sich ziemlich sichere Kri-
terien aufstellen lassen dürften, ob wir es mit einem schwäbisch-alemannischen
Kunstwerk oder mit einem fränkischen oder einem rheinischen zu tun haben« und
konstatiert, daß »die Gottesgestalt der Koberger-Bibel (in der eisten Vision der
»Apokalypse«) mit einem Scheibennimbus ausgestattet, jedoch nicht in dem ge-
wöhnlichen Typ . . .«, und daß sich nun eben dieser wieder »auf Arbeiten des von
fränkischer Kunst beeinflußten Hauptmeisters der Ulmer Schule« B. Zeitblom, vor
allem aber bei M. Wolgemut findet (S. 27, mit den Belegen). Aus dieser »Koinzi-
denz« schließt er nunmehr, daß mit großer Wahrscheinlichkeit Wolgemut der
»Künstler der Holzschnittbilder zur Apokalypse der Cöln-Nürnberger-Bibel« sei.
An diesem Beweisgang ist natürlich nur zu billigen, daß der Verfasser, was
bei kunsthistorischen Fragen so oft notwendig ist, mit Details operiert. Aber es
muß doch, scheint uns, Bedenken erregen, daß der Verfasser zu sehr »alles
auf eine Karte setzt«: das Detail ist im vorliegenden Fall wohl beachtenswert,
gegenüber dem Ganzen ist es aber doch nicht stilistisch bedeutend genug, auch
nicht als individuell genug gesichert, um eine »hohe Wahrscheinlichkeit« dessen zu
begründen, was der Verfasser zu erweisen sucht.
sehen Holzschnittkunst vorgefunden hat« (S. 14). Diesem Zwecke sollen vor allem
die Vergleiche mit den Holzschnitten der Koberger-Bibel, des Schatzbehalters und
der Schedeischen Weltchronik dienen. Dabei hat der Verfasser etwas Besonderes
noch im Auge, das die Einengung des Sehfeldes« auf die genannten Vergleichs-
objekte (aus dem Ende des 15. Jahrhunderts) motivieren soll: gegenüber etwaiger
Bemängelung der eng zusammengeschobenen Grenzen. Es »gewänne für den Fall,
daß man in den Vorbildern, die Dürer zu seiner Apokalypse vor Augen gehabt,
latsächlich die Äußerungen einer bodenständigen Kunst und noch dazu der Kunst
seines eigenen Lehrmeisters sehen dürfte, der Vergleich ungemein an Intimität und
Bedeutung« (S. 15 f.). Für die Frage nach der künstlerischen Mitarbeiter-
schaft Wolgemuts am Schatzbehalter und an der Chronik sind dem
Verfasser die Untersuchungen von Stadler (Michael Wolgemut und der Nürnberger
Holzschnitt, Straßburg 1913) maßgebend, hinsichtlich der Koberger-Bibel
glaubt er, selber Argumente beibringen zu können. Sie scheinen uns aber doch
nicht hinreichend beweiskräftig, wenn wir auch nicht verkennen wollen, daß der
Verfasser methodisch sorgfältig zu operieren bedacht ist. Und doch sind unsere
Bedenken eben methodologischer Art. Wenn der Verfasser im ersten Glied (S. 15)
seines Beweises meint, es erscheine bei den vielfachen Beziehungen Nürnberger
Künstler speziell zum Niederrhein nicht unnatürlich, daß Wolgemut zur Illustrierung
des in Frage stehenden Werkes beigezogen wurde, und es ließe sich gerade daraus
verstehen, warum Koberger, für den Wolgemut fast ausschließlich arbeitete, eben
diese Holzstöcke angekauft, so denkt hierin der Verfasser doch mehr rational als
historisch, denn in den realen Verhältnissen des konkreten Lebens ist das logisch
Einfachere vielfach nicht das Tatsächliche, auf jeden Fall muß methodisch mit
der möglichen realen Kompliziertheit gerechnet werden. Mit dieser methodo-
logischen Überlegung vergleiche man, was W. Weisbach — allerdings schon vor
20 Jahren — bemerkt hat: »Überhaupt sind wir ja noch zu wenig darüber unter-
richtet, in welcher Weise der Verkehr der Buchdrucker mit den Illustratoren vor
sich ging, .. . wir . .. nicht alle Fäden deutlich verfolgen können« (Die Baseler
Buchillustration des 15. Jahrhunderts, S. 9). Aber der Verfasser bringt auch — im
zweiten Glied (S. 27 f.) — einen stilistischen Beweisgrund bei. Von der Basis der
vergleichenden Betrachtung der Nimbustypen aus, — die er allerdings weder selbst
durchführt noch literarisch belegt, — formuliert er (S. 27) die Thesis, »daß bei
näherem Nachgehen auf Grund der einzelnen Varianten sich ziemlich sichere Kri-
terien aufstellen lassen dürften, ob wir es mit einem schwäbisch-alemannischen
Kunstwerk oder mit einem fränkischen oder einem rheinischen zu tun haben« und
konstatiert, daß »die Gottesgestalt der Koberger-Bibel (in der eisten Vision der
»Apokalypse«) mit einem Scheibennimbus ausgestattet, jedoch nicht in dem ge-
wöhnlichen Typ . . .«, und daß sich nun eben dieser wieder »auf Arbeiten des von
fränkischer Kunst beeinflußten Hauptmeisters der Ulmer Schule« B. Zeitblom, vor
allem aber bei M. Wolgemut findet (S. 27, mit den Belegen). Aus dieser »Koinzi-
denz« schließt er nunmehr, daß mit großer Wahrscheinlichkeit Wolgemut der
»Künstler der Holzschnittbilder zur Apokalypse der Cöln-Nürnberger-Bibel« sei.
An diesem Beweisgang ist natürlich nur zu billigen, daß der Verfasser, was
bei kunsthistorischen Fragen so oft notwendig ist, mit Details operiert. Aber es
muß doch, scheint uns, Bedenken erregen, daß der Verfasser zu sehr »alles
auf eine Karte setzt«: das Detail ist im vorliegenden Fall wohl beachtenswert,
gegenüber dem Ganzen ist es aber doch nicht stilistisch bedeutend genug, auch
nicht als individuell genug gesichert, um eine »hohe Wahrscheinlichkeit« dessen zu
begründen, was der Verfasser zu erweisen sucht.