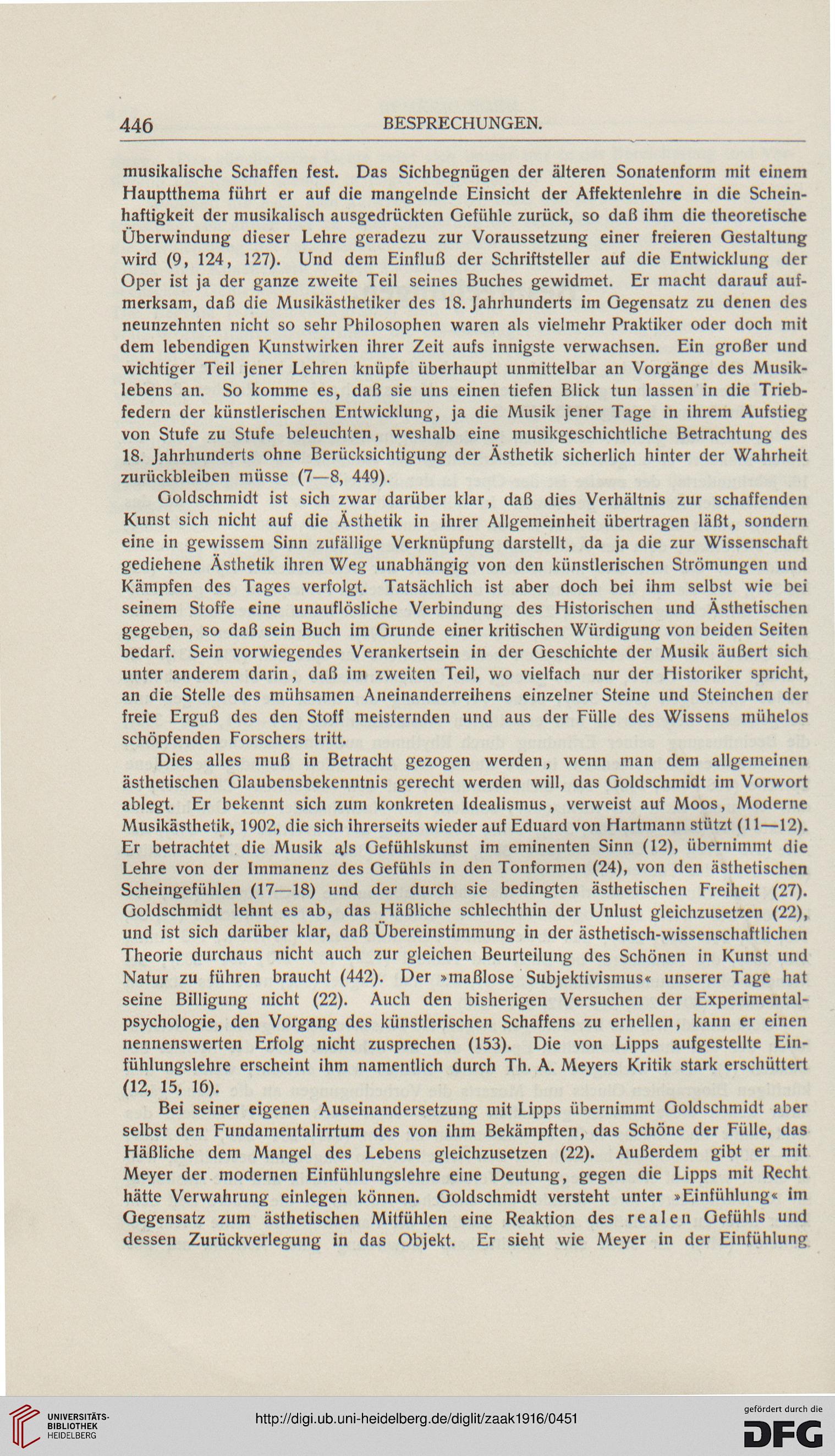446 BESPRECHUNGEN.
musikalische Schaffen fest. Das Sichbegnügen der älteren Sonatenform mit einem
Hauptthema führt er auf die mangelnde Einsicht der Affektenlehre in die Schein-
haftigkeit der musikalisch ausgedrückten Gefühle zurück, so daß ihm die theoretische
Überwindung dieser Lehre geradezu zur Voraussetzung einer freieren Gestaltung
wird (9, 124, 127). Und dem Einfluß der Schriftsteller auf die Entwicklung der
Oper ist ja der ganze zweite Teil seines Buches gewidmet. Er macht darauf auf-
merksam, daß die Musikästhetiker des 18. Jahrhunderts im Gegensatz zu denen des
neunzehnten nicht so sehr Philosophen waren als vielmehr Praktiker oder doch mit
dem lebendigen Kunstwirken ihrer Zeit aufs innigste verwachsen. Ein großer und
wichtiger Teil jener Lehren knüpfe überhaupt unmittelbar an Vorgänge des Musik-
lebens an. So komme es, daß sie uns einen tiefen Blick tun lassen in die Trieb-
federn der künstlerischen Entwicklung, ja die Musik jener Tage in ihrem Aufstieg
von Stufe zu Stufe beleuchten, weshalb eine musikgeschichtliche Betrachtung des
18. Jahrhunderts ohne Berücksichtigung der Ästhetik sicherlich hinter der Wahrheit
zurückbleiben müsse (7—8, 449).
Goldschmidt ist sich zwar darüber klar, daß dies Verhältnis zur schaffenden
Kunst sich nicht auf die Ästhetik in ihrer Allgemeinheit übertragen läßt, sondern
eine in gewissem Sinn zufällige Verknüpfung darstellt, da ja die zur Wissenschaft
gediehene Ästhetik ihren Weg unabhängig von den künstlerischen Strömungen und
Kämpfen des Tages verfolgt. Tatsächlich ist aber doch bei ihm selbst wie bei
seinem Stoffe eine unauflösliche Verbindung des Historischen und Ästhetischen
gegeben, so daß sein Buch im Grunde einer kritischen Würdigung von beiden Seiten
bedarf. Sein vorwiegendes Verankertsein in der Geschichte der Musik äußert sich
unter anderem darin, daß im zweiten Teil, wo vielfach nur der Historiker spricht,
an die Stelle des mühsamen Aneinanderreihens einzelner Steine und Steinchen der
freie Erguß des den Stoff meisternden und aus der Fülle des Wissens mühelos
schöpfenden Forschers tritt.
Dies alles muß in Betracht gezogen werden, wenn man dem allgemeinen
ästhetischen Glaubensbekenntnis gerecht werden will, das Goldschmidt im Vorwort
ablegt. Er bekennt sich zum konkreten Idealismus, verweist auf Moos, Moderne
Musikästhetik, 1902, die sich ihrerseits wieder auf Eduard von Hartmann stützt (11—12).
Er betrachtet die Musik ajs Gefühlskunst im eminenten Sinn (12), übernimmt die
Lehre von der Immanenz des Gefühls in den Tonformen (24), von den ästhetischen
Scheingefühlen (17—18) und der durch sie bedingten ästhetischen Freiheit (27).
Goldschmidt lehnt es ab, das Häßliche schlechthin der Unlust gleichzusetzen (22),
und ist sich darüber klar, daß Übereinstimmung in der ästhetisch-wissenschaftlichen
Theorie durchaus nicht auch zur gleichen Beurteilung des Schönen in Kunst und
Natur zu führen braucht (442). Der »maßlose Subjektivismus« unserer Tage hat
seine Billigung nicht (22). Auch den bisherigen Versuchen der Experimental-
psychologie, den Vorgang des künstlerischen Schaffens zu erhellen, kann er einen
nennenswerten Erfolg nicht zusprechen (153). Die von Lipps aufgestellte Ein-
fühlungslehre erscheint ihm namentlich durch Th. A. Meyers Kritik stark erschüttert
(12, 15, 16).
Bei seiner eigenen Auseinandersetzung mit Lipps übernimmt Goldschmidt aber
selbst den Fundamentalirrtum des von ihm Bekämpften, das Schöne der Fülle, das
Häßliche dem Mangel des Lebens gleichzusetzen (22). Außerdem gibt er mit
Meyer der modernen Einfühlungslehre eine Deutung, gegen die Lipps mit Recht
hätte Verwahrung einlegen können. Goldschmidt versteht unter »Einfühlung« im
Gegensatz zum ästhetischen Mitfühlen eine Reaktion des realen Gefühls und
dessen Zurückverlegung in das Objekt. Er sieht wie Meyer in der Einfühlung
musikalische Schaffen fest. Das Sichbegnügen der älteren Sonatenform mit einem
Hauptthema führt er auf die mangelnde Einsicht der Affektenlehre in die Schein-
haftigkeit der musikalisch ausgedrückten Gefühle zurück, so daß ihm die theoretische
Überwindung dieser Lehre geradezu zur Voraussetzung einer freieren Gestaltung
wird (9, 124, 127). Und dem Einfluß der Schriftsteller auf die Entwicklung der
Oper ist ja der ganze zweite Teil seines Buches gewidmet. Er macht darauf auf-
merksam, daß die Musikästhetiker des 18. Jahrhunderts im Gegensatz zu denen des
neunzehnten nicht so sehr Philosophen waren als vielmehr Praktiker oder doch mit
dem lebendigen Kunstwirken ihrer Zeit aufs innigste verwachsen. Ein großer und
wichtiger Teil jener Lehren knüpfe überhaupt unmittelbar an Vorgänge des Musik-
lebens an. So komme es, daß sie uns einen tiefen Blick tun lassen in die Trieb-
federn der künstlerischen Entwicklung, ja die Musik jener Tage in ihrem Aufstieg
von Stufe zu Stufe beleuchten, weshalb eine musikgeschichtliche Betrachtung des
18. Jahrhunderts ohne Berücksichtigung der Ästhetik sicherlich hinter der Wahrheit
zurückbleiben müsse (7—8, 449).
Goldschmidt ist sich zwar darüber klar, daß dies Verhältnis zur schaffenden
Kunst sich nicht auf die Ästhetik in ihrer Allgemeinheit übertragen läßt, sondern
eine in gewissem Sinn zufällige Verknüpfung darstellt, da ja die zur Wissenschaft
gediehene Ästhetik ihren Weg unabhängig von den künstlerischen Strömungen und
Kämpfen des Tages verfolgt. Tatsächlich ist aber doch bei ihm selbst wie bei
seinem Stoffe eine unauflösliche Verbindung des Historischen und Ästhetischen
gegeben, so daß sein Buch im Grunde einer kritischen Würdigung von beiden Seiten
bedarf. Sein vorwiegendes Verankertsein in der Geschichte der Musik äußert sich
unter anderem darin, daß im zweiten Teil, wo vielfach nur der Historiker spricht,
an die Stelle des mühsamen Aneinanderreihens einzelner Steine und Steinchen der
freie Erguß des den Stoff meisternden und aus der Fülle des Wissens mühelos
schöpfenden Forschers tritt.
Dies alles muß in Betracht gezogen werden, wenn man dem allgemeinen
ästhetischen Glaubensbekenntnis gerecht werden will, das Goldschmidt im Vorwort
ablegt. Er bekennt sich zum konkreten Idealismus, verweist auf Moos, Moderne
Musikästhetik, 1902, die sich ihrerseits wieder auf Eduard von Hartmann stützt (11—12).
Er betrachtet die Musik ajs Gefühlskunst im eminenten Sinn (12), übernimmt die
Lehre von der Immanenz des Gefühls in den Tonformen (24), von den ästhetischen
Scheingefühlen (17—18) und der durch sie bedingten ästhetischen Freiheit (27).
Goldschmidt lehnt es ab, das Häßliche schlechthin der Unlust gleichzusetzen (22),
und ist sich darüber klar, daß Übereinstimmung in der ästhetisch-wissenschaftlichen
Theorie durchaus nicht auch zur gleichen Beurteilung des Schönen in Kunst und
Natur zu führen braucht (442). Der »maßlose Subjektivismus« unserer Tage hat
seine Billigung nicht (22). Auch den bisherigen Versuchen der Experimental-
psychologie, den Vorgang des künstlerischen Schaffens zu erhellen, kann er einen
nennenswerten Erfolg nicht zusprechen (153). Die von Lipps aufgestellte Ein-
fühlungslehre erscheint ihm namentlich durch Th. A. Meyers Kritik stark erschüttert
(12, 15, 16).
Bei seiner eigenen Auseinandersetzung mit Lipps übernimmt Goldschmidt aber
selbst den Fundamentalirrtum des von ihm Bekämpften, das Schöne der Fülle, das
Häßliche dem Mangel des Lebens gleichzusetzen (22). Außerdem gibt er mit
Meyer der modernen Einfühlungslehre eine Deutung, gegen die Lipps mit Recht
hätte Verwahrung einlegen können. Goldschmidt versteht unter »Einfühlung« im
Gegensatz zum ästhetischen Mitfühlen eine Reaktion des realen Gefühls und
dessen Zurückverlegung in das Objekt. Er sieht wie Meyer in der Einfühlung