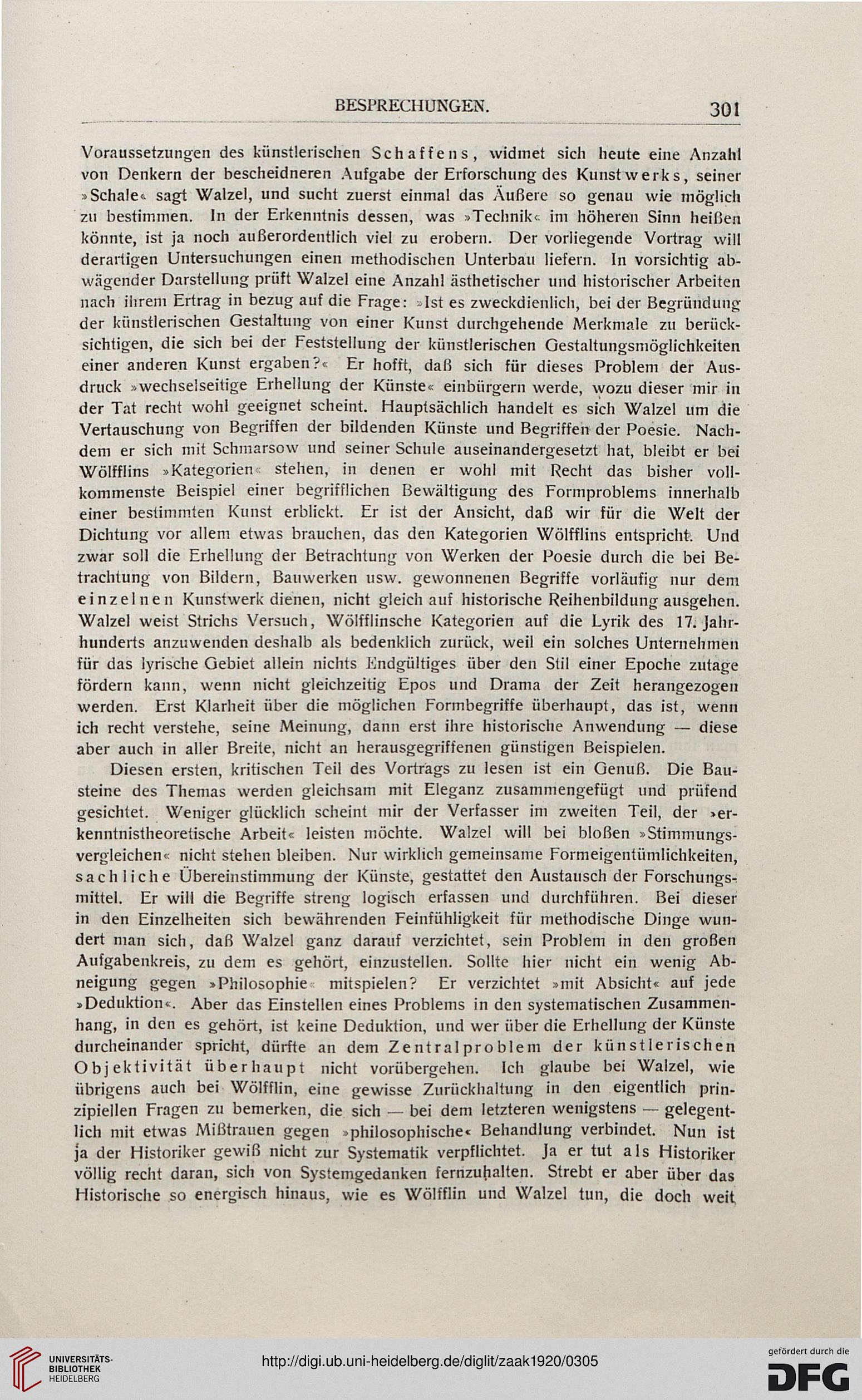BESPRECHUNGEN. 301
Voraussetzungen des künstlerischen Schaffens, widmet sich heute eine Anzahl
von Denkern der bescheidneren Aufgabe der Erforschung des Kunstwerks, seiner
»Schale^ sagt Walzel, und sucht zuerst einmal das Äußere so genau wie möglich
zu bestimmen. In der Erkenntnis dessen, was »Technik« im höheren Sinn heißen
könnte, ist ja noch außerordentlich viel zu erobern. Der vorliegende Vortrag will
derartigen Untersuchungen einen methodischen Unterbau liefern. In vorsichtig ab-
wägender Darstellung prüft Walzel eine Anzahl ästhetischer und historischer Arbeiten
nach ihrem Ertrag in bezug auf die Frage: Tst es zweckdienlich, bei der Begründung
der künstlerischen Gestaltung von einer Kunst durchgehende Merkmale zu berück-
sichtigen, die sich bei der Feststellung der künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten
einer anderen Kunst ergaben ?« Er hofft, daß sich für dieses Problem der Aus-
druck »wechselseitige Erhellung der Künste« einbürgern werde, wozu dieser mir in
der Tat recht wohl geeignet scheint. Hauptsächlich handelt es sich Walzel um die
Vertauschung von Begriffen der bildenden Künste und Begriffen der Poesie. Nach-
dem er sich mit Schmarsow und seiner Schule auseinandergesetzt hat, bleibt er bei
Wölfflins »Kategorien; stehen, in denen er wohl mit Recht das bisher voll-
kommenste Beispiel einer begrifflichen Bewältigung des Formproblems innerhalb
einer bestimmten Kunst erblickt. Er ist der Ansicht, daß wir für die Welt der
Dichtung vor allem etwas brauchen, das den Kategorien Wölfflins entspricht. Und
zwar soll die Erhellung der Betrachtung von Werken der Poesie durch die bei Be-
trachtung von Bildern, Bauwerken usw. gewonnenen Begriffe vorläufig nur dem
einzelnen Kunstwerk dienen, nicht gleich auf historische Reihenbildung ausgehen.
Walzel weist Strichs Versuch, Wölfflinsche Kategorien auf die Lyrik des 17. Jahr-
hunderts anzuwenden deshalb als bedenklich zurück, weil ein solches Unternehmen
für das lyrische Gebiet allein nichts Endgültiges über den Stil einer Epoche zutage
fördern kann, wenn nicht gleichzeitig Epos und Drama der Zeit herangezogen
werden. Erst Klarheit über die möglichen Formbegriffe überhaupt, das ist, wenn
ich recht verstehe, seine Meinung, dann erst ihre historische Anwendung — diese
aber auch in aller Breite, nicht an herausgegriffenen günstigen Beispielen.
Diesen ersten, kritischen Teil des Vortrags zu lesen ist ein Genuß. Die Bau-
steine des Themas werden gleichsam mit Eleganz zusammengefügt und prüfend
gesichtet. Weniger glücklich scheint mir der Verfasser im zweiten Teil, der >er-
kenntnistheoretische Arbeit« leisten möchte. Walzel will bei bloßen »Stimmungs-
vergleichen« nicht stehen bleiben. Nur wirklich gemeinsame Formeigentümlichkeiten,
sachliche Übereinstimmung der Künste, gestattet den Austausch der Forschungs^
mittel. Er will die Begriffe streng logisch erfassen und durchführen. Bei dieser
in den Einzelheiten sich bewährenden Feinfühligkeit für methodische Dinge wun-
dert man sich, daß Walzel ganz darauf verzichtet, sein Problem in den großen
Aufgabenkreis, zu dem es gehört, einzustellen. Sollte hier nicht ein wenig Ab-
neigung gegen »Philosophie mitspielen? Er verzichtet »mit Absicht« auf jede
»Deduktion«. Aber das Einstellen eines Problems in den systematischen Zusammen-
hang, in den es gehört, ist keine Deduktion, und wer über die Erhellung der Künste
durcheinander spricht, dürfte an dem Zentral pro blem der künstlerischen
Objektivität überhaupt nicht vorübergehen. Ich glaube bei Walzel, wie
übrigens auch bei Wölfflin, eine gewisse Zurückhaltung in den eigentlich prin-
zipiellen Fragen zu bemerken, die sich — bei dem letzteren wenigstens — gelegent-
lich mit etwas Mißtrauen gegen »philosophische« Behandlung verbindet. Nun ist
ja der Historiker gewiß nicht zur Systematik verpflichtet. Ja er tut als Historiker
völlig recht daran, sich von Systemgedanken fernzuhalten. Strebt er aber über das
Historische so energisch hinaus, wie es Wölfflin und Walzel tun, die doch weit
Voraussetzungen des künstlerischen Schaffens, widmet sich heute eine Anzahl
von Denkern der bescheidneren Aufgabe der Erforschung des Kunstwerks, seiner
»Schale^ sagt Walzel, und sucht zuerst einmal das Äußere so genau wie möglich
zu bestimmen. In der Erkenntnis dessen, was »Technik« im höheren Sinn heißen
könnte, ist ja noch außerordentlich viel zu erobern. Der vorliegende Vortrag will
derartigen Untersuchungen einen methodischen Unterbau liefern. In vorsichtig ab-
wägender Darstellung prüft Walzel eine Anzahl ästhetischer und historischer Arbeiten
nach ihrem Ertrag in bezug auf die Frage: Tst es zweckdienlich, bei der Begründung
der künstlerischen Gestaltung von einer Kunst durchgehende Merkmale zu berück-
sichtigen, die sich bei der Feststellung der künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten
einer anderen Kunst ergaben ?« Er hofft, daß sich für dieses Problem der Aus-
druck »wechselseitige Erhellung der Künste« einbürgern werde, wozu dieser mir in
der Tat recht wohl geeignet scheint. Hauptsächlich handelt es sich Walzel um die
Vertauschung von Begriffen der bildenden Künste und Begriffen der Poesie. Nach-
dem er sich mit Schmarsow und seiner Schule auseinandergesetzt hat, bleibt er bei
Wölfflins »Kategorien; stehen, in denen er wohl mit Recht das bisher voll-
kommenste Beispiel einer begrifflichen Bewältigung des Formproblems innerhalb
einer bestimmten Kunst erblickt. Er ist der Ansicht, daß wir für die Welt der
Dichtung vor allem etwas brauchen, das den Kategorien Wölfflins entspricht. Und
zwar soll die Erhellung der Betrachtung von Werken der Poesie durch die bei Be-
trachtung von Bildern, Bauwerken usw. gewonnenen Begriffe vorläufig nur dem
einzelnen Kunstwerk dienen, nicht gleich auf historische Reihenbildung ausgehen.
Walzel weist Strichs Versuch, Wölfflinsche Kategorien auf die Lyrik des 17. Jahr-
hunderts anzuwenden deshalb als bedenklich zurück, weil ein solches Unternehmen
für das lyrische Gebiet allein nichts Endgültiges über den Stil einer Epoche zutage
fördern kann, wenn nicht gleichzeitig Epos und Drama der Zeit herangezogen
werden. Erst Klarheit über die möglichen Formbegriffe überhaupt, das ist, wenn
ich recht verstehe, seine Meinung, dann erst ihre historische Anwendung — diese
aber auch in aller Breite, nicht an herausgegriffenen günstigen Beispielen.
Diesen ersten, kritischen Teil des Vortrags zu lesen ist ein Genuß. Die Bau-
steine des Themas werden gleichsam mit Eleganz zusammengefügt und prüfend
gesichtet. Weniger glücklich scheint mir der Verfasser im zweiten Teil, der >er-
kenntnistheoretische Arbeit« leisten möchte. Walzel will bei bloßen »Stimmungs-
vergleichen« nicht stehen bleiben. Nur wirklich gemeinsame Formeigentümlichkeiten,
sachliche Übereinstimmung der Künste, gestattet den Austausch der Forschungs^
mittel. Er will die Begriffe streng logisch erfassen und durchführen. Bei dieser
in den Einzelheiten sich bewährenden Feinfühligkeit für methodische Dinge wun-
dert man sich, daß Walzel ganz darauf verzichtet, sein Problem in den großen
Aufgabenkreis, zu dem es gehört, einzustellen. Sollte hier nicht ein wenig Ab-
neigung gegen »Philosophie mitspielen? Er verzichtet »mit Absicht« auf jede
»Deduktion«. Aber das Einstellen eines Problems in den systematischen Zusammen-
hang, in den es gehört, ist keine Deduktion, und wer über die Erhellung der Künste
durcheinander spricht, dürfte an dem Zentral pro blem der künstlerischen
Objektivität überhaupt nicht vorübergehen. Ich glaube bei Walzel, wie
übrigens auch bei Wölfflin, eine gewisse Zurückhaltung in den eigentlich prin-
zipiellen Fragen zu bemerken, die sich — bei dem letzteren wenigstens — gelegent-
lich mit etwas Mißtrauen gegen »philosophische« Behandlung verbindet. Nun ist
ja der Historiker gewiß nicht zur Systematik verpflichtet. Ja er tut als Historiker
völlig recht daran, sich von Systemgedanken fernzuhalten. Strebt er aber über das
Historische so energisch hinaus, wie es Wölfflin und Walzel tun, die doch weit