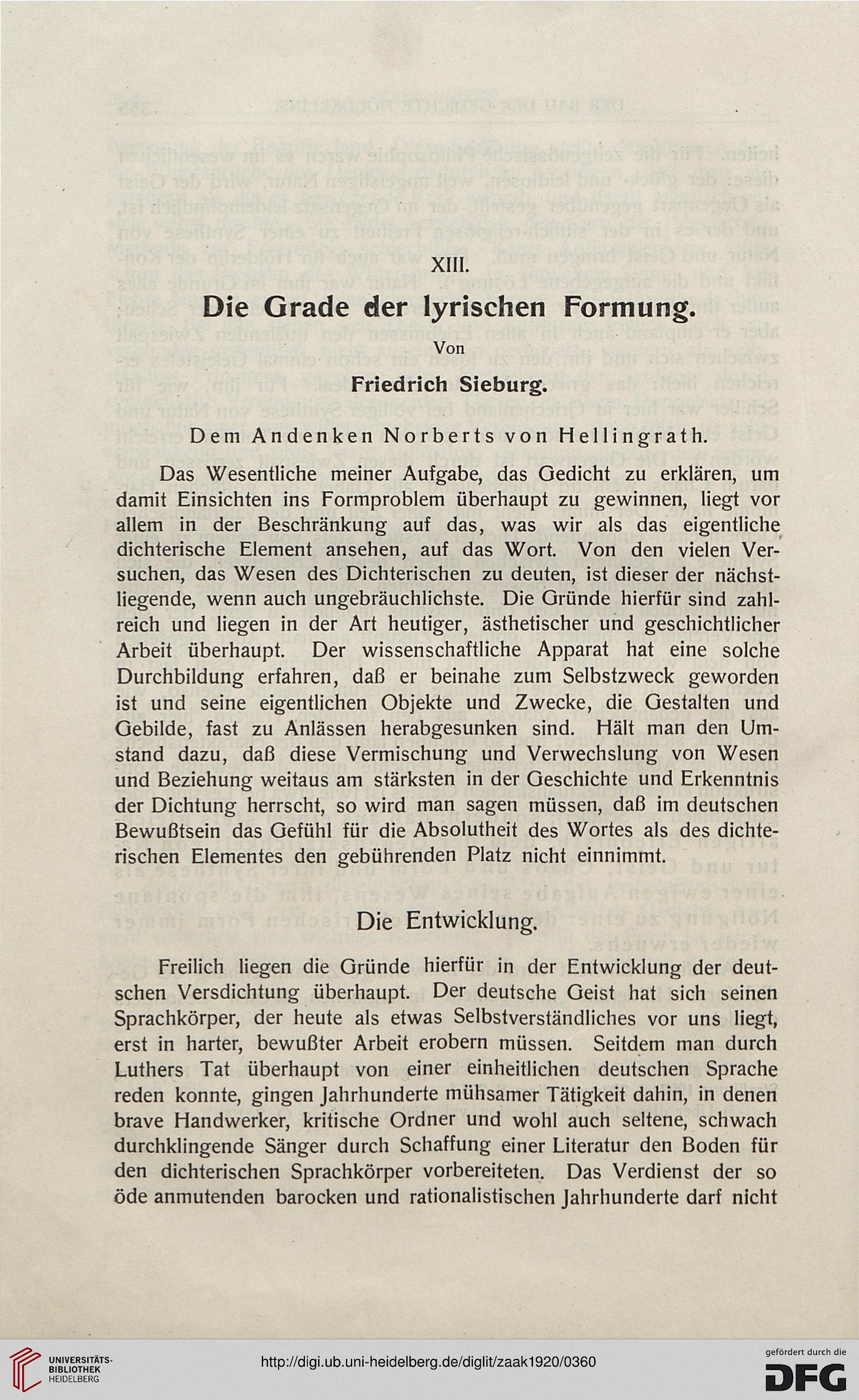XIII.
Die Grade der lyrischen Formung.
Von
Friedrich Sieburg.
Dem Andenken Norberts von Hellingrath.
Das Wesentliche meiner Aufgabe, das Gedicht zu erklären, um
damit Einsichten ins Formproblem überhaupt zu gewinnen, liegt vor
allem in der Beschränkung auf das, was wir als das eigentliche
dichterische Element ansehen, auf das Wort. Von den vielen Ver-
suchen, das Wesen des Dichterischen zu deuten, ist dieser der nächst-
liegende, wenn auch ungebräuchlichste. Die Gründe hierfür sind zahl-
reich und liegen in der Art heutiger, ästhetischer und geschichtlicher
Arbeit überhaupt. Der wissenschaftliche Apparat hat eine solche
Durchbildung erfahren, daß er beinahe zum Selbstzweck geworden
ist und seine eigentlichen Objekte und Zwecke, die Gestalten und
Gebilde, fast zu Anlässen herabgesunken sind. Hält man den Um-
stand dazu, daß diese Vermischung und Verwechslung von Wesen
und Beziehung weitaus am stärksten in der Geschichte und Erkenntnis
der Dichtung herrscht, so wird man sagen müssen, daß im deutschen
Bewußtsein das Gefühl für die Absolutheit des Wortes als des dichte-
rischen Elementes den gebührenden Platz nicht einnimmt.
Die Entwicklung.
Freilich liegen die Gründe hierfür in der Entwicklung der deut-
schen Versdichtung überhaupt. Der deutsche Geist hat sich seinen
Sprachkörper, der heute als etwas Selbstverständliches vor uns liegt,
erst in harter, bewußter Arbeit erobern müssen. Seitdem man durch
Luthers Tat überhaupt von einer einheitlichen deutschen Sprache
reden konnte, gingen Jahrhunderte mühsamer Tätigkeit dahin, in denen
brave Handwerker, kritische Ordner und wohl auch seltene, schwach
durchklingende Sänger durch Schaffung einer Literatur den Boden für
den dichterischen Sprachkörper vorbereiteten. Das Verdienst der so
öde anmutenden barocken und rationalistischen Jahrhunderte darf nicht
Die Grade der lyrischen Formung.
Von
Friedrich Sieburg.
Dem Andenken Norberts von Hellingrath.
Das Wesentliche meiner Aufgabe, das Gedicht zu erklären, um
damit Einsichten ins Formproblem überhaupt zu gewinnen, liegt vor
allem in der Beschränkung auf das, was wir als das eigentliche
dichterische Element ansehen, auf das Wort. Von den vielen Ver-
suchen, das Wesen des Dichterischen zu deuten, ist dieser der nächst-
liegende, wenn auch ungebräuchlichste. Die Gründe hierfür sind zahl-
reich und liegen in der Art heutiger, ästhetischer und geschichtlicher
Arbeit überhaupt. Der wissenschaftliche Apparat hat eine solche
Durchbildung erfahren, daß er beinahe zum Selbstzweck geworden
ist und seine eigentlichen Objekte und Zwecke, die Gestalten und
Gebilde, fast zu Anlässen herabgesunken sind. Hält man den Um-
stand dazu, daß diese Vermischung und Verwechslung von Wesen
und Beziehung weitaus am stärksten in der Geschichte und Erkenntnis
der Dichtung herrscht, so wird man sagen müssen, daß im deutschen
Bewußtsein das Gefühl für die Absolutheit des Wortes als des dichte-
rischen Elementes den gebührenden Platz nicht einnimmt.
Die Entwicklung.
Freilich liegen die Gründe hierfür in der Entwicklung der deut-
schen Versdichtung überhaupt. Der deutsche Geist hat sich seinen
Sprachkörper, der heute als etwas Selbstverständliches vor uns liegt,
erst in harter, bewußter Arbeit erobern müssen. Seitdem man durch
Luthers Tat überhaupt von einer einheitlichen deutschen Sprache
reden konnte, gingen Jahrhunderte mühsamer Tätigkeit dahin, in denen
brave Handwerker, kritische Ordner und wohl auch seltene, schwach
durchklingende Sänger durch Schaffung einer Literatur den Boden für
den dichterischen Sprachkörper vorbereiteten. Das Verdienst der so
öde anmutenden barocken und rationalistischen Jahrhunderte darf nicht