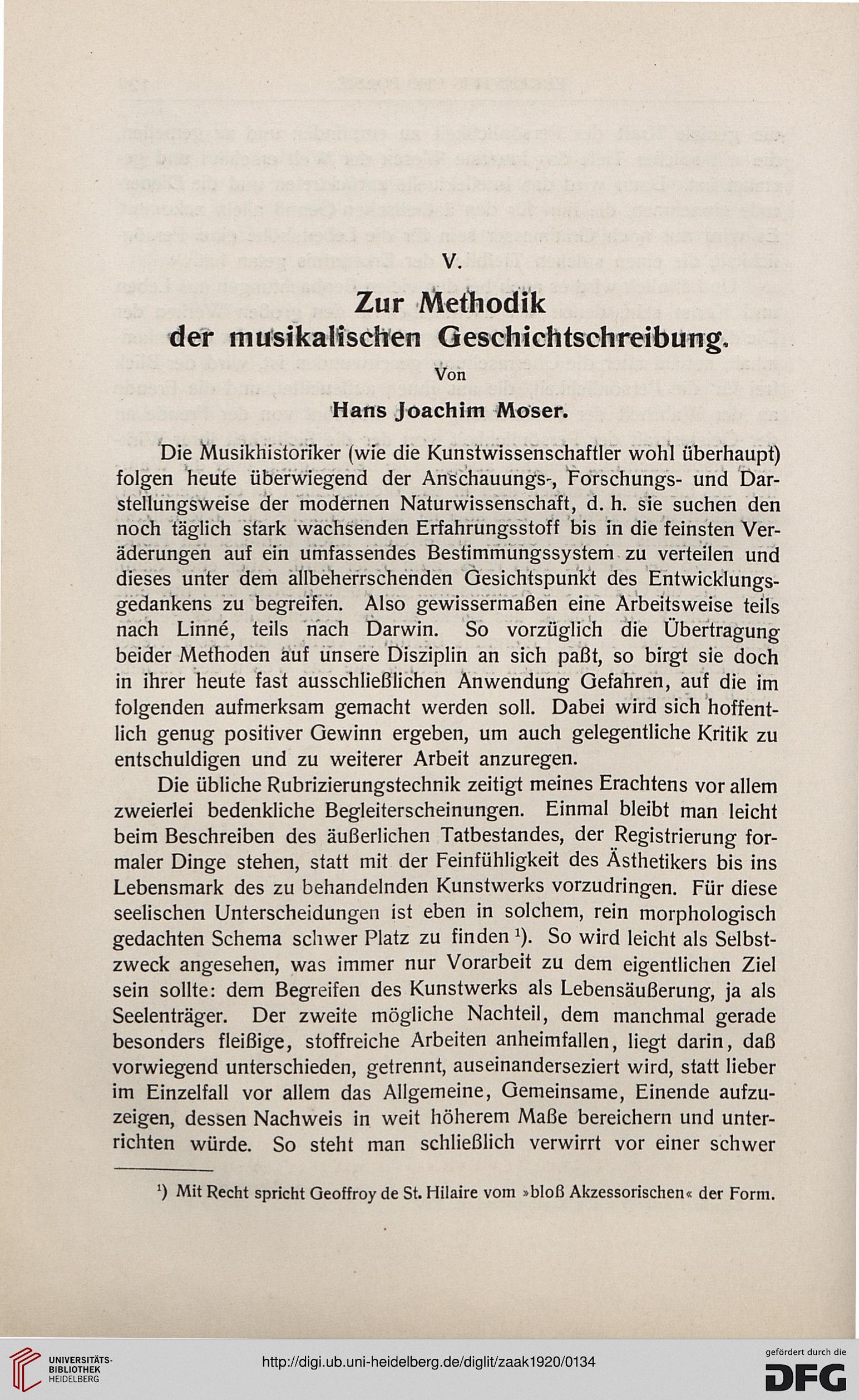V.
Zur Methodik
der musikalischen Geschichtschreibung.
Von
Hans Joachim Moser.
Die Musikhistoriker (wie die Kunstwissenschaftler wohl überhaupt)
folgen heute überwiegend der Anschauungs-, Forschungs- und Dar-
stellungsweise der modernen Naturwissenschaft, d. h. sie suchen den
noch täglich stark wachsenden Erfahrungsstoff bis in die feinsten Ver-
äderungen auf ein umfassendes Bestimmungssystem zu verteilen und
dieses unter dem allbeherrschenden Gesichtspunkt des Entwicklungs-
gedankens zu begreifen. Also gewissermaßen eine Arbeitsweise teils
nach Linne, teils nach Darwin. So vorzüglich die Übertragung
beider Methoden auf unsere Disziplin an sich paßt, so birgt sie doch
in ihrer heute fast ausschließlichen Anwendung Gefahren, auf die im
folgenden aufmerksam gemacht werden soll. Dabei wird sich hoffent-
lich genug positiver Gewinn ergeben, um auch gelegentliche Kritik zu
entschuldigen und zu weiterer Arbeit anzuregen.
Die übliche Rubrizierungstechnik zeitigt meines Erachtens vor allem
zweierlei bedenkliche Begleiterscheinungen. Einmal bleibt man leicht
beim Beschreiben des äußerlichen Tatbestandes, der Registrierung for-
maler Dinge stehen, statt mit der Feinfühligkeit des Ästhetikers bis ins
Lebensmark des zu behandelnden Kunstwerks vorzudringen. Für diese
seelischen Unterscheidungen ist eben in solchem, rein morphologisch
gedachten Schema schwer Platz zu finden x). So wird leicht als Selbst-
zweck angesehen, was immer nur Vorarbeit zu dem eigentlichen Ziel
sein sollte: dem Begreifen des Kunstwerks als Lebensäußerung, ja als
Seelenträger. Der zweite mögliche Nachteil, dem manchmal gerade
besonders fleißige, stoffreiche Arbeiten anheimfallen, liegt darin, daß
vorwiegend unterschieden, getrennt, auseinanderseziert wird, statt lieber
im Einzelfall vor allem das Allgemeine, Gemeinsame, Einende aufzu-
zeigen, dessen Nachweis in weit höherem Maße bereichern und unter-
richten würde. So steht man schließlich verwirrt vor einer schwer
') Mit Recht spricht Qeoffroy de St. Hilaire vom »bloß Akzessorischen« der Form.
Zur Methodik
der musikalischen Geschichtschreibung.
Von
Hans Joachim Moser.
Die Musikhistoriker (wie die Kunstwissenschaftler wohl überhaupt)
folgen heute überwiegend der Anschauungs-, Forschungs- und Dar-
stellungsweise der modernen Naturwissenschaft, d. h. sie suchen den
noch täglich stark wachsenden Erfahrungsstoff bis in die feinsten Ver-
äderungen auf ein umfassendes Bestimmungssystem zu verteilen und
dieses unter dem allbeherrschenden Gesichtspunkt des Entwicklungs-
gedankens zu begreifen. Also gewissermaßen eine Arbeitsweise teils
nach Linne, teils nach Darwin. So vorzüglich die Übertragung
beider Methoden auf unsere Disziplin an sich paßt, so birgt sie doch
in ihrer heute fast ausschließlichen Anwendung Gefahren, auf die im
folgenden aufmerksam gemacht werden soll. Dabei wird sich hoffent-
lich genug positiver Gewinn ergeben, um auch gelegentliche Kritik zu
entschuldigen und zu weiterer Arbeit anzuregen.
Die übliche Rubrizierungstechnik zeitigt meines Erachtens vor allem
zweierlei bedenkliche Begleiterscheinungen. Einmal bleibt man leicht
beim Beschreiben des äußerlichen Tatbestandes, der Registrierung for-
maler Dinge stehen, statt mit der Feinfühligkeit des Ästhetikers bis ins
Lebensmark des zu behandelnden Kunstwerks vorzudringen. Für diese
seelischen Unterscheidungen ist eben in solchem, rein morphologisch
gedachten Schema schwer Platz zu finden x). So wird leicht als Selbst-
zweck angesehen, was immer nur Vorarbeit zu dem eigentlichen Ziel
sein sollte: dem Begreifen des Kunstwerks als Lebensäußerung, ja als
Seelenträger. Der zweite mögliche Nachteil, dem manchmal gerade
besonders fleißige, stoffreiche Arbeiten anheimfallen, liegt darin, daß
vorwiegend unterschieden, getrennt, auseinanderseziert wird, statt lieber
im Einzelfall vor allem das Allgemeine, Gemeinsame, Einende aufzu-
zeigen, dessen Nachweis in weit höherem Maße bereichern und unter-
richten würde. So steht man schließlich verwirrt vor einer schwer
') Mit Recht spricht Qeoffroy de St. Hilaire vom »bloß Akzessorischen« der Form.