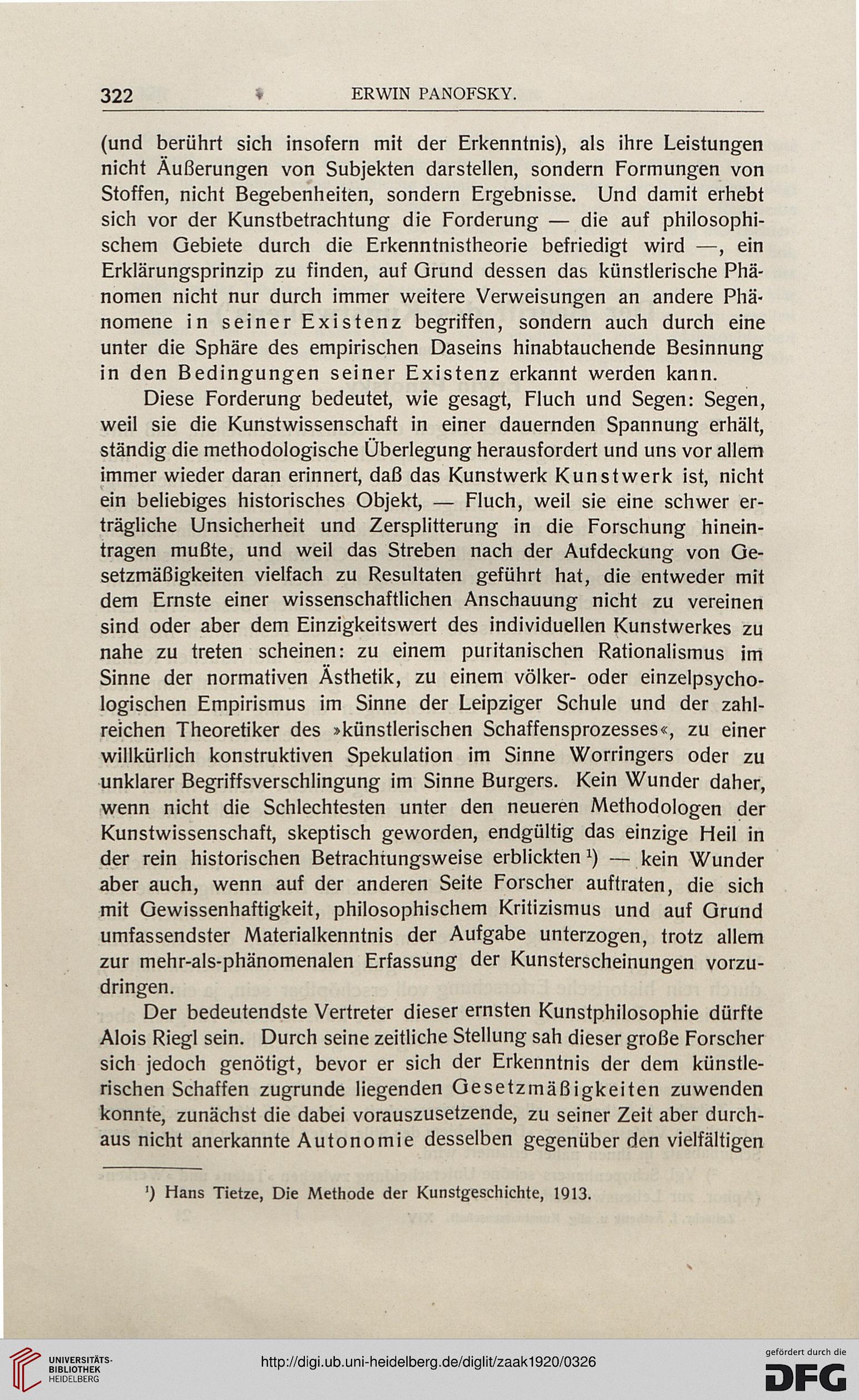322 * ERWIN PANOFSKY.
(und berührt sich insofern mit der Erkenntnis), als ihre Leistungen
nicht Äußerungen von Subjekten darstellen, sondern Formungen von
Stoffen, nicht Begebenheiten, sondern Ergebnisse. Und damit erhebt
sich vor der Kunstbetrachtung die Forderung — die auf philosophi-
schem Gebiete durch die Erkenntnistheorie befriedigt wird —, ein
Erklärungsprinzip zu finden, auf Grund dessen das künstlerische Phä-
nomen nicht nur durch immer weitere Verweisungen an andere Phä-
nomene in seiner Existenz begriffen, sondern auch durch eine
unter die Sphäre des empirischen Daseins hinabtauchende Besinnung
in den Bedingungen seiner Existenz erkannt werden kann.
Diese Forderung bedeutet, wie gesagt, Fluch und Segen: Segen,
weil sie die Kunstwissenschaft in einer dauernden Spannung erhält,
ständig die methodologische Überlegung herausfordert und uns vor allem
immer wieder daran erinnert, daß das Kunstwerk Kunstwerk ist, nicht
ein beliebiges historisches Objekt, — Fluch, weil sie eine schwer er-
trägliche Unsicherheit und Zersplitterung in die Forschung hinein-
tragen mußte, und weil das Streben nach der Aufdeckung von Ge-
setzmäßigkeiten vielfach zu Resultaten geführt hat, die entweder mit
dem Ernste einer wissenschaftlichen Anschauung nicht zu vereinen
sind oder aber dem Einzigkeitswert des individuellen Kunstwerkes zu
nahe zu treten scheinen: zu einem puritanischen Rationalismus im
Sinne der normativen Ästhetik, zu einem Völker- oder einzelpsycho-
logischen Empirismus im Sinne der Leipziger Schule und der zahl-
reichen Theoretiker des »künstlerischen Schaffensprozesses«, zu einer
willkürlich konstruktiven Spekulation im Sinne Worringers oder zu
unklarer Begriffsverschlingung im Sinne Burgers. Kein Wunder daher,
wenn nicht die Schlechtesten unter den neueren Methodologen der
Kunstwissenschaft, skeptisch geworden, endgültig das einzige Heil in
der rein historischen Betrachtungsweise erblickten1) — kein Wunder
aber auch, wenn auf der anderen Seite Forscher auftraten, die sich
mit Gewissenhaftigkeit, philosophischem Kritizismus und auf Grund
umfassendster Materialkenntnis der Aufgabe unterzogen, trotz allem
zur mehr-als-phänomenalen Erfassung der Kunsterscheinungen vorzu-
dringen.
Der bedeutendste Vertreter dieser ernsten Kunstphilosophie dürfte
Alois Riegl sein. Durch seine zeitliche Stellung sah dieser große Forscher
sich jedoch genötigt, bevor er sich der Erkenntnis der dem künstle-
rischen Schaffen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zuwenden
konnte, zunächst die dabei vorauszusetzende, zu seiner Zeit aber durch-
aus nicht anerkannte Autonomie desselben gegenüber den vielfältigen
') Hans Tietze, Die Methode der Kunstgeschichte, 1913.
(und berührt sich insofern mit der Erkenntnis), als ihre Leistungen
nicht Äußerungen von Subjekten darstellen, sondern Formungen von
Stoffen, nicht Begebenheiten, sondern Ergebnisse. Und damit erhebt
sich vor der Kunstbetrachtung die Forderung — die auf philosophi-
schem Gebiete durch die Erkenntnistheorie befriedigt wird —, ein
Erklärungsprinzip zu finden, auf Grund dessen das künstlerische Phä-
nomen nicht nur durch immer weitere Verweisungen an andere Phä-
nomene in seiner Existenz begriffen, sondern auch durch eine
unter die Sphäre des empirischen Daseins hinabtauchende Besinnung
in den Bedingungen seiner Existenz erkannt werden kann.
Diese Forderung bedeutet, wie gesagt, Fluch und Segen: Segen,
weil sie die Kunstwissenschaft in einer dauernden Spannung erhält,
ständig die methodologische Überlegung herausfordert und uns vor allem
immer wieder daran erinnert, daß das Kunstwerk Kunstwerk ist, nicht
ein beliebiges historisches Objekt, — Fluch, weil sie eine schwer er-
trägliche Unsicherheit und Zersplitterung in die Forschung hinein-
tragen mußte, und weil das Streben nach der Aufdeckung von Ge-
setzmäßigkeiten vielfach zu Resultaten geführt hat, die entweder mit
dem Ernste einer wissenschaftlichen Anschauung nicht zu vereinen
sind oder aber dem Einzigkeitswert des individuellen Kunstwerkes zu
nahe zu treten scheinen: zu einem puritanischen Rationalismus im
Sinne der normativen Ästhetik, zu einem Völker- oder einzelpsycho-
logischen Empirismus im Sinne der Leipziger Schule und der zahl-
reichen Theoretiker des »künstlerischen Schaffensprozesses«, zu einer
willkürlich konstruktiven Spekulation im Sinne Worringers oder zu
unklarer Begriffsverschlingung im Sinne Burgers. Kein Wunder daher,
wenn nicht die Schlechtesten unter den neueren Methodologen der
Kunstwissenschaft, skeptisch geworden, endgültig das einzige Heil in
der rein historischen Betrachtungsweise erblickten1) — kein Wunder
aber auch, wenn auf der anderen Seite Forscher auftraten, die sich
mit Gewissenhaftigkeit, philosophischem Kritizismus und auf Grund
umfassendster Materialkenntnis der Aufgabe unterzogen, trotz allem
zur mehr-als-phänomenalen Erfassung der Kunsterscheinungen vorzu-
dringen.
Der bedeutendste Vertreter dieser ernsten Kunstphilosophie dürfte
Alois Riegl sein. Durch seine zeitliche Stellung sah dieser große Forscher
sich jedoch genötigt, bevor er sich der Erkenntnis der dem künstle-
rischen Schaffen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zuwenden
konnte, zunächst die dabei vorauszusetzende, zu seiner Zeit aber durch-
aus nicht anerkannte Autonomie desselben gegenüber den vielfältigen
') Hans Tietze, Die Methode der Kunstgeschichte, 1913.