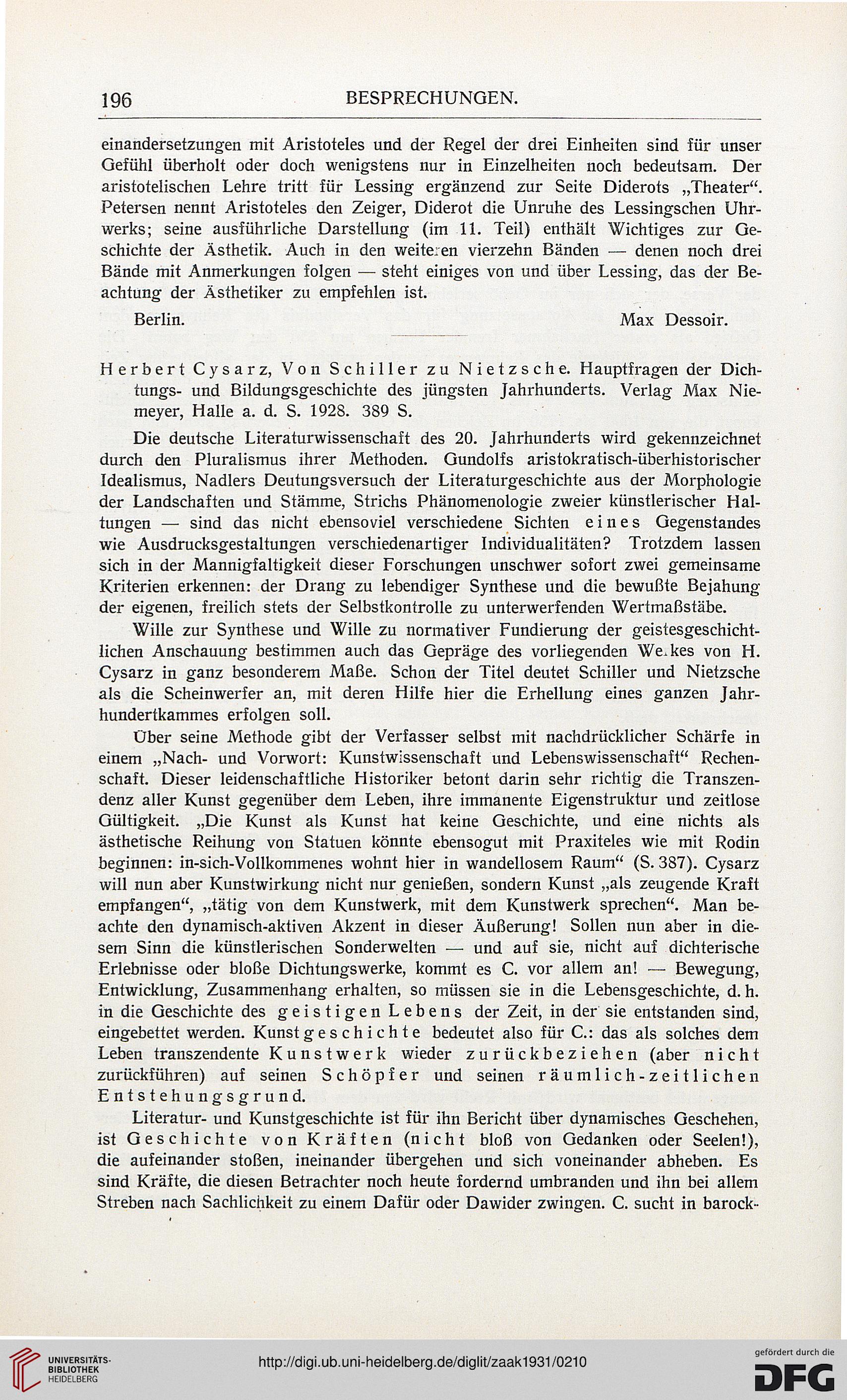196
BESPRECHUNGEN.
einandersetzungen mit Aristoteles und der Regel der drei Einheiten sind für unser
Gefühl überholt oder doch wenigstens nur in Einzelheiten noch bedeutsam. Der
aristotelischen Lehre tritt für Lessing ergänzend zur Seite Diderots „Theater".
Petersen nennt Aristoteles den Zeiger, Diderot die Unruhe des Lessingschen Uhr-
werks; seine ausführliche Darstellung (im 11. Teil) enthält Wichtiges zur Ge-
schichte der Ästhetik. Auch in den weiteren vierzehn Bänden — denen noch drei
Bände mit Anmerkungen folgen — steht einiges von und über Lessing, das der Be-
achtung der Ästhetiker zu empfehlen ist.
Berlin. Max Dessoir.
Herbert Cysarz, Von Schiller zu Nietzsche. Hauptfragen der Dich-
tungs- und Bildungsgeschichte des jüngsten Jahrhunderts. Verlag Max Nie-
meyer, Halle a. d. S. 1928. 389 S.
Die deutsche Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts wird gekennzeichnet
durch den Pluralismus ihrer Methoden. Gundolfs aristokratisch-überhistorischer
Idealismus, Nadlers Deutungsversuch der Literaturgeschichte aus der Morphologie
der Landschaften und Stämme, Strichs Phänomenologie zweier künstlerischer Hal-
tungen — sind das nicht ebensoviel verschiedene Sichten eines Gegenstandes
wie Ausdrucksgestaltungen verschiedenartiger Individualitäten? Trotzdem lassen
sich in der Mannigfaltigkeit dieser Forschungen unschwer sofort zwei gemeinsame
Kriterien erkennen: der Drang zu lebendiger Synthese und die bewußte Bejahung
der eigenen, freilich stets der Selbstkontrolle zu unterwerfenden Wertmaßstäbe.
Wille zur Synthese und Wille zu normativer Fundierung der geistesgeschicht-
lichen Anschauung bestimmen auch das Gepräge des vorliegenden We.kes von H.
Cysarz in ganz besonderem Maße. Schon der Titel deutet Schiller und Nietzsche
als die Scheinwerfer an, mit deren Hilfe hier die Erhellung eines ganzen Jahr-
hundertkammes erfolgen soll.
Ober seine Methode gibt der Verfasser selbst mit nachdrücklicher Schärfe in
einem „Nach- und Vorwort: Kunstwissenschaft und Lebenswissenschaft" Rechen-
schaft. Dieser leidenschaftliche Historiker betont darin sehr richtig die Transzen-
denz aller Kunst gegenüber dem Leben, ihre immanente Eigenstruktur und zeitlose
Gültigkeit. „Die Kunst als Kunst hat keine Geschichte, und eine nichts als
ästhetische Reihung von Statuen könnte ebensogut mit Praxiteles wie mit Rodin
beginnen: in-sich-Vollkommenes wohnt hier in wandellosem Raum" (S. 387). Cysarz
will nun aber Kunstwirkung nicht nur genießen, sondern Kunst „als zeugende Kraft
empfangen", „tätig von dem Kunstwerk, mit dem Kunstwerk sprechen". Man be-
achte den dynamisch-aktiven Akzent in dieser Äußerung! Sollen nun aber in die-
sem Sinn die künstlerischen Sonderwelten — und auf sie, nicht auf dichterische
Erlebnisse oder bloße Dichtungswerke, kommt es C. vor allem an! — Bewegung,
Entwicklung, Zusammenhang erhalten, so müssen sie in die Lebensgeschichte, d. h.
in die Geschichte des geistigen Lebens der Zeit, in der sie entstanden sind,
eingebettet werden. Kunstgeschichte bedeutet also für C: das als solches dem
Leben transzendente Kunstwerk wieder zurückbeziehen (aber nicht
zurückführen) auf seinen Schöpfer und seinen räumlich-zeitlichen
Entstehungsgrund.
Literatur- und Kunstgeschichte ist für ihn Bericht über dynamisches Geschehen,
ist Geschichte von Kräften (nicht bloß von Gedanken oder Seelen!),
die aufeinander stoßen, ineinander übergehen und sich voneinander abheben. Es
sind Kräfte, die diesen Betrachter noch heute fordernd umbranden und ihn bei allem
Streben nach Sachlichkeit zu einem Dafür oder Dawider zwingen. C. sucht in barock-
BESPRECHUNGEN.
einandersetzungen mit Aristoteles und der Regel der drei Einheiten sind für unser
Gefühl überholt oder doch wenigstens nur in Einzelheiten noch bedeutsam. Der
aristotelischen Lehre tritt für Lessing ergänzend zur Seite Diderots „Theater".
Petersen nennt Aristoteles den Zeiger, Diderot die Unruhe des Lessingschen Uhr-
werks; seine ausführliche Darstellung (im 11. Teil) enthält Wichtiges zur Ge-
schichte der Ästhetik. Auch in den weiteren vierzehn Bänden — denen noch drei
Bände mit Anmerkungen folgen — steht einiges von und über Lessing, das der Be-
achtung der Ästhetiker zu empfehlen ist.
Berlin. Max Dessoir.
Herbert Cysarz, Von Schiller zu Nietzsche. Hauptfragen der Dich-
tungs- und Bildungsgeschichte des jüngsten Jahrhunderts. Verlag Max Nie-
meyer, Halle a. d. S. 1928. 389 S.
Die deutsche Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts wird gekennzeichnet
durch den Pluralismus ihrer Methoden. Gundolfs aristokratisch-überhistorischer
Idealismus, Nadlers Deutungsversuch der Literaturgeschichte aus der Morphologie
der Landschaften und Stämme, Strichs Phänomenologie zweier künstlerischer Hal-
tungen — sind das nicht ebensoviel verschiedene Sichten eines Gegenstandes
wie Ausdrucksgestaltungen verschiedenartiger Individualitäten? Trotzdem lassen
sich in der Mannigfaltigkeit dieser Forschungen unschwer sofort zwei gemeinsame
Kriterien erkennen: der Drang zu lebendiger Synthese und die bewußte Bejahung
der eigenen, freilich stets der Selbstkontrolle zu unterwerfenden Wertmaßstäbe.
Wille zur Synthese und Wille zu normativer Fundierung der geistesgeschicht-
lichen Anschauung bestimmen auch das Gepräge des vorliegenden We.kes von H.
Cysarz in ganz besonderem Maße. Schon der Titel deutet Schiller und Nietzsche
als die Scheinwerfer an, mit deren Hilfe hier die Erhellung eines ganzen Jahr-
hundertkammes erfolgen soll.
Ober seine Methode gibt der Verfasser selbst mit nachdrücklicher Schärfe in
einem „Nach- und Vorwort: Kunstwissenschaft und Lebenswissenschaft" Rechen-
schaft. Dieser leidenschaftliche Historiker betont darin sehr richtig die Transzen-
denz aller Kunst gegenüber dem Leben, ihre immanente Eigenstruktur und zeitlose
Gültigkeit. „Die Kunst als Kunst hat keine Geschichte, und eine nichts als
ästhetische Reihung von Statuen könnte ebensogut mit Praxiteles wie mit Rodin
beginnen: in-sich-Vollkommenes wohnt hier in wandellosem Raum" (S. 387). Cysarz
will nun aber Kunstwirkung nicht nur genießen, sondern Kunst „als zeugende Kraft
empfangen", „tätig von dem Kunstwerk, mit dem Kunstwerk sprechen". Man be-
achte den dynamisch-aktiven Akzent in dieser Äußerung! Sollen nun aber in die-
sem Sinn die künstlerischen Sonderwelten — und auf sie, nicht auf dichterische
Erlebnisse oder bloße Dichtungswerke, kommt es C. vor allem an! — Bewegung,
Entwicklung, Zusammenhang erhalten, so müssen sie in die Lebensgeschichte, d. h.
in die Geschichte des geistigen Lebens der Zeit, in der sie entstanden sind,
eingebettet werden. Kunstgeschichte bedeutet also für C: das als solches dem
Leben transzendente Kunstwerk wieder zurückbeziehen (aber nicht
zurückführen) auf seinen Schöpfer und seinen räumlich-zeitlichen
Entstehungsgrund.
Literatur- und Kunstgeschichte ist für ihn Bericht über dynamisches Geschehen,
ist Geschichte von Kräften (nicht bloß von Gedanken oder Seelen!),
die aufeinander stoßen, ineinander übergehen und sich voneinander abheben. Es
sind Kräfte, die diesen Betrachter noch heute fordernd umbranden und ihn bei allem
Streben nach Sachlichkeit zu einem Dafür oder Dawider zwingen. C. sucht in barock-