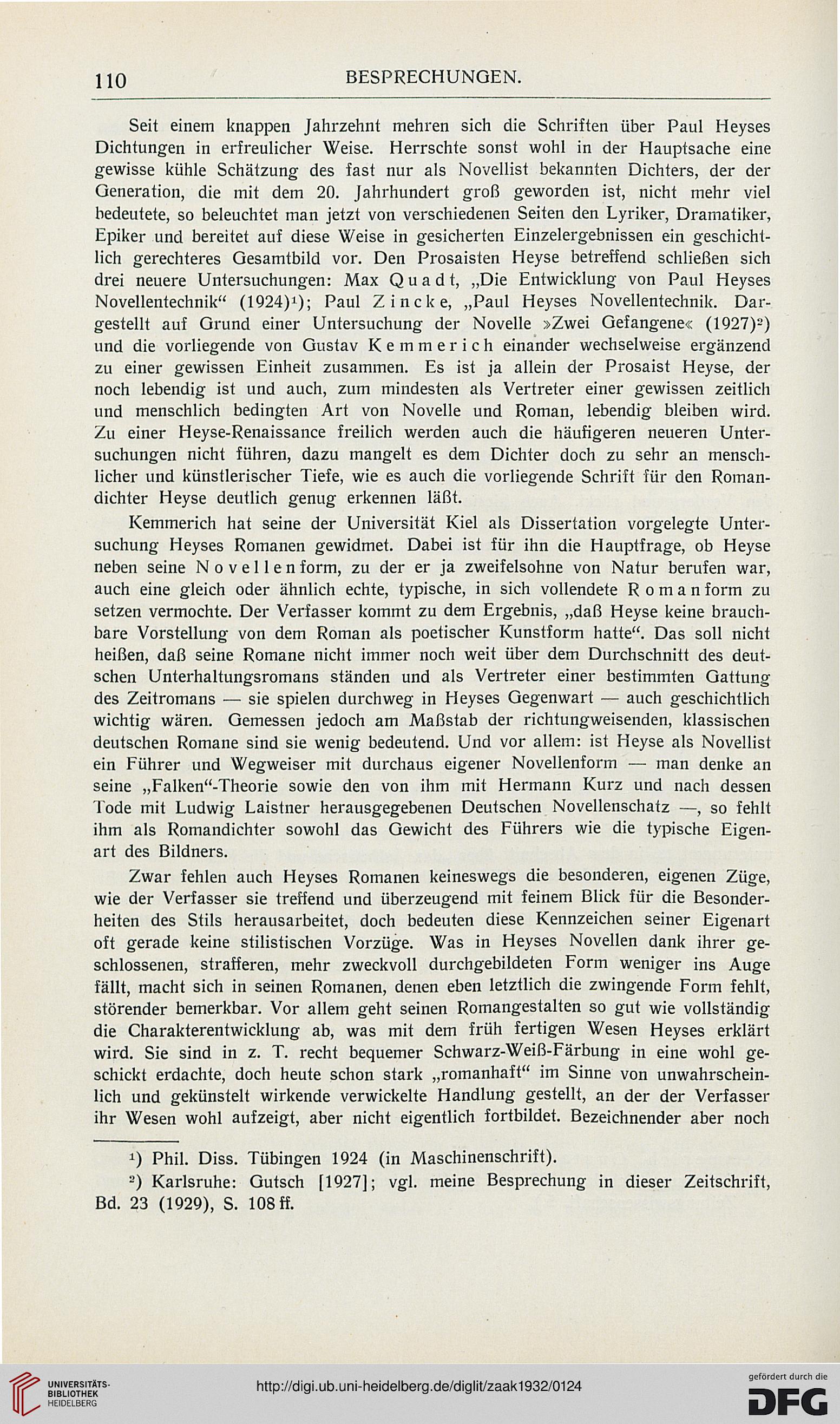110
BESPRECHUNGEN.
Seit einem knappen Jahrzehnt mehren sich die Schriften über Paul Heyses
Dichtungen in erfreulicher Weise. Herrschte sonst wohl in der Hauptsache eine
gewisse kühle Schätzung des fast nur als Novellist bekannten Dichters, der der
Generation, die mit dem 20. Jahrhundert groß geworden ist, nicht mehr viel
bedeutete, so beleuchtet man jetzt von verschiedenen Seiten den Lyriker, Dramatiker,
Epiker und bereitet auf diese Weise in gesicherten Einzelergebnissen ein geschicht-
lich gerechteres Gesamtbild vor. Den Prosaisten Heyse betreffend schließen sich
drei neuere Untersuchungen: Max Q u a d t, „Die Entwicklung von Paul Heyses
Novellentechnik" (1924)1); Paul Zincke, „Paul Heyses Novellentechnik. Dar-
gestellt auf Grund einer Untersuchung der Novelle »Zwei Gefangene« (1927)-)
und die vorliegende von Gustav Kemmerich einander wechselweise ergänzend
zu einer gewissen Einheit zusammen. Es ist ja allein der Prosaist Heyse, der
noch lebendig ist und auch, zum mindesten als Vertreter einer gewissen zeitlich
und menschlich bedingten Art von Novelle und Roman, lebendig bleiben wird.
Zu einer Heyse-Renaissance freilich werden auch die häufigeren neueren Unter-
suchungen nicht führen, dazu mangelt es dem Dichter doch zu sehr an mensch-
licher und künstlerischer Tiefe, wie es auch die vorliegende Schrift für den Roman-
dichter Heyse deutlich genug erkennen läßt.
Kemmerich hat seine der Universität Kiel als Dissertation vorgelegte Unter-
suchung Heyses Romanen gewidmet. Dabei ist für ihn die Hauptfrage, ob Heyse
neben seine Novellen form, zu der er ja zweifelsohne von Natur berufen war,
auch eine gleich oder ähnlich echte, typische, in sich vollendete Roman form zu
setzen vermochte. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, „daß Heyse keine brauch-
bare Vorstellung von dem Roman als poetischer Kunstform hatte". Das soll nicht
heißen, daß seine Romane nicht immer noch weit über dem Durchschnitt des deut-
schen Unterhaltungsromans ständen und als Vertreter einer bestimmten Gattung
des Zeitromans — sie spielen durchweg in Heyses Gegenwart — auch geschichtlich
wichtig wären. Gemessen jedoch am Maßstab der richtungweisenden, klassischen
deutschen Romane sind sie wenig bedeutend. Und vor allem: ist Heyse als Novellist
ein Führer und Wegweiser mit durchaus eigener Novellenform — man denke an
seine „Falken"-Theorie sowie den von ihm mit Hermann Kurz und nach dessen
Tode mit Ludwig Laistner herausgegebenen Deutschen Novellenschatz —, so fehlt
ihm als Romandichter sowohl das Gewicht des Führers wie die typische Eigen-
art des Bildners.
Zwar fehlen auch Heyses Romanen keineswegs die besonderen, eigenen Züge,
wie der Verfasser sie treffend und überzeugend mit feinem Blick für die Besonder-
heiten des Stils herausarbeitet, doch bedeuten diese Kennzeichen seiner Eigenart
oft gerade keine stilistischen Vorzüge. Was in Heyses Novellen dank ihrer ge-
schlossenen, strafferen, mehr zweckvoll durchgebildeten Form weniger ins Auge
fällt, macht sich in seinen Romanen, denen eben letztlich die zwingende Form fehlt,
störender bemerkbar. Vor allem geht seinen Romangestalten so gut wie vollständig
die Charakterentwicklung ab, was mit dem früh fertigen Wesen Heyses erklärt
wird. Sie sind in z. T. recht bequemer Schwarz-Weiß-Färbung in eine wohl ge-
schickt erdachte, doch heute schon stark „romanhaft" im Sinne von unwahrschein-
lich und gekünstelt wirkende verwickelte Handlung gestellt, an der der Verfasser
ihr Wesen wohl aufzeigt, aber nicht eigentlich fortbildet. Bezeichnender aber noch
J) Phil. Diss. Tübingen 1924 (in Maschinenschrift).
-) Karlsruhe: Gutsch [1927]; vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift,
Bd. 23 (1929), S. 108 ff.
BESPRECHUNGEN.
Seit einem knappen Jahrzehnt mehren sich die Schriften über Paul Heyses
Dichtungen in erfreulicher Weise. Herrschte sonst wohl in der Hauptsache eine
gewisse kühle Schätzung des fast nur als Novellist bekannten Dichters, der der
Generation, die mit dem 20. Jahrhundert groß geworden ist, nicht mehr viel
bedeutete, so beleuchtet man jetzt von verschiedenen Seiten den Lyriker, Dramatiker,
Epiker und bereitet auf diese Weise in gesicherten Einzelergebnissen ein geschicht-
lich gerechteres Gesamtbild vor. Den Prosaisten Heyse betreffend schließen sich
drei neuere Untersuchungen: Max Q u a d t, „Die Entwicklung von Paul Heyses
Novellentechnik" (1924)1); Paul Zincke, „Paul Heyses Novellentechnik. Dar-
gestellt auf Grund einer Untersuchung der Novelle »Zwei Gefangene« (1927)-)
und die vorliegende von Gustav Kemmerich einander wechselweise ergänzend
zu einer gewissen Einheit zusammen. Es ist ja allein der Prosaist Heyse, der
noch lebendig ist und auch, zum mindesten als Vertreter einer gewissen zeitlich
und menschlich bedingten Art von Novelle und Roman, lebendig bleiben wird.
Zu einer Heyse-Renaissance freilich werden auch die häufigeren neueren Unter-
suchungen nicht führen, dazu mangelt es dem Dichter doch zu sehr an mensch-
licher und künstlerischer Tiefe, wie es auch die vorliegende Schrift für den Roman-
dichter Heyse deutlich genug erkennen läßt.
Kemmerich hat seine der Universität Kiel als Dissertation vorgelegte Unter-
suchung Heyses Romanen gewidmet. Dabei ist für ihn die Hauptfrage, ob Heyse
neben seine Novellen form, zu der er ja zweifelsohne von Natur berufen war,
auch eine gleich oder ähnlich echte, typische, in sich vollendete Roman form zu
setzen vermochte. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, „daß Heyse keine brauch-
bare Vorstellung von dem Roman als poetischer Kunstform hatte". Das soll nicht
heißen, daß seine Romane nicht immer noch weit über dem Durchschnitt des deut-
schen Unterhaltungsromans ständen und als Vertreter einer bestimmten Gattung
des Zeitromans — sie spielen durchweg in Heyses Gegenwart — auch geschichtlich
wichtig wären. Gemessen jedoch am Maßstab der richtungweisenden, klassischen
deutschen Romane sind sie wenig bedeutend. Und vor allem: ist Heyse als Novellist
ein Führer und Wegweiser mit durchaus eigener Novellenform — man denke an
seine „Falken"-Theorie sowie den von ihm mit Hermann Kurz und nach dessen
Tode mit Ludwig Laistner herausgegebenen Deutschen Novellenschatz —, so fehlt
ihm als Romandichter sowohl das Gewicht des Führers wie die typische Eigen-
art des Bildners.
Zwar fehlen auch Heyses Romanen keineswegs die besonderen, eigenen Züge,
wie der Verfasser sie treffend und überzeugend mit feinem Blick für die Besonder-
heiten des Stils herausarbeitet, doch bedeuten diese Kennzeichen seiner Eigenart
oft gerade keine stilistischen Vorzüge. Was in Heyses Novellen dank ihrer ge-
schlossenen, strafferen, mehr zweckvoll durchgebildeten Form weniger ins Auge
fällt, macht sich in seinen Romanen, denen eben letztlich die zwingende Form fehlt,
störender bemerkbar. Vor allem geht seinen Romangestalten so gut wie vollständig
die Charakterentwicklung ab, was mit dem früh fertigen Wesen Heyses erklärt
wird. Sie sind in z. T. recht bequemer Schwarz-Weiß-Färbung in eine wohl ge-
schickt erdachte, doch heute schon stark „romanhaft" im Sinne von unwahrschein-
lich und gekünstelt wirkende verwickelte Handlung gestellt, an der der Verfasser
ihr Wesen wohl aufzeigt, aber nicht eigentlich fortbildet. Bezeichnender aber noch
J) Phil. Diss. Tübingen 1924 (in Maschinenschrift).
-) Karlsruhe: Gutsch [1927]; vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift,
Bd. 23 (1929), S. 108 ff.