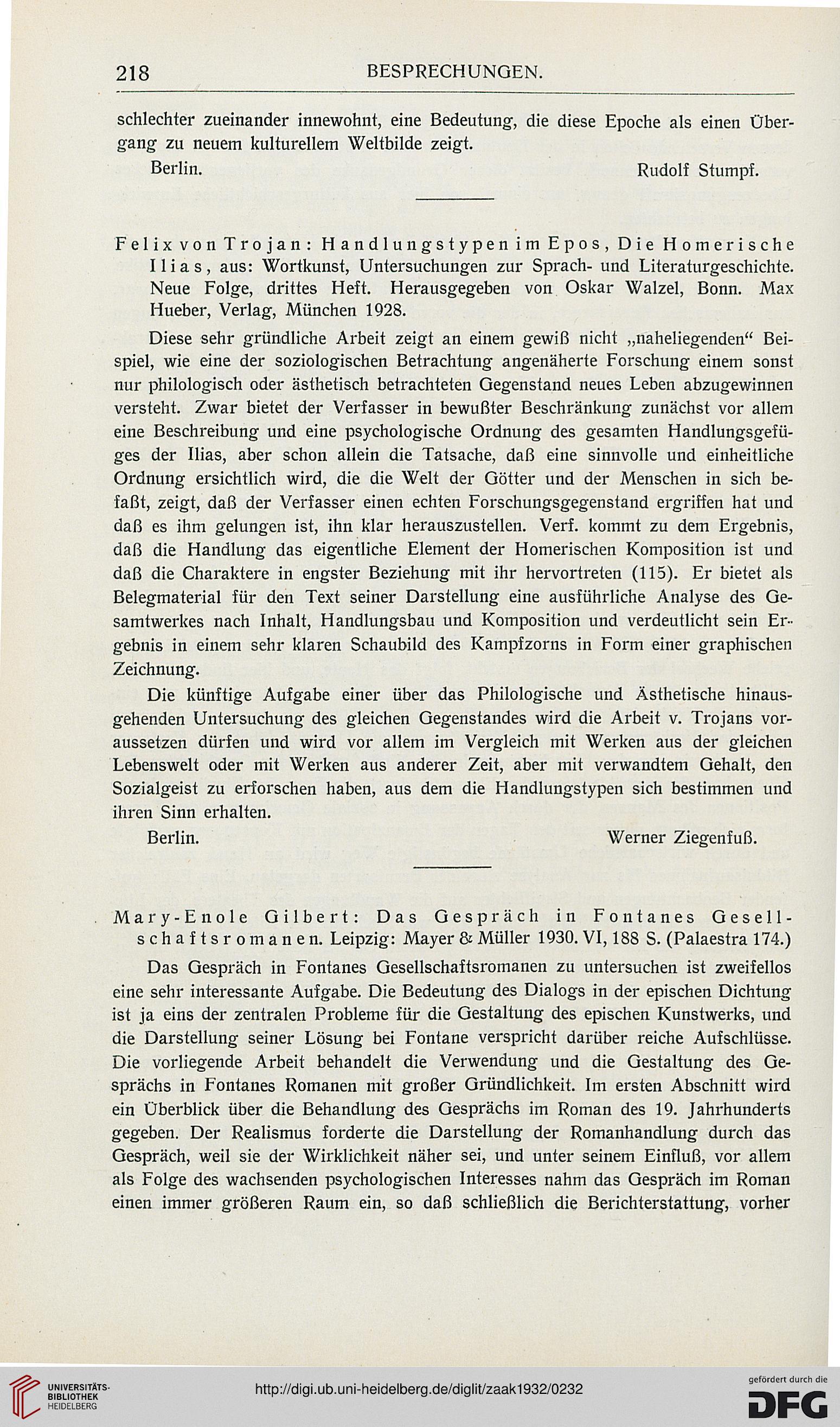218
BESPRECHUNGEN.
schlechter zueinander innewohnt, eine Bedeutung', die diese Epoche als einen Über-
gang zu neuem kulturellem Weltbilde zeigt.
Berlin. Rudolf Stumpf.
Felix von Trojan: Handlungstypen im Epos, Die Homerische
Ilias, aus: Wortkunst, Untersuchungen zur Sprach- und Literaturgeschichte.
Neue Folge, drittes Heft. Herausgegeben von Oskar Walzel, Bonn. Max
Hueber, Verlag, München 1928.
Diese sehr gründliche Arbeit zeigt an einem gewiß nicht „naheliegenden" Bei-
spiel, wie eine der soziologischen Betrachtung angenäherte Forschung einem sonst
nur philologisch oder ästhetisch betrachteten Gegenstand neues Leben abzugewinnen
versteht. Zwar bietet der Verfasser in bewußter Beschränkung zunächst vor allem
eine Beschreibung und eine psychologische Ordnung des gesamten Handlungsgefü-
ges der Ilias, aber schon allein die Tatsache, daß eine sinnvolle und einheitliche
Ordnung ersichtlich wird, die die Welt der Götter und der Menschen in sich be-
faßt, zeigt, daß der Verfasser einen echten Forschungsgegenstand ergriffen hat und
daß es ihm gelungen ist, ihn klar herauszustellen. Verf. kommt zu dem Ergebnis,
daß die Handlung das eigentliche Element der Homerischen Komposition ist und
daß die Charaktere in engster Beziehung mit ihr hervortreten (115). Er bietet als
Belegmaterial für den Text seiner Darstellung eine ausführliche Analyse des Ge-
samtwerkes nach Inhalt, Handlungsbau und Komposition und verdeutlicht sein Er-
gebnis in einem sehr klaren Schaubild des Kampfzorns in Form einer graphischen
Zeichnung.
Die künftige Aufgabe einer über das Philologische und Ästhetische hinaus-
gehenden Untersuchung des gleichen Gegenstandes wird die Arbeit v. Trojans vor-
aussetzen dürfen und wird vor allem im Vergleich mit Werken aus der gleichen
Lebenswelt oder mit Werken aus anderer Zeit, aber mit verwandtem Gehalt, den
Sozialgeist zu erforschen haben, aus dem die Handlungstypen sich bestimmen und
ihren Sinn erhalten.
Berlin. Werner Ziegenfuß.
Mary-Enole Gilbert: Das Gespräch in Fontanes Gesell-
schaftsromanen. Leipzig: Mayer & Müller 1930. VI, 188 S. (Palaestra 174.)
Das Gespräch in Fontanes Gesellschaftsromanen zu untersuchen ist zweifellos
eine sehr interessante Aufgabe. Die Bedeutung des Dialogs in der epischen Dichtung
ist ja eins der zentralen Probleme für die Gestaltung des epischen Kunstwerks, und
die Darstellung seiner Lösung bei Fontane verspricht darüber reiche Aufschlüsse.
Die vorliegende Arbeit behandelt die Verwendung und die Gestaltung des Ge-
sprächs in Fontanes Romanen mit großer Gründlichkeit. Im ersten Abschnitt wird
ein Überblick über die Behandlung des Gesprächs im Roman des 19. Jahrhunderts
gegeben. Der Realismus forderte die Darstellung der Romanhandlung durch das
Gespräch, weil sie der Wirklichkeit näher sei, und unter seinem Einfluß, vor allem
als Folge des wachsenden psychologischen Interesses nahm das Gespräch im Roman
einen immer größeren Raum ein, so daß schließlich die Berichterstattung, vorher
BESPRECHUNGEN.
schlechter zueinander innewohnt, eine Bedeutung', die diese Epoche als einen Über-
gang zu neuem kulturellem Weltbilde zeigt.
Berlin. Rudolf Stumpf.
Felix von Trojan: Handlungstypen im Epos, Die Homerische
Ilias, aus: Wortkunst, Untersuchungen zur Sprach- und Literaturgeschichte.
Neue Folge, drittes Heft. Herausgegeben von Oskar Walzel, Bonn. Max
Hueber, Verlag, München 1928.
Diese sehr gründliche Arbeit zeigt an einem gewiß nicht „naheliegenden" Bei-
spiel, wie eine der soziologischen Betrachtung angenäherte Forschung einem sonst
nur philologisch oder ästhetisch betrachteten Gegenstand neues Leben abzugewinnen
versteht. Zwar bietet der Verfasser in bewußter Beschränkung zunächst vor allem
eine Beschreibung und eine psychologische Ordnung des gesamten Handlungsgefü-
ges der Ilias, aber schon allein die Tatsache, daß eine sinnvolle und einheitliche
Ordnung ersichtlich wird, die die Welt der Götter und der Menschen in sich be-
faßt, zeigt, daß der Verfasser einen echten Forschungsgegenstand ergriffen hat und
daß es ihm gelungen ist, ihn klar herauszustellen. Verf. kommt zu dem Ergebnis,
daß die Handlung das eigentliche Element der Homerischen Komposition ist und
daß die Charaktere in engster Beziehung mit ihr hervortreten (115). Er bietet als
Belegmaterial für den Text seiner Darstellung eine ausführliche Analyse des Ge-
samtwerkes nach Inhalt, Handlungsbau und Komposition und verdeutlicht sein Er-
gebnis in einem sehr klaren Schaubild des Kampfzorns in Form einer graphischen
Zeichnung.
Die künftige Aufgabe einer über das Philologische und Ästhetische hinaus-
gehenden Untersuchung des gleichen Gegenstandes wird die Arbeit v. Trojans vor-
aussetzen dürfen und wird vor allem im Vergleich mit Werken aus der gleichen
Lebenswelt oder mit Werken aus anderer Zeit, aber mit verwandtem Gehalt, den
Sozialgeist zu erforschen haben, aus dem die Handlungstypen sich bestimmen und
ihren Sinn erhalten.
Berlin. Werner Ziegenfuß.
Mary-Enole Gilbert: Das Gespräch in Fontanes Gesell-
schaftsromanen. Leipzig: Mayer & Müller 1930. VI, 188 S. (Palaestra 174.)
Das Gespräch in Fontanes Gesellschaftsromanen zu untersuchen ist zweifellos
eine sehr interessante Aufgabe. Die Bedeutung des Dialogs in der epischen Dichtung
ist ja eins der zentralen Probleme für die Gestaltung des epischen Kunstwerks, und
die Darstellung seiner Lösung bei Fontane verspricht darüber reiche Aufschlüsse.
Die vorliegende Arbeit behandelt die Verwendung und die Gestaltung des Ge-
sprächs in Fontanes Romanen mit großer Gründlichkeit. Im ersten Abschnitt wird
ein Überblick über die Behandlung des Gesprächs im Roman des 19. Jahrhunderts
gegeben. Der Realismus forderte die Darstellung der Romanhandlung durch das
Gespräch, weil sie der Wirklichkeit näher sei, und unter seinem Einfluß, vor allem
als Folge des wachsenden psychologischen Interesses nahm das Gespräch im Roman
einen immer größeren Raum ein, so daß schließlich die Berichterstattung, vorher