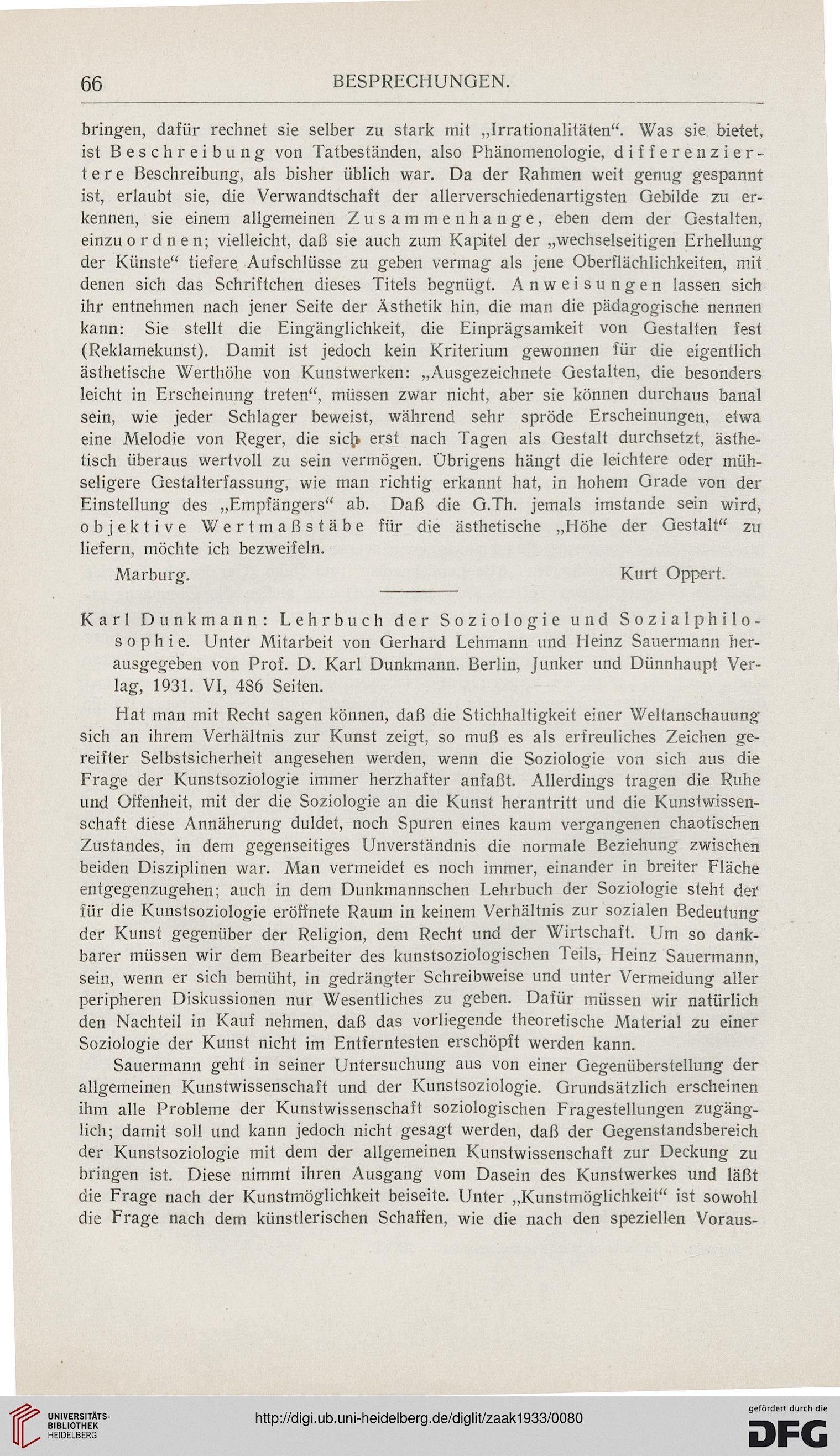66
BESPRECHUNGEN.
bringen, dafür rechnet sie selber zu stark mit „Irrationalitäten". Was sie bietet,
ist Beschreibung von Tatbeständen, also Phänomenologie, differenzier-
tere Beschreibung, als bisher üblich war. Da der Rahmen weit genug gespannt
ist, erlaubt sie, die Verwandtschaft der allerverschiedenartigsten Gebilde zu er-
kennen, sie einem allgemeinen Zusammenhange, eben dem der Gestalten,
einzuordnen; vielleicht, daß sie auch zum Kapitel der „wechselseitigen Erhellung
der Künste" tiefere Aufschlüsse zu geben vermag als jene Oberflächlichkeiten, mit
denen sich das Schriftchen dieses Titels begnügt. Anweisungen lassen sich
ihr entnehmen nach jener Seite der Ästhetik hin, die man die pädagogische nennen
kann: Sie stellt die Eingänglichkeit, die Einprägsamkeit von Gestalten fest
(Reklamekunst). Damit ist jedoch kein Kriterium gewonnen für die eigentlich
ästhetische Werthöhe von Kunstwerken: „Ausgezeichnete Gestalten, die besonders
leicht in Erscheinung treten", müssen zwar nicht, aber sie können durchaus banal
sein, wie jeder Schlager beweist, während sehr spröde Erscheinungen, etwa
eine Melodie von Reger, die sicj> erst nach Tagen als Gestalt durchsetzt, ästhe-
tisch überaus wertvoll zu sein vermögen. Übrigens hängt die leichtere oder müh-
seligere Gestalterfassung, wie man richtig erkannt hat, in hohem Grade von der
Einstellung des „Empfängers" ab. Daß die G.Th. jemals imstande sein wird,
objektive Wertmaßstäbe für die ästhetische „Höhe der Gestalt" zu
liefern, möchte ich bezweifeln.
Marburg. Kurt Oppert.
Karl Dunkmann: Lehrbuch der Soziologie und Sozialphilo-
sophie. Unter Mitarbeit von Gerhard Lehmann und Heinz Sauermann her-
ausgegeben von Prof. D. Karl Dunkmann. Berlin, Junker und Dünnhaupt Ver-
lag, 1931. VI, 486 Seiten.
Hat man mit Recht sagen können, daß die Stichhaltigkeit einer Weltanschauung
sich an ihrem Verhältnis zur Kunst zeigt, so muß es als erfreuliches Zeichen ge-
reifter Selbstsicherheit angesehen werden, wenn die Soziologie von sich aus die
Frage der Kunstsoziologie immer herzhafter anfaßt. Allerdings tragen die Ruhe
und Offenheit, mit der die Soziologie an die Kunst herantritt und die Kunstwissen-
schaft diese Annäherung duldet, noch Spuren eines kaum vergangenen chaotischen
Zustandes, in dem gegenseitiges Unverständnis die normale Beziehung zwischen
beiden Disziplinen war. Man vermeidet es noch immer, einander in breiter Fläche
entgegenzugehen; auch in dem Dunkmannschen Lehrbuch der Soziologie steht der
für die Kunstsoziologie eröffnete Raum in keinem Verhältnis zur sozialen Bedeutung
der Kunst gegenüber der Religion, dem Recht und der Wirtschaft. Um so dank-
barer müssen wir dem Bearbeiter des kunstsoziologischen Teils, Heinz Sauermann,
sein, wenn er sich bemüht, in gedrängter Schreibweise und unter Vermeidung aller
peripheren Diskussionen nur Wesentliches zu geben. Dafür müssen wir natürlich
den Nachteil in Kauf nehmen, daß das vorliegende theoretische Material zu einer
Soziologie der Kunst nicht im Entferntesten erschöpft werden kann.
Sauermann geht in seiner Untersuchung aus von einer Gegenüberstellung der
allgemeinen Kunstwissenschaft und der Kunstsoziologie. Grundsätzlich erscheinen
ihm alle Probleme der Kunstwissenschaft soziologischen Fragestellungen zugäng-
lich; damit soll und kann jedoch nicht gesagt werden, daß der Gegenstandsbereich
der Kunstsoziologie mit dem der allgemeinen Kunstwissenschaft zur Deckung zu
bringen ist. Diese nimmt ihren Ausgang vom Dasein des Kunstwerkes und läßt
die Frage nach der Kunstmöglichkeit beiseite. Unter „Kunstmöglichkeit" ist sowohl
die Frage nach dem künstlerischen Schaffen, wie die nach den speziellen Voraus-
BESPRECHUNGEN.
bringen, dafür rechnet sie selber zu stark mit „Irrationalitäten". Was sie bietet,
ist Beschreibung von Tatbeständen, also Phänomenologie, differenzier-
tere Beschreibung, als bisher üblich war. Da der Rahmen weit genug gespannt
ist, erlaubt sie, die Verwandtschaft der allerverschiedenartigsten Gebilde zu er-
kennen, sie einem allgemeinen Zusammenhange, eben dem der Gestalten,
einzuordnen; vielleicht, daß sie auch zum Kapitel der „wechselseitigen Erhellung
der Künste" tiefere Aufschlüsse zu geben vermag als jene Oberflächlichkeiten, mit
denen sich das Schriftchen dieses Titels begnügt. Anweisungen lassen sich
ihr entnehmen nach jener Seite der Ästhetik hin, die man die pädagogische nennen
kann: Sie stellt die Eingänglichkeit, die Einprägsamkeit von Gestalten fest
(Reklamekunst). Damit ist jedoch kein Kriterium gewonnen für die eigentlich
ästhetische Werthöhe von Kunstwerken: „Ausgezeichnete Gestalten, die besonders
leicht in Erscheinung treten", müssen zwar nicht, aber sie können durchaus banal
sein, wie jeder Schlager beweist, während sehr spröde Erscheinungen, etwa
eine Melodie von Reger, die sicj> erst nach Tagen als Gestalt durchsetzt, ästhe-
tisch überaus wertvoll zu sein vermögen. Übrigens hängt die leichtere oder müh-
seligere Gestalterfassung, wie man richtig erkannt hat, in hohem Grade von der
Einstellung des „Empfängers" ab. Daß die G.Th. jemals imstande sein wird,
objektive Wertmaßstäbe für die ästhetische „Höhe der Gestalt" zu
liefern, möchte ich bezweifeln.
Marburg. Kurt Oppert.
Karl Dunkmann: Lehrbuch der Soziologie und Sozialphilo-
sophie. Unter Mitarbeit von Gerhard Lehmann und Heinz Sauermann her-
ausgegeben von Prof. D. Karl Dunkmann. Berlin, Junker und Dünnhaupt Ver-
lag, 1931. VI, 486 Seiten.
Hat man mit Recht sagen können, daß die Stichhaltigkeit einer Weltanschauung
sich an ihrem Verhältnis zur Kunst zeigt, so muß es als erfreuliches Zeichen ge-
reifter Selbstsicherheit angesehen werden, wenn die Soziologie von sich aus die
Frage der Kunstsoziologie immer herzhafter anfaßt. Allerdings tragen die Ruhe
und Offenheit, mit der die Soziologie an die Kunst herantritt und die Kunstwissen-
schaft diese Annäherung duldet, noch Spuren eines kaum vergangenen chaotischen
Zustandes, in dem gegenseitiges Unverständnis die normale Beziehung zwischen
beiden Disziplinen war. Man vermeidet es noch immer, einander in breiter Fläche
entgegenzugehen; auch in dem Dunkmannschen Lehrbuch der Soziologie steht der
für die Kunstsoziologie eröffnete Raum in keinem Verhältnis zur sozialen Bedeutung
der Kunst gegenüber der Religion, dem Recht und der Wirtschaft. Um so dank-
barer müssen wir dem Bearbeiter des kunstsoziologischen Teils, Heinz Sauermann,
sein, wenn er sich bemüht, in gedrängter Schreibweise und unter Vermeidung aller
peripheren Diskussionen nur Wesentliches zu geben. Dafür müssen wir natürlich
den Nachteil in Kauf nehmen, daß das vorliegende theoretische Material zu einer
Soziologie der Kunst nicht im Entferntesten erschöpft werden kann.
Sauermann geht in seiner Untersuchung aus von einer Gegenüberstellung der
allgemeinen Kunstwissenschaft und der Kunstsoziologie. Grundsätzlich erscheinen
ihm alle Probleme der Kunstwissenschaft soziologischen Fragestellungen zugäng-
lich; damit soll und kann jedoch nicht gesagt werden, daß der Gegenstandsbereich
der Kunstsoziologie mit dem der allgemeinen Kunstwissenschaft zur Deckung zu
bringen ist. Diese nimmt ihren Ausgang vom Dasein des Kunstwerkes und läßt
die Frage nach der Kunstmöglichkeit beiseite. Unter „Kunstmöglichkeit" ist sowohl
die Frage nach dem künstlerischen Schaffen, wie die nach den speziellen Voraus-