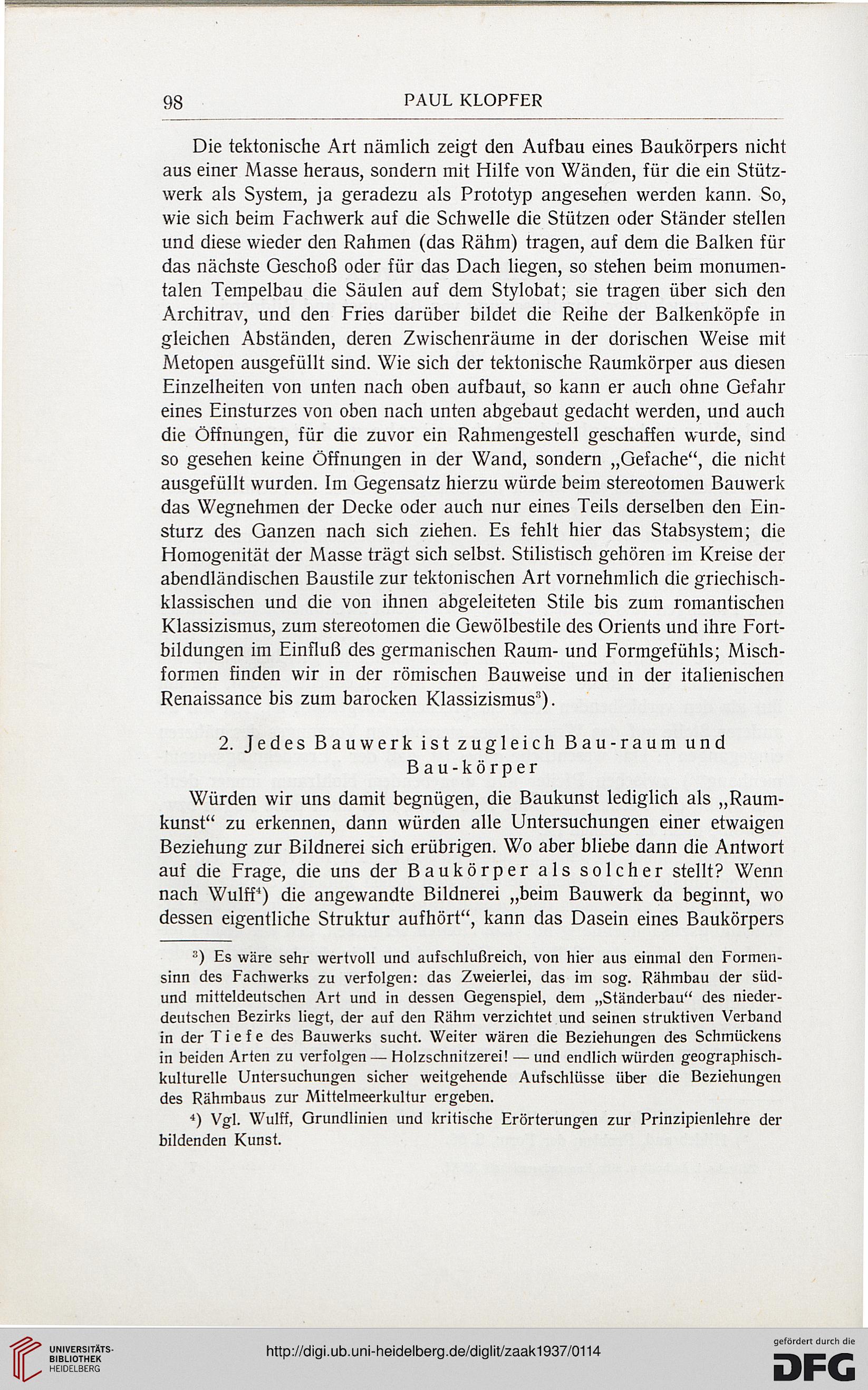98
PAUL KLOPFER
Die tektonische Art nämlich zeigt den Aufbau eines Baukörpers nicht
aus einer Masse heraus, sondern mit Hilfe von Wänden, für die ein Stütz-
werk als System, ja geradezu als Prototyp angesehen werden kann. So,
wie sich beim Fachwerk auf die Schwelle die Stützen oder Ständer stellen
und diese wieder den Rahmen (das Rähm) tragen, auf dem die Balken für
das nächste Geschoß oder für das Dach liegen, so stehen beim monumen-
talen Tempelbau die Säulen auf dem Stylobat; sie tragen über sich den
Architrav, und den Fries darüber bildet die Reihe der Balkenköpfe in
gleichen Abständen, deren Zwischenräume in der dorischen Weise mit
Metopen ausgefüllt sind. Wie sich der tektonische Raumkörper aus diesen
Einzelheiten von unten nach oben aufbaut, so kann er auch ohne Gefahr
eines Einsturzes von oben nach unten abgebaut gedacht werden, und auch
die Öffnungen, für die zuvor ein Rahmengestell geschaffen wurde, sind
so gesehen keine Öffnungen in der Wand, sondern „Gefache", die nicht
ausgefüllt wurden. Im Gegensatz hierzu würde beim stereotomen Bauwerk
das Wegnehmen der Decke oder auch nur eines Teils derselben den Ein-
sturz des Ganzen nach sich ziehen. Es fehlt hier das Stabsystem; die
Homogenität der Masse trägt sich selbst. Stilistisch gehören im Kreise der
abendländischen Baustile zur tektonischen Art vornehmlich die griechisch-
klassischen und die von ihnen abgeleiteten Stile bis zum romantischen
Klassizismus, zum stereotomen die Gewölbestile des Orients und ihre Fort-
bildungen im Einfluß des germanischen Raum- und Formgefühls; Misch-
formen finden wir in der römischen Bauweise und in der italienischen
Renaissance bis zum barocken Klassizismus'1).
2. Jedes Bauwerk ist zugleich Bau-raum und
Bau-körper
Würden wir uns damit begnügen, die Baukunst lediglich als „Raum-
kunst" zu erkennen, dann würden alle Untersuchungen einer etwaigen
Beziehung zur Bildnerei sich erübrigen. Wo aber bliebe dann die Antwort
auf die Frage, die uns der Baukörper als solcher stellt? Wenn
nach Wulff4) die angewandte Bildnerei „beim Bauwerk da beginnt, wo
dessen eigentliche Struktur aufhört", kann das Dasein eines Baukörpers
3) Es wäre sehr wertvoll und aufschlußreich, von hier aus einmal den Formen-
sinn des Fachwerks zu verfolgen: das Zweierlei, das im sog. Rähmbau der süd-
und mitteldeutschen Art und in dessen Gegenspiel, dem „Ständerbau" des nieder-
deutschen Bezirks liegt, der auf den Rähm verzichtet und seinen struktiven Verband
in der Tiefe des Bauwerks sucht. Weiter wären die Beziehungen des Schmückens
in beiden Arten zu verfolgen — Holzschnitzerei! — und endlich würden geographisch-
kulturelle Untersuchungen sicher weitgehende Aufschlüsse über die Beziehungen
des Rähmbaus zur Mittelmeerkultur ergeben.
4) Vgl. Wulff, Grundlinien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der
bildenden Kunst.
PAUL KLOPFER
Die tektonische Art nämlich zeigt den Aufbau eines Baukörpers nicht
aus einer Masse heraus, sondern mit Hilfe von Wänden, für die ein Stütz-
werk als System, ja geradezu als Prototyp angesehen werden kann. So,
wie sich beim Fachwerk auf die Schwelle die Stützen oder Ständer stellen
und diese wieder den Rahmen (das Rähm) tragen, auf dem die Balken für
das nächste Geschoß oder für das Dach liegen, so stehen beim monumen-
talen Tempelbau die Säulen auf dem Stylobat; sie tragen über sich den
Architrav, und den Fries darüber bildet die Reihe der Balkenköpfe in
gleichen Abständen, deren Zwischenräume in der dorischen Weise mit
Metopen ausgefüllt sind. Wie sich der tektonische Raumkörper aus diesen
Einzelheiten von unten nach oben aufbaut, so kann er auch ohne Gefahr
eines Einsturzes von oben nach unten abgebaut gedacht werden, und auch
die Öffnungen, für die zuvor ein Rahmengestell geschaffen wurde, sind
so gesehen keine Öffnungen in der Wand, sondern „Gefache", die nicht
ausgefüllt wurden. Im Gegensatz hierzu würde beim stereotomen Bauwerk
das Wegnehmen der Decke oder auch nur eines Teils derselben den Ein-
sturz des Ganzen nach sich ziehen. Es fehlt hier das Stabsystem; die
Homogenität der Masse trägt sich selbst. Stilistisch gehören im Kreise der
abendländischen Baustile zur tektonischen Art vornehmlich die griechisch-
klassischen und die von ihnen abgeleiteten Stile bis zum romantischen
Klassizismus, zum stereotomen die Gewölbestile des Orients und ihre Fort-
bildungen im Einfluß des germanischen Raum- und Formgefühls; Misch-
formen finden wir in der römischen Bauweise und in der italienischen
Renaissance bis zum barocken Klassizismus'1).
2. Jedes Bauwerk ist zugleich Bau-raum und
Bau-körper
Würden wir uns damit begnügen, die Baukunst lediglich als „Raum-
kunst" zu erkennen, dann würden alle Untersuchungen einer etwaigen
Beziehung zur Bildnerei sich erübrigen. Wo aber bliebe dann die Antwort
auf die Frage, die uns der Baukörper als solcher stellt? Wenn
nach Wulff4) die angewandte Bildnerei „beim Bauwerk da beginnt, wo
dessen eigentliche Struktur aufhört", kann das Dasein eines Baukörpers
3) Es wäre sehr wertvoll und aufschlußreich, von hier aus einmal den Formen-
sinn des Fachwerks zu verfolgen: das Zweierlei, das im sog. Rähmbau der süd-
und mitteldeutschen Art und in dessen Gegenspiel, dem „Ständerbau" des nieder-
deutschen Bezirks liegt, der auf den Rähm verzichtet und seinen struktiven Verband
in der Tiefe des Bauwerks sucht. Weiter wären die Beziehungen des Schmückens
in beiden Arten zu verfolgen — Holzschnitzerei! — und endlich würden geographisch-
kulturelle Untersuchungen sicher weitgehende Aufschlüsse über die Beziehungen
des Rähmbaus zur Mittelmeerkultur ergeben.
4) Vgl. Wulff, Grundlinien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der
bildenden Kunst.