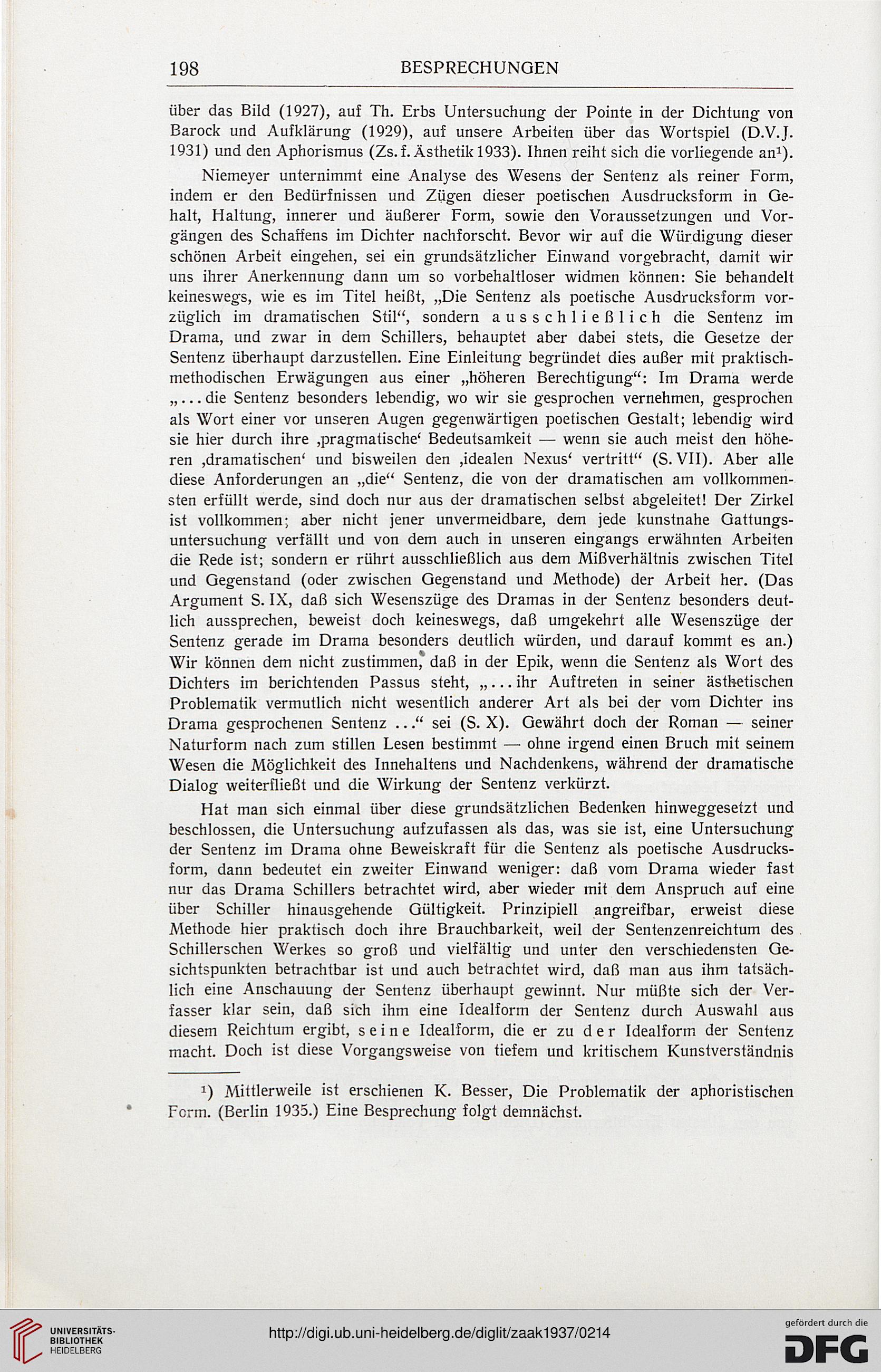198
BESPRECHUNGEN
über das Bild (1927), auf Th. Erbs Untersuchung der Pointe in der Dichtung von
Barock und Aufklärung (1929), auf unsere Arbeiten über das Wortspiel (D.V.J.
1931) und den Aphorismus (Zs. f. Ästhetik 1933). Ihnen reiht sich die vorliegende an1).
Niemeyer unternimmt eine Analyse des Wesens der Sentenz als reiner Form,
indem er den Bedürfnissen und Zügen dieser poetischen Ausdrucksform in Ge-
halt, Haltung, innerer und äußerer Form, sowie den Voraussetzungen und Vor-
gängen des Schaffens im Dichter nachforscht. Bevor wir auf die Würdigung dieser
schönen Arbeit eingehen, sei ein grundsätzlicher Einwand vorgebracht, damit wir
uns ihrer Anerkennung dann um so vorbehaltloser widmen können: Sie behandelt
keineswegs, wie es im Titel heißt, „Die Sentenz als poetische Ausdrucksform vor-
züglich im dramatischen Stil", sondern ausschließlich die Sentenz im
Drama, und zwar in dem Schillers, behauptet aber dabei stets, die Gesetze der
Sentenz überhaupt darzustellen. Eine Einleitung begründet dies außer mit praktisch-
methodischen Erwägungen aus einer „höheren Berechtigung": Im Drama werde
„... die Sentenz besonders lebendig, wo wir sie gesprochen vernehmen, gesprochen
als Wort einer vor unseren Augen gegenwärtigen poetischen Gestalt; lebendig wird
sie hier durch ihre pragmatische' Bedeutsamkeit — wenn sie auch meist den höhe-
ren dramatischen' und bisweilen den ,idealen Nexus' vertritt" (S. VII). Aber alle
diese Anforderungen an „die" Sentenz, die von der dramatischen am vollkommen-
sten erfüllt werde, sind doch nur aus der dramatischen selbst abgeleitet! Der Zirkel
ist vollkommen; aber nicht jener unvermeidbare, dem jede kunstnahe Gattungs-
untersuchung verfällt und von dem auch in unseren eingangs erwähnten Arbeiten
die Rede ist; sondern er rührt ausschließlich aus dem Mißverhältnis zwischen Titel
und Gegenstand (oder zwischen Gegenstand und Methode) der Arbeit her. (Das
Argument S. IX, daß sich Wesenszüge des Dramas in der Sentenz besonders deut-
lich aussprechen, beweist doch keineswegs, daß umgekehrt alle Wesenszüge der
Sentenz gerade im Drama besonders deutlich würden, und darauf kommt es an.)
Wir können dem nicht zustimmen, daß in der Epik, wenn die Sentenz als Wort des
Dichters im berichtenden Passus steht, „... ihr Auftreten in seiner ästhetischen
Problematik vermutlich nicht wesentlich anderer Art als bei der vom Dichter ins
Drama gesprochenen Sentenz ..." sei (S. X). Gewährt doch der Roman — seiner
Naturform nach zum stillen Lesen bestimmt — ohne irgend einen Bruch mit seinem
Wesen die Möglichkeit des Innehaltens und Nachdenkens, während der dramatische
Dialog weiterfließt und die Wirkung der Sentenz verkürzt.
Hat man sich einmal über diese grundsätzlichen Bedenken hinweggesetzt und
beschlossen, die Untersuchung aufzufassen als das, was sie ist, eine Untersuchung
der Sentenz im Drama ohne Beweiskraft für die Sentenz als poetische Ausdrucks-
form, dann bedeutet ein zweiter Einwand weniger: daß vom Drama wieder fast
nur das Drama Schillers betrachtet wird, aber wieder mit dem Anspruch auf eine
über Schiller hinausgehende Gültigkeit. Prinzipiell angreifbar, erweist diese
Methode hier praktisch doch ihre Brauchbarkeit, weil der Sentenzenreichtum des
Schillerschen Werkes so groß und vielfältig und unter den verschiedensten Ge-
sichtspunkten betrachtbar ist und auch betrachtet wird, daß man aus ihm tatsäch-
lich eine Anschauung der Sentenz überhaupt gewinnt. Nur müßte sich der Ver-
fasser klar sein, daß sich ihm eine Idealform der Sentenz durch Auswahl aus
diesem Reichtum ergibt, seine Idealform, die er zu der Idealform der Sentenz
macht. Doch ist diese Vorgangsweise von tiefem und kritischem Kunstverständnis
1) Mittlerweile ist erschienen K. Besser, Die Problematik der aphoristischen
Form. (Berlin 1935.) Eine Besprechung folgt demnächst.
BESPRECHUNGEN
über das Bild (1927), auf Th. Erbs Untersuchung der Pointe in der Dichtung von
Barock und Aufklärung (1929), auf unsere Arbeiten über das Wortspiel (D.V.J.
1931) und den Aphorismus (Zs. f. Ästhetik 1933). Ihnen reiht sich die vorliegende an1).
Niemeyer unternimmt eine Analyse des Wesens der Sentenz als reiner Form,
indem er den Bedürfnissen und Zügen dieser poetischen Ausdrucksform in Ge-
halt, Haltung, innerer und äußerer Form, sowie den Voraussetzungen und Vor-
gängen des Schaffens im Dichter nachforscht. Bevor wir auf die Würdigung dieser
schönen Arbeit eingehen, sei ein grundsätzlicher Einwand vorgebracht, damit wir
uns ihrer Anerkennung dann um so vorbehaltloser widmen können: Sie behandelt
keineswegs, wie es im Titel heißt, „Die Sentenz als poetische Ausdrucksform vor-
züglich im dramatischen Stil", sondern ausschließlich die Sentenz im
Drama, und zwar in dem Schillers, behauptet aber dabei stets, die Gesetze der
Sentenz überhaupt darzustellen. Eine Einleitung begründet dies außer mit praktisch-
methodischen Erwägungen aus einer „höheren Berechtigung": Im Drama werde
„... die Sentenz besonders lebendig, wo wir sie gesprochen vernehmen, gesprochen
als Wort einer vor unseren Augen gegenwärtigen poetischen Gestalt; lebendig wird
sie hier durch ihre pragmatische' Bedeutsamkeit — wenn sie auch meist den höhe-
ren dramatischen' und bisweilen den ,idealen Nexus' vertritt" (S. VII). Aber alle
diese Anforderungen an „die" Sentenz, die von der dramatischen am vollkommen-
sten erfüllt werde, sind doch nur aus der dramatischen selbst abgeleitet! Der Zirkel
ist vollkommen; aber nicht jener unvermeidbare, dem jede kunstnahe Gattungs-
untersuchung verfällt und von dem auch in unseren eingangs erwähnten Arbeiten
die Rede ist; sondern er rührt ausschließlich aus dem Mißverhältnis zwischen Titel
und Gegenstand (oder zwischen Gegenstand und Methode) der Arbeit her. (Das
Argument S. IX, daß sich Wesenszüge des Dramas in der Sentenz besonders deut-
lich aussprechen, beweist doch keineswegs, daß umgekehrt alle Wesenszüge der
Sentenz gerade im Drama besonders deutlich würden, und darauf kommt es an.)
Wir können dem nicht zustimmen, daß in der Epik, wenn die Sentenz als Wort des
Dichters im berichtenden Passus steht, „... ihr Auftreten in seiner ästhetischen
Problematik vermutlich nicht wesentlich anderer Art als bei der vom Dichter ins
Drama gesprochenen Sentenz ..." sei (S. X). Gewährt doch der Roman — seiner
Naturform nach zum stillen Lesen bestimmt — ohne irgend einen Bruch mit seinem
Wesen die Möglichkeit des Innehaltens und Nachdenkens, während der dramatische
Dialog weiterfließt und die Wirkung der Sentenz verkürzt.
Hat man sich einmal über diese grundsätzlichen Bedenken hinweggesetzt und
beschlossen, die Untersuchung aufzufassen als das, was sie ist, eine Untersuchung
der Sentenz im Drama ohne Beweiskraft für die Sentenz als poetische Ausdrucks-
form, dann bedeutet ein zweiter Einwand weniger: daß vom Drama wieder fast
nur das Drama Schillers betrachtet wird, aber wieder mit dem Anspruch auf eine
über Schiller hinausgehende Gültigkeit. Prinzipiell angreifbar, erweist diese
Methode hier praktisch doch ihre Brauchbarkeit, weil der Sentenzenreichtum des
Schillerschen Werkes so groß und vielfältig und unter den verschiedensten Ge-
sichtspunkten betrachtbar ist und auch betrachtet wird, daß man aus ihm tatsäch-
lich eine Anschauung der Sentenz überhaupt gewinnt. Nur müßte sich der Ver-
fasser klar sein, daß sich ihm eine Idealform der Sentenz durch Auswahl aus
diesem Reichtum ergibt, seine Idealform, die er zu der Idealform der Sentenz
macht. Doch ist diese Vorgangsweise von tiefem und kritischem Kunstverständnis
1) Mittlerweile ist erschienen K. Besser, Die Problematik der aphoristischen
Form. (Berlin 1935.) Eine Besprechung folgt demnächst.