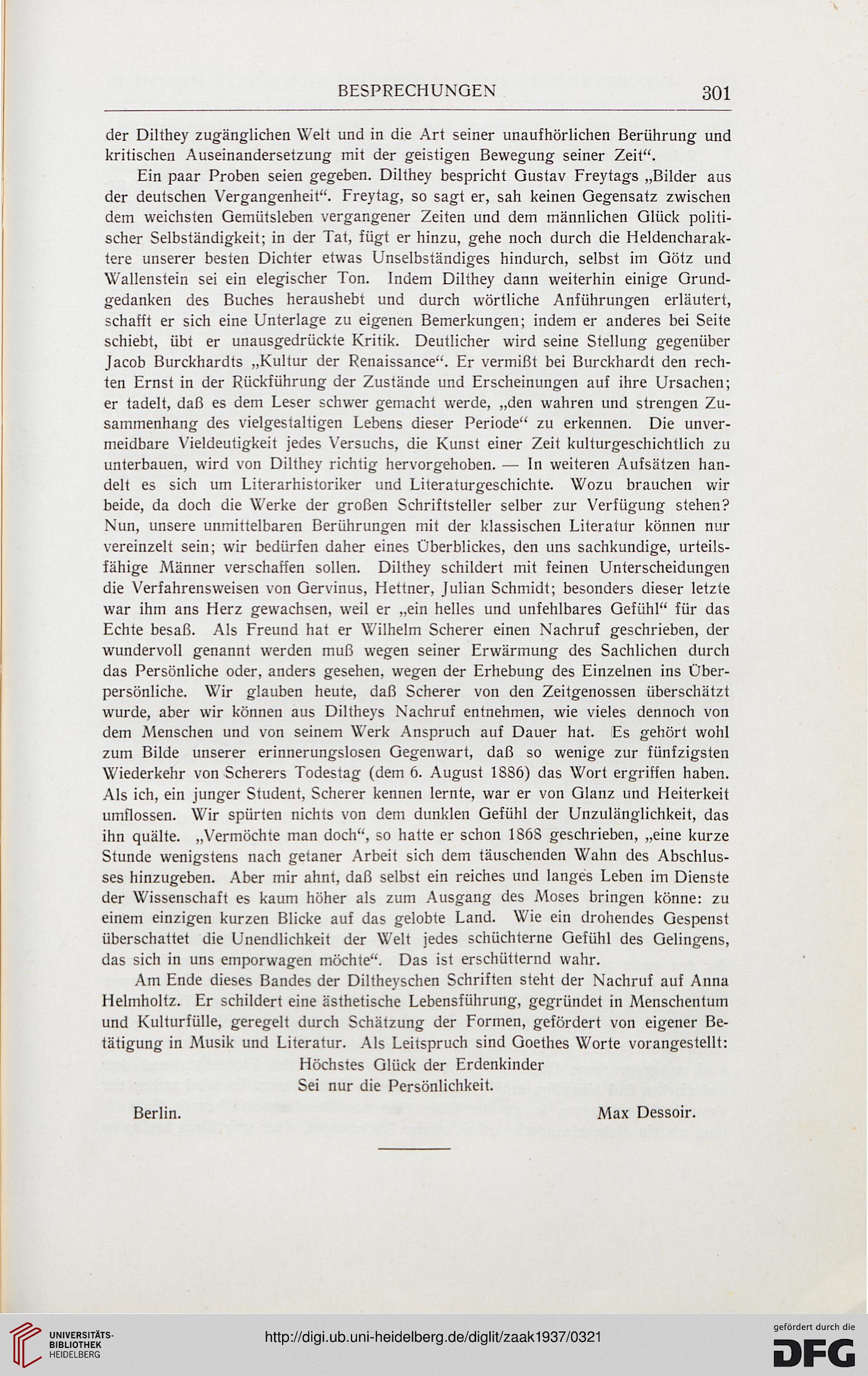BESPRECHUNGEN
301
der Dilthey zugänglichen Well und in die Art seiner unaufhörlichen Berührung und
kritischen Auseinandersetzung mit der geistigen Bewegung seiner Zeit".
Ein paar Proben seien gegeben. Dilthey bespricht Gustav Freytags „Bilder aus
der deutschen Vergangenheit". Freytag, so sagt er, sah keinen Gegensatz zwischen
dem weichsten Gemütsleben vergangener Zeiten und dem männlichen Glück politi-
scher Selbständigkeit; in der Tat, fügt er hinzu, gehe noch durch die Heldencharak-
tere unserer besten Dichter etwas Unselbständiges hindurch, selbst im Götz und
Wallenstein sei ein elegischer Ton. Indem Dilthey dann weiterhin einige Grund-
gedanken des Buches heraushebt und durch wörtliche Anführungen erläutert,
schafft er sich eine Unterlage zu eigenen Bemerkungen; indem er anderes bei Seite
schiebt, übt er unausgedrückte Kritik. Deutlicher wird seine Stellung gegenüber
Jacob Burckhardts „Kultur der Renaissance". Er vermißt bei Burckhardt den rech-
ten Ernst in der Rückführung der Zustände und Erscheinungen auf ihre Ursachen;
er tadelt, daß es dem Leser schwer gemacht werde, „den wahren und strengen Zu-
sammenhang des vielgestaltigen Lebens dieser Periode" zu erkennen. Die unver-
meidbare Vieldeutigkeit jedes Versuchs, die Kunst einer Zeit kulturgeschichtlich zu
unterbauen, wird von Dilthey richtig hervorgehoben. — In weiteren Aufsätzen han-
delt es sich um Literarhistoriker und Literaturgeschichte. Wozu brauchen wir
beide, da doch die Werke der großen Schriftsteller selber zur Verfügung stehen?
Nun, unsere unmittelbaren Berührungen mit der klassischen Literatur können nur
vereinzelt sein; wir bedürfen daher eines Überblickes, den uns sachkundige, urteils-
fähige Männer verschaffen sollen. Dilthey schildert mit feinen Unterscheidungen
die Verfahrensweisen von Gervinus, Hettner, Julian Schmidt; besonders dieser letzte
war ihm ans Herz gewachsen, weil er „ein helles und unfehlbares Gefühl" für das
Echte besaß. Als Freund hat er Wilhelm Scherer einen Nachruf geschrieben, der
wundervoll genannt werden muß wegen seiner Erwärmung des Sachlichen durch
das Persönliche oder, anders gesehen, wegen der Erhebung des Einzelnen ins Über-
persönliche. Wir glauben heute, daß Scherer von den Zeitgenossen überschätzt
wurde, aber wir können aus Diltheys Nachruf entnehmen, wie vieles dennoch von
dem Alenschen und von seinem Werk Anspruch auf Dauer hat. Es gehört wohl
zum Bilde unserer erinnerungslosen Gegenwart, daß so wenige zur fünfzigsten
Wiederkehr von Scherers Todestag (dem 6. August 1886) das Wort ergriffen haben.
Als ich, ein junger Student, Scherer kennen lernte, war er von Glanz und Heiterkeit
umflossen. Wir spürten nichts von dem dunklen Gefühl der Unzulänglichkeit, das
ihn quälte. „Vermöchte man doch", so hatte er schon 186S geschrieben, „eine kurze
Stunde wenigstens nach getaner Arbeit sich dem täuschenden Wahn des Abschlus-
ses hinzugeben. Aber mir ahnt, daß selbst ein reiches und langes Leben im Dienste
der Wissenschaft es kaum höher als zum Ausgang des Moses bringen könne: zu
einem einzigen kurzen Blicke auf das gelobte Land. Wie ein drohendes Gespenst
überschattet die Unendlichkeit der Welt jedes schüchterne Gefühl des Gelingens,
das sich in uns emporwagen möchte". Das ist erschütternd wahr.
Am Ende dieses Bandes der Diltheyschen Schriften steht der Nachruf auf Anna
Helmholtz. Er schildert eine ästhetische Lebensführung, gegründet in Menschentum
und Kulturfülle, geregelt durch Schätzung der Formen, gefördert von eigener Be-
tätigung in Musik und Literatur. Als Leitspruch sind Goethes Worte vorangestellt:
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
Berlin. Max Dessoir.
301
der Dilthey zugänglichen Well und in die Art seiner unaufhörlichen Berührung und
kritischen Auseinandersetzung mit der geistigen Bewegung seiner Zeit".
Ein paar Proben seien gegeben. Dilthey bespricht Gustav Freytags „Bilder aus
der deutschen Vergangenheit". Freytag, so sagt er, sah keinen Gegensatz zwischen
dem weichsten Gemütsleben vergangener Zeiten und dem männlichen Glück politi-
scher Selbständigkeit; in der Tat, fügt er hinzu, gehe noch durch die Heldencharak-
tere unserer besten Dichter etwas Unselbständiges hindurch, selbst im Götz und
Wallenstein sei ein elegischer Ton. Indem Dilthey dann weiterhin einige Grund-
gedanken des Buches heraushebt und durch wörtliche Anführungen erläutert,
schafft er sich eine Unterlage zu eigenen Bemerkungen; indem er anderes bei Seite
schiebt, übt er unausgedrückte Kritik. Deutlicher wird seine Stellung gegenüber
Jacob Burckhardts „Kultur der Renaissance". Er vermißt bei Burckhardt den rech-
ten Ernst in der Rückführung der Zustände und Erscheinungen auf ihre Ursachen;
er tadelt, daß es dem Leser schwer gemacht werde, „den wahren und strengen Zu-
sammenhang des vielgestaltigen Lebens dieser Periode" zu erkennen. Die unver-
meidbare Vieldeutigkeit jedes Versuchs, die Kunst einer Zeit kulturgeschichtlich zu
unterbauen, wird von Dilthey richtig hervorgehoben. — In weiteren Aufsätzen han-
delt es sich um Literarhistoriker und Literaturgeschichte. Wozu brauchen wir
beide, da doch die Werke der großen Schriftsteller selber zur Verfügung stehen?
Nun, unsere unmittelbaren Berührungen mit der klassischen Literatur können nur
vereinzelt sein; wir bedürfen daher eines Überblickes, den uns sachkundige, urteils-
fähige Männer verschaffen sollen. Dilthey schildert mit feinen Unterscheidungen
die Verfahrensweisen von Gervinus, Hettner, Julian Schmidt; besonders dieser letzte
war ihm ans Herz gewachsen, weil er „ein helles und unfehlbares Gefühl" für das
Echte besaß. Als Freund hat er Wilhelm Scherer einen Nachruf geschrieben, der
wundervoll genannt werden muß wegen seiner Erwärmung des Sachlichen durch
das Persönliche oder, anders gesehen, wegen der Erhebung des Einzelnen ins Über-
persönliche. Wir glauben heute, daß Scherer von den Zeitgenossen überschätzt
wurde, aber wir können aus Diltheys Nachruf entnehmen, wie vieles dennoch von
dem Alenschen und von seinem Werk Anspruch auf Dauer hat. Es gehört wohl
zum Bilde unserer erinnerungslosen Gegenwart, daß so wenige zur fünfzigsten
Wiederkehr von Scherers Todestag (dem 6. August 1886) das Wort ergriffen haben.
Als ich, ein junger Student, Scherer kennen lernte, war er von Glanz und Heiterkeit
umflossen. Wir spürten nichts von dem dunklen Gefühl der Unzulänglichkeit, das
ihn quälte. „Vermöchte man doch", so hatte er schon 186S geschrieben, „eine kurze
Stunde wenigstens nach getaner Arbeit sich dem täuschenden Wahn des Abschlus-
ses hinzugeben. Aber mir ahnt, daß selbst ein reiches und langes Leben im Dienste
der Wissenschaft es kaum höher als zum Ausgang des Moses bringen könne: zu
einem einzigen kurzen Blicke auf das gelobte Land. Wie ein drohendes Gespenst
überschattet die Unendlichkeit der Welt jedes schüchterne Gefühl des Gelingens,
das sich in uns emporwagen möchte". Das ist erschütternd wahr.
Am Ende dieses Bandes der Diltheyschen Schriften steht der Nachruf auf Anna
Helmholtz. Er schildert eine ästhetische Lebensführung, gegründet in Menschentum
und Kulturfülle, geregelt durch Schätzung der Formen, gefördert von eigener Be-
tätigung in Musik und Literatur. Als Leitspruch sind Goethes Worte vorangestellt:
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
Berlin. Max Dessoir.