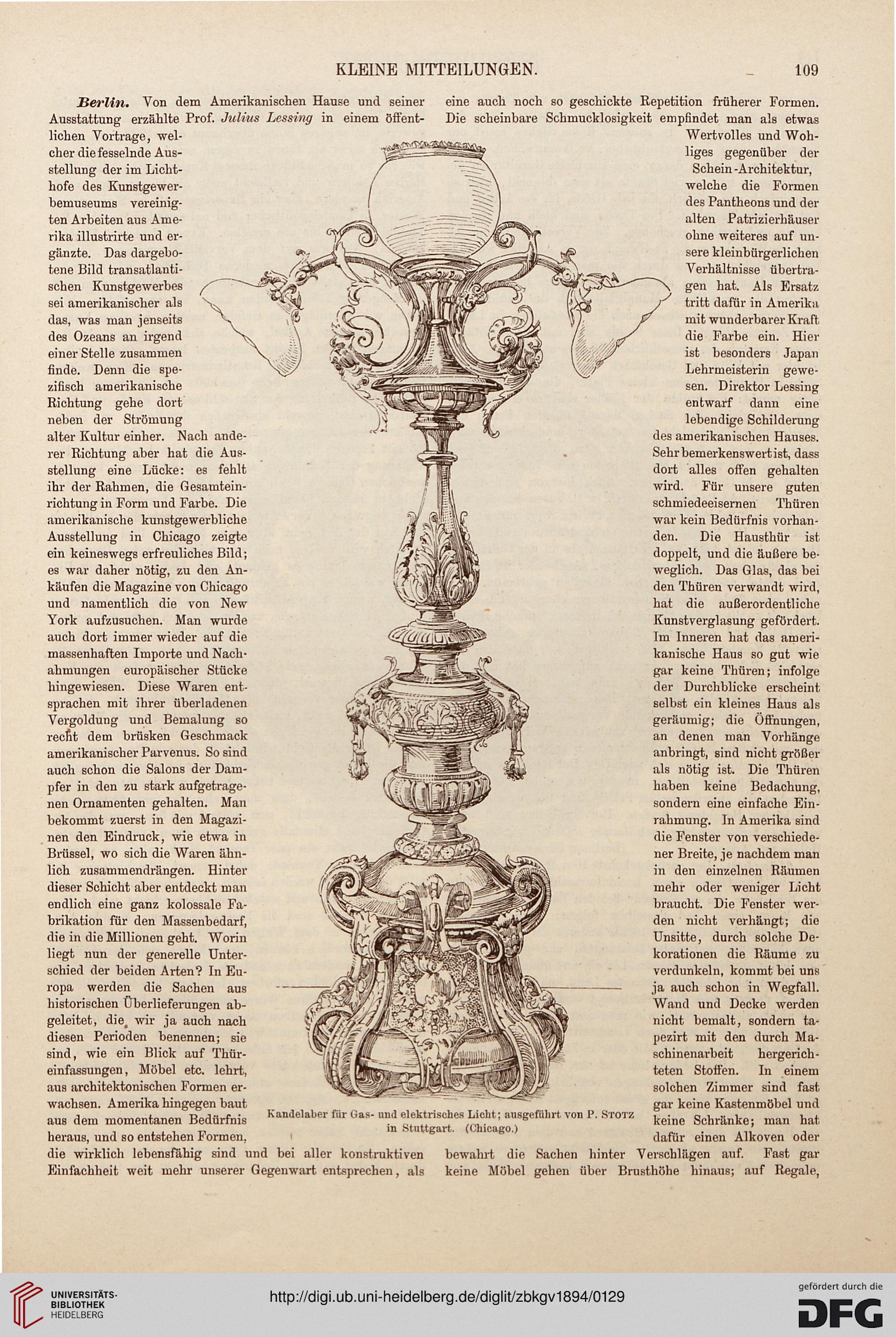KLEINE MITTEILUNGEN.
109
Berlin, Von dem Amerikanischen Hause und seiner
Ausstattung erzählte Prof. Julius Lessing in einem öffent-
lichen Vortrage, wel-
cher die fesselnde Aus-
stellung der im Licht-
hofe des Kunstgewer-
bemuseums vereinig-
ten Arbeiten aus Ame-
rika illustrirte und er-
gänzte. Das dargebo-
tene Bild transatlanti-
schen Kunstgewerbes
sei amerikanischer als
das, was man jenseits
des Ozeans an irgend
einer Stelle zusammen
finde. Denn die spe-
zifisch amerikanische
Richtung gehe dort
neben der Strömung
alter Kultur einher. Nach ande-
rer Richtung aber hat die Aus-
stellung eine Lücke: es fehlt
ihr der Rahmen, die Gesamtein-
richtung in Form und Farbe. Die
amerikanische kunstgewerbliche
Ausstellung in Chicago zeigte
ein keineswegs erfreuliches Bild;
es war daher nötig, zu den An-
käufen die Magazine von Chicago
und namentlich die von New
York aufzusuchen. Man wurde
auch dort immer wieder auf die
massenhaften Importe und Nach-
ahmungen europäischer Stücke
hingewiesen. Diese Waren ent-
sprachen mit ihrer überladenen
Vergoldung und Bemalung so
reent dem brüsken Geschmack
amerikanischer Parvenüs. So sind
auch schon die Salons der Dam-
pfer in den zu stark aufgetrage-
nen Ornamenten gehalten. Man
bekommt zuerst in den Magazi-
nen den Eindruck, wie etwa in
Brüssel, wo sich die Waren ähn-
lich zusammendrängen. Hinter
dieser Schicht aber entdeckt man
endlich eine ganz kolossale Fa-
brikation für den Massenbedarf,
die in die Millionen geht. Worin
liegt nun der generelle Unter-
schied der beiden Arten? In Bu-
ropa werden die Sachen aus
historischen Überlieferungen ab-
geleitet, die# wir ja auch nach
diesen Perioden benennen; sie
sind, wie ein Blick auf Thür-
einfassungen, Möbel etc. lehrt,
aus architektonischen Formen er-
wachsen. Amerika hingegen baut
aus dem momentanen Bedürfnis
heraus, und so entstehen Formen,
die wirklich lebensfähig sind und bei aller konstruktiven
Einfachheit weit mehr unserer Gegenwart entsprechen, als
eine auch noch so geschickte Repetition früherer Formen.
Die scheinbare Schmucklosigkeit empfindet man als etwas
Wertvolles und Woh-
liges gegenüber der
Schein -Architektur,
welche die Formen
des Pantheons und der
alten Patrizierhäuser
ohne weiteres auf un-
sere kleinbürgerlichen
Verhältnisse übertra-
gen hat. Als Ersatz
tritt dafür in Amerika
mit wunderbarer Kraft
die Farbe ein. Hier
ist besonders Japan
Lehrmeisterin gewe-
sen. Direktor Lessing
entwarf dann eine
lebendige Schilderung
des amerikanischen Hauses.
Sehr bemerkenswert ist, dass
dort alles offen gehalten
wird. Für unsere guten
schmiedeeisernen Thüren
war kein Bedürfnis vorhan-
den. Die Hausthür ist
doppelt, und die äußere be-
weglich. Das Glas, das bei
den Thüren verwandt wird,
hat die außerordentliche
Kunstverglasung gefördert.
Im Inneren hat das ameri-
kanische Haus so gut wie
gar keine Thüren; infolge
der Durchblicke erscheint
selbst ein kleines Haus als
geräumig; die Öffnungen,
an denen man Vorhänge
anbringt, sind nicht größer
als nötig ist. Die Thüren
haben keine Bedachung,
sondern eine einfache Ein-
rahmung. In Amerika sind
die Fenster von verschiede-
ner Breite, je nachdem man
in den einzelnen Räumen
mehr oder weniger Licht
braucht. Die Fenster wer-
den nicht verhängt; die
Unsitte, durch solche De-
korationen die Räume zu
verdunkeln, kommt bei uns
ja auch schon in Wegfall.
Wand und Decke werden
nicht bemalt, sondern ta-
pezirt mit den durch Ma-
schinenarbeit hergerich-
teten Stoffen. In einem
solchen Zimmer sind fast
gar keine Kastenmöbel und
keine Schränke; man hat
dafür einen Alkoven oder
bewahrt die Sachen hinter Verschlagen auf. Fast gar
keine Möbel gehen über Brusthöhe hinaus; auf Regale,
Kandelaber für Gas- und elektrisches Liebt; ausgeführt, von P. STOTZ
in Stuttgart. (Chicago.)
109
Berlin, Von dem Amerikanischen Hause und seiner
Ausstattung erzählte Prof. Julius Lessing in einem öffent-
lichen Vortrage, wel-
cher die fesselnde Aus-
stellung der im Licht-
hofe des Kunstgewer-
bemuseums vereinig-
ten Arbeiten aus Ame-
rika illustrirte und er-
gänzte. Das dargebo-
tene Bild transatlanti-
schen Kunstgewerbes
sei amerikanischer als
das, was man jenseits
des Ozeans an irgend
einer Stelle zusammen
finde. Denn die spe-
zifisch amerikanische
Richtung gehe dort
neben der Strömung
alter Kultur einher. Nach ande-
rer Richtung aber hat die Aus-
stellung eine Lücke: es fehlt
ihr der Rahmen, die Gesamtein-
richtung in Form und Farbe. Die
amerikanische kunstgewerbliche
Ausstellung in Chicago zeigte
ein keineswegs erfreuliches Bild;
es war daher nötig, zu den An-
käufen die Magazine von Chicago
und namentlich die von New
York aufzusuchen. Man wurde
auch dort immer wieder auf die
massenhaften Importe und Nach-
ahmungen europäischer Stücke
hingewiesen. Diese Waren ent-
sprachen mit ihrer überladenen
Vergoldung und Bemalung so
reent dem brüsken Geschmack
amerikanischer Parvenüs. So sind
auch schon die Salons der Dam-
pfer in den zu stark aufgetrage-
nen Ornamenten gehalten. Man
bekommt zuerst in den Magazi-
nen den Eindruck, wie etwa in
Brüssel, wo sich die Waren ähn-
lich zusammendrängen. Hinter
dieser Schicht aber entdeckt man
endlich eine ganz kolossale Fa-
brikation für den Massenbedarf,
die in die Millionen geht. Worin
liegt nun der generelle Unter-
schied der beiden Arten? In Bu-
ropa werden die Sachen aus
historischen Überlieferungen ab-
geleitet, die# wir ja auch nach
diesen Perioden benennen; sie
sind, wie ein Blick auf Thür-
einfassungen, Möbel etc. lehrt,
aus architektonischen Formen er-
wachsen. Amerika hingegen baut
aus dem momentanen Bedürfnis
heraus, und so entstehen Formen,
die wirklich lebensfähig sind und bei aller konstruktiven
Einfachheit weit mehr unserer Gegenwart entsprechen, als
eine auch noch so geschickte Repetition früherer Formen.
Die scheinbare Schmucklosigkeit empfindet man als etwas
Wertvolles und Woh-
liges gegenüber der
Schein -Architektur,
welche die Formen
des Pantheons und der
alten Patrizierhäuser
ohne weiteres auf un-
sere kleinbürgerlichen
Verhältnisse übertra-
gen hat. Als Ersatz
tritt dafür in Amerika
mit wunderbarer Kraft
die Farbe ein. Hier
ist besonders Japan
Lehrmeisterin gewe-
sen. Direktor Lessing
entwarf dann eine
lebendige Schilderung
des amerikanischen Hauses.
Sehr bemerkenswert ist, dass
dort alles offen gehalten
wird. Für unsere guten
schmiedeeisernen Thüren
war kein Bedürfnis vorhan-
den. Die Hausthür ist
doppelt, und die äußere be-
weglich. Das Glas, das bei
den Thüren verwandt wird,
hat die außerordentliche
Kunstverglasung gefördert.
Im Inneren hat das ameri-
kanische Haus so gut wie
gar keine Thüren; infolge
der Durchblicke erscheint
selbst ein kleines Haus als
geräumig; die Öffnungen,
an denen man Vorhänge
anbringt, sind nicht größer
als nötig ist. Die Thüren
haben keine Bedachung,
sondern eine einfache Ein-
rahmung. In Amerika sind
die Fenster von verschiede-
ner Breite, je nachdem man
in den einzelnen Räumen
mehr oder weniger Licht
braucht. Die Fenster wer-
den nicht verhängt; die
Unsitte, durch solche De-
korationen die Räume zu
verdunkeln, kommt bei uns
ja auch schon in Wegfall.
Wand und Decke werden
nicht bemalt, sondern ta-
pezirt mit den durch Ma-
schinenarbeit hergerich-
teten Stoffen. In einem
solchen Zimmer sind fast
gar keine Kastenmöbel und
keine Schränke; man hat
dafür einen Alkoven oder
bewahrt die Sachen hinter Verschlagen auf. Fast gar
keine Möbel gehen über Brusthöhe hinaus; auf Regale,
Kandelaber für Gas- und elektrisches Liebt; ausgeführt, von P. STOTZ
in Stuttgart. (Chicago.)