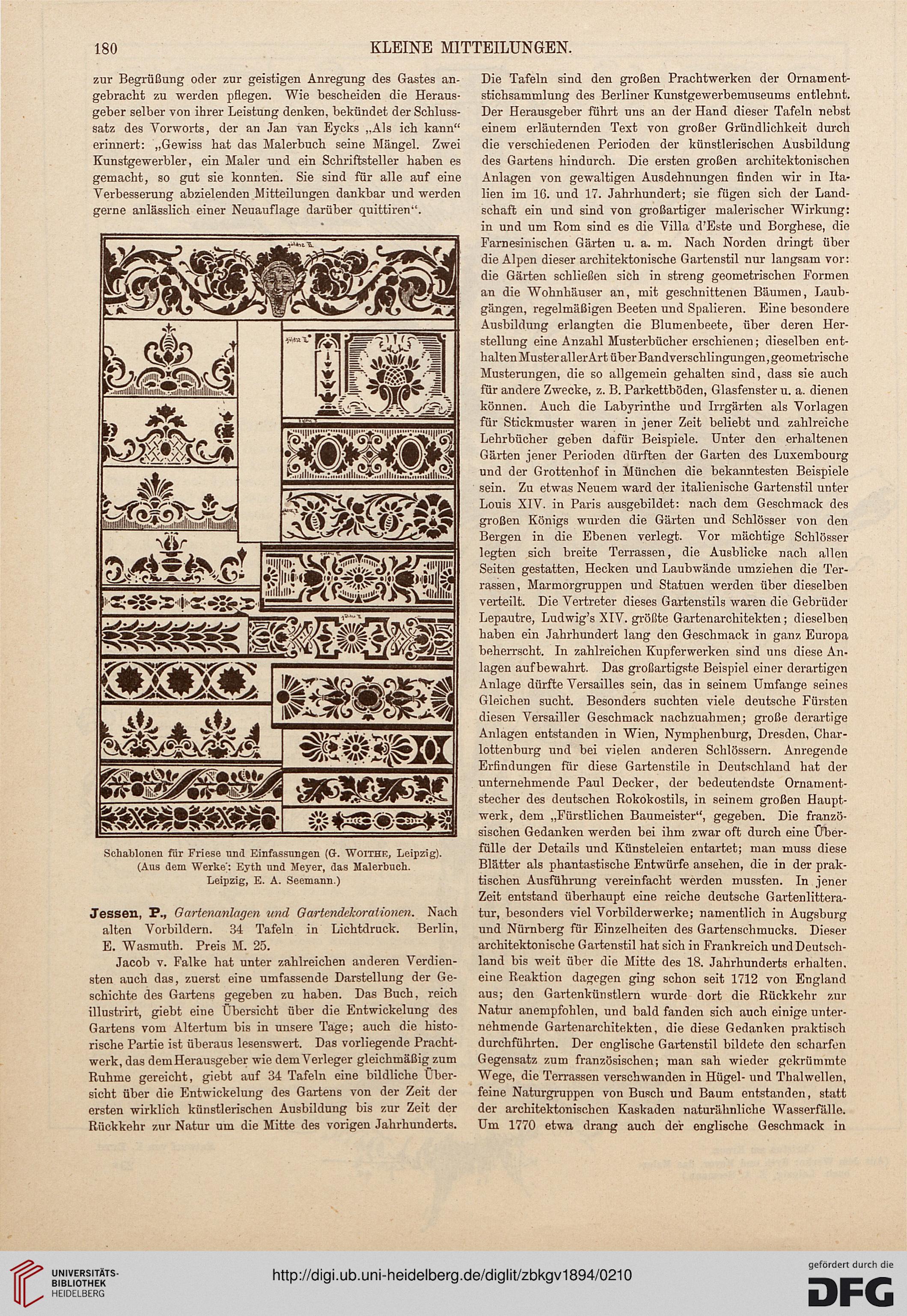180
KLEINE MITTEILUNGEN.
zur Begrüßung oder zur geistigen Anregung des Gastes an-
gebracht zu werden pflegen. Wie bescheiden die Heraus-
geber selber von ihrer Leistung denken, bekündet der Schluss-
satz des Vorworts, der an Jan van Eyeks „Als ich kann"
erinnert: „Gewiss hat das Malerbuch seine Mängel. Zwei
Kunstgewerbler, ein Maler und ein Schriftsteller haben es
gemacht, so gut sie konnten. Sie sind für alle auf eine
Verbesserung abzielenden Mitteilungen dankbar und werden
gerne anlässlich einer Neuauflage darüber quittiren".
m *
iiniiiiii|liiHii»S^*:'^iiiii[[|lliiiiiiii!lllii[iiiiiill[ii
***.
s
iä
<-«g»->i!<-«$&Si
Schablonen für Friese und Einfassungen (G. Woithe, Leipzig).
(Aus dem Werke': Eyth und Meyer, das Malerbuch.
Leipzig, E. A. Seemann.)
Jessen, P., Gartenanlagcn und Gartendelcoraiionen. Nach
alten Vorbildern. 34 Tafeln in Lichtdruck. Berlin,
E. Wasmuth. Preis M. 25.
Jacob v. Falke hat unter zahlreichen anderen Verdien-
sten auch das, zuerst eine umfassende Darstellung der Ge-
schichte des Gartens gegeben zu haben. Das Buch, reich
illustrirt, giebt eine Übersicht über die Entwickelung des
Gartens vom Altertum bis in unsere Tage; auch die histo-
rische Partie ist überaus lesenswert. Das vorliegende Pracht-
werk, das dem Herausgeber wie dem Verleger gleichmäßig zum
Ruhme gereicht, giebt auf 34 Tafeln eine bildliche Über-
sicht über die Entwickelung des Gartens von der Zeit der
ersten wirklich künstlerischen Ausbildung bis zur Zeit der
Rückkehr zur Natur um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Die Tafeln sind den großen Prachtwerken der Omament-
stichsammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums entlehnt.
Der Herausgeber führt uns an der Hand dieser Tafeln nebst
einem erläuternden Text von großer Gründlichkeit durch
die verschiedenen Perioden der künstlerischen Ausbildung
des Gartens hindurch. Die ersten großen architektonischen
Anlagen von gewaltigen Ausdehnungen finden wir in Ita-
lien im 16. und 17. Jahrhundert; sie fügen sich der Land-
schaft ein und sind von großartiger malerischer Wirkung:
in und um Rom sind es die Villa d'Este und Borghese, die
Farnesinischen Gärten u. a. m. Nach Norden dringt über
die Alpen dieser architektonische Gartenstil nur langsam vor:
die Gärten schließen sich in streng geometrischen Formen
an die Wohnhäuser an, mit geschnittenen Bäumen, Laub-
gängen, regelmäßigen Beeten und Spalieren. Eine besondere
Ausbildung erlangten die Blumenbeete, über deren Her-
stellung eine Anzahl Musterbücher erschienen; dieselben ent-
halten Muster aller Art über Bandverschlingungen, geometrische
Musterungen, die so allgemein gehalten sind, dass sie auch
für andere Zwecke, z. B. Parkettböden, Glasfenster u. a. dienen
können. Auch die Labyrinthe und Irrgärten als Vorlagen
für Stickmuster waren in jener Zeit beliebt und zahlreiche
Lehrbücher geben dafür Beispiele. Unter den erhaltenen
Gärten jener Perioden dürften der Garten des Luxembourg
und der Grottenhof in München die bekanntesten Beispiele
sein. Zu etwas Neuem ward der italienische Gartenstil unter
Louis XIV. in Paris ausgebildet: nach dem Geschmack des
großen Königs wurden die Gärten und Schlösser von den
Bergen in die Ebenen verlegt. Vor mächtige Schlösser
legten sich breite Terrassen, die Ausblicke nach allen
Seiten gestatten, Hecken und Laubwände umziehen die Ter-
rassen, Marmorgruppen und Statuen werden über dieselben
verteilt. Die Vertreter dieses Gartenstils waren die Gebrüder
Lepautre, Ludwig's XIV. größte Gartenarchitekten; dieselben
haben ein Jahrhundert lang den Geschmack in ganz Europa
beherrscht. In zahlreichen Kupferwerken sind uns diese An-
lagen aufbewahrt. Das großartigste Beispiel einer derartigen
Anlage dürfte Versailles sein, das in seinem Umfange seines
Gleichen sucht. Besonders suchten viele deutsche Fürsten
diesen Versailler Geschmack nachzuahmen; große derartige
Anlagen entstanden in Wien, Nymphenburg, Dresden, Char-
lottenburg und bei vielen anderen Schlössern. Anregende
Erfindungen für diese Gartenstile in Deutschland hat der
unternehmende Paul Decker, der bedeutendste Ornament-
stecher des deutschen Rokokostils, in seinem großen Haupt-
werk, dem „Fürstlichen Baumeister", gegeben. Die franzö-
sischen Gedanken werden bei ihm zwar oft durch eine Über-
fülle der Details und Künsteleien entartet; man muss diese
Blätter als phantastische Entwürfe ansehen, die in der prak-
tischen Ausführung vereinfacht werden mussten. In jener
Zeit entstand überhaupt eine reiche deutsche Gartenlittera-
tur, besonders viel Vorbilderwerke; namentlich in Augsburg
und Nürnberg für Einzelheiten des Gartenschmucks. Dieser
architektonische Gartenstil hat sich in Frankreich und Deutsch-
land bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten,
eine Reaktion dagegen ging schon seit 1712 von England
aus; den Gartenkünstlern wurde dort die Rückkehr zur
Natur anempfohlen, und bald fanden sich auch einige unter-
nehmende Gartenarchitekten, die diese Gedanken praktisch
durchführten. Der englische Gartenstil bildete den scharfen
Gegensatz zum französischen; man sah wieder gekrümmte
Wege, die Terrassen verschwanden in Hügel- und Thalwellen,
feine Naturgruppen von Busch und Baum entstanden, statt
der architektonischen Kaskaden naturähnliche Wasserfälle.
Um 1770 etwa drang auch der englische Geschmack in
KLEINE MITTEILUNGEN.
zur Begrüßung oder zur geistigen Anregung des Gastes an-
gebracht zu werden pflegen. Wie bescheiden die Heraus-
geber selber von ihrer Leistung denken, bekündet der Schluss-
satz des Vorworts, der an Jan van Eyeks „Als ich kann"
erinnert: „Gewiss hat das Malerbuch seine Mängel. Zwei
Kunstgewerbler, ein Maler und ein Schriftsteller haben es
gemacht, so gut sie konnten. Sie sind für alle auf eine
Verbesserung abzielenden Mitteilungen dankbar und werden
gerne anlässlich einer Neuauflage darüber quittiren".
m *
iiniiiiii|liiHii»S^*:'^iiiii[[|lliiiiiiii!lllii[iiiiiill[ii
***.
s
iä
<-«g»->i!<-«$&Si
Schablonen für Friese und Einfassungen (G. Woithe, Leipzig).
(Aus dem Werke': Eyth und Meyer, das Malerbuch.
Leipzig, E. A. Seemann.)
Jessen, P., Gartenanlagcn und Gartendelcoraiionen. Nach
alten Vorbildern. 34 Tafeln in Lichtdruck. Berlin,
E. Wasmuth. Preis M. 25.
Jacob v. Falke hat unter zahlreichen anderen Verdien-
sten auch das, zuerst eine umfassende Darstellung der Ge-
schichte des Gartens gegeben zu haben. Das Buch, reich
illustrirt, giebt eine Übersicht über die Entwickelung des
Gartens vom Altertum bis in unsere Tage; auch die histo-
rische Partie ist überaus lesenswert. Das vorliegende Pracht-
werk, das dem Herausgeber wie dem Verleger gleichmäßig zum
Ruhme gereicht, giebt auf 34 Tafeln eine bildliche Über-
sicht über die Entwickelung des Gartens von der Zeit der
ersten wirklich künstlerischen Ausbildung bis zur Zeit der
Rückkehr zur Natur um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Die Tafeln sind den großen Prachtwerken der Omament-
stichsammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums entlehnt.
Der Herausgeber führt uns an der Hand dieser Tafeln nebst
einem erläuternden Text von großer Gründlichkeit durch
die verschiedenen Perioden der künstlerischen Ausbildung
des Gartens hindurch. Die ersten großen architektonischen
Anlagen von gewaltigen Ausdehnungen finden wir in Ita-
lien im 16. und 17. Jahrhundert; sie fügen sich der Land-
schaft ein und sind von großartiger malerischer Wirkung:
in und um Rom sind es die Villa d'Este und Borghese, die
Farnesinischen Gärten u. a. m. Nach Norden dringt über
die Alpen dieser architektonische Gartenstil nur langsam vor:
die Gärten schließen sich in streng geometrischen Formen
an die Wohnhäuser an, mit geschnittenen Bäumen, Laub-
gängen, regelmäßigen Beeten und Spalieren. Eine besondere
Ausbildung erlangten die Blumenbeete, über deren Her-
stellung eine Anzahl Musterbücher erschienen; dieselben ent-
halten Muster aller Art über Bandverschlingungen, geometrische
Musterungen, die so allgemein gehalten sind, dass sie auch
für andere Zwecke, z. B. Parkettböden, Glasfenster u. a. dienen
können. Auch die Labyrinthe und Irrgärten als Vorlagen
für Stickmuster waren in jener Zeit beliebt und zahlreiche
Lehrbücher geben dafür Beispiele. Unter den erhaltenen
Gärten jener Perioden dürften der Garten des Luxembourg
und der Grottenhof in München die bekanntesten Beispiele
sein. Zu etwas Neuem ward der italienische Gartenstil unter
Louis XIV. in Paris ausgebildet: nach dem Geschmack des
großen Königs wurden die Gärten und Schlösser von den
Bergen in die Ebenen verlegt. Vor mächtige Schlösser
legten sich breite Terrassen, die Ausblicke nach allen
Seiten gestatten, Hecken und Laubwände umziehen die Ter-
rassen, Marmorgruppen und Statuen werden über dieselben
verteilt. Die Vertreter dieses Gartenstils waren die Gebrüder
Lepautre, Ludwig's XIV. größte Gartenarchitekten; dieselben
haben ein Jahrhundert lang den Geschmack in ganz Europa
beherrscht. In zahlreichen Kupferwerken sind uns diese An-
lagen aufbewahrt. Das großartigste Beispiel einer derartigen
Anlage dürfte Versailles sein, das in seinem Umfange seines
Gleichen sucht. Besonders suchten viele deutsche Fürsten
diesen Versailler Geschmack nachzuahmen; große derartige
Anlagen entstanden in Wien, Nymphenburg, Dresden, Char-
lottenburg und bei vielen anderen Schlössern. Anregende
Erfindungen für diese Gartenstile in Deutschland hat der
unternehmende Paul Decker, der bedeutendste Ornament-
stecher des deutschen Rokokostils, in seinem großen Haupt-
werk, dem „Fürstlichen Baumeister", gegeben. Die franzö-
sischen Gedanken werden bei ihm zwar oft durch eine Über-
fülle der Details und Künsteleien entartet; man muss diese
Blätter als phantastische Entwürfe ansehen, die in der prak-
tischen Ausführung vereinfacht werden mussten. In jener
Zeit entstand überhaupt eine reiche deutsche Gartenlittera-
tur, besonders viel Vorbilderwerke; namentlich in Augsburg
und Nürnberg für Einzelheiten des Gartenschmucks. Dieser
architektonische Gartenstil hat sich in Frankreich und Deutsch-
land bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten,
eine Reaktion dagegen ging schon seit 1712 von England
aus; den Gartenkünstlern wurde dort die Rückkehr zur
Natur anempfohlen, und bald fanden sich auch einige unter-
nehmende Gartenarchitekten, die diese Gedanken praktisch
durchführten. Der englische Gartenstil bildete den scharfen
Gegensatz zum französischen; man sah wieder gekrümmte
Wege, die Terrassen verschwanden in Hügel- und Thalwellen,
feine Naturgruppen von Busch und Baum entstanden, statt
der architektonischen Kaskaden naturähnliche Wasserfälle.
Um 1770 etwa drang auch der englische Geschmack in