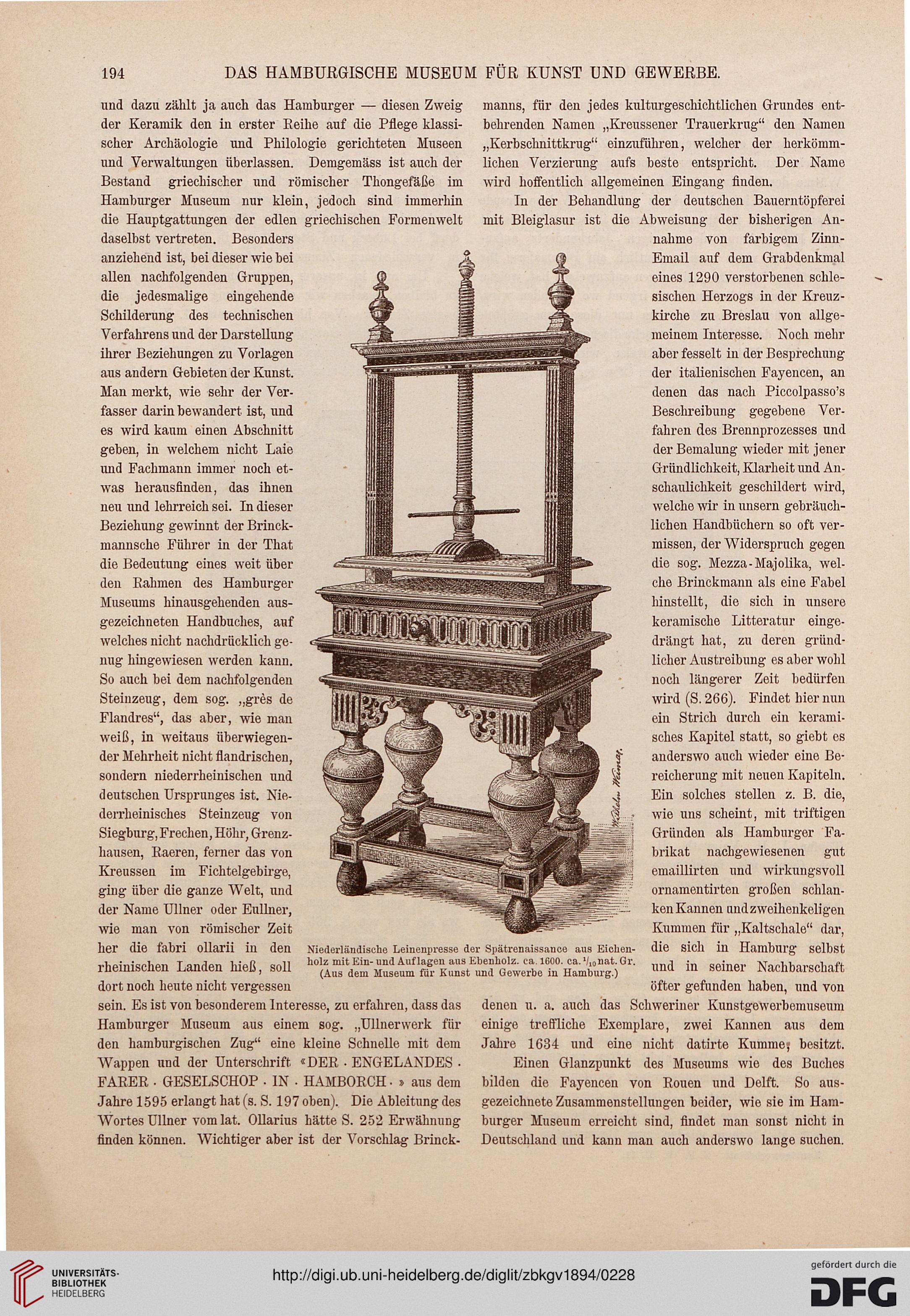194
DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.
und dazu zählt ja auch das Hamburger — diesen Zweig
der Keramik den in erster Eeihe auf die Pflege klassi-
scher Archäologie und Philologie gerichteten Museen
und Verwaltungen überlassen. Demgemäss ist auch der
Bestand griechischer und römischer Thongefäße im
Hamburger Museum nur klein, jedoch sind immerhin
die Hauptgattungen der edlen griechischen Formenwelt
daselbst vertreten. Besonders
anziehend ist, bei dieser wie bei
allen nachfolgenden Gruppen,
die jedesmalige eingehende
Schilderung des technischen
Verfahrens und der Darstellung
ihrer Beziehungen zu Vorlagen
aus andern Gebieten der Kunst.
Man merkt, wie sehr der Ver-
fasser darin bewandert ist, und
es wird kaum einen Abschnitt
geben, in welchem nicht Laie
und Fachmann immer noch et-
was herausfinden, das ihnen
neu und lehrreich sei. In dieser
Beziehung gewinnt der Brinck-
mannsche Führer in der That
die Bedeutung eines weit über
den Eahmen des Hamburger
Museums hinausgehenden aus-
gezeichneten Handbuches, auf
welches nicht nachdrücklich ge-
nug hingewiesen werden kann.
So auch bei dem nachfolgenden
Steinzeug, dem sog. „gres de
Flandres", das aber, wie man
weiß, in weitaus überwiegen-
der Mehrheit nicht flandrischen,
sondern niederrheinischen und
deutschen Ursprunges ist. Nie-
derrlieinisches Steinzeug von
Siegburg, Frechen, Höhr, Grenz-
hausen, Eaeren, ferner das von
Kreussen im Fichtelgebirge,
ging über die ganze Welt, und
der Name Ullner oder Eullner,
wie man von römischer Zeit
her die fabri ollarii in den
rheinischen Landen hieß, soll
dort noch heute nicht vergessen
sein. Es ist von besonderem Interesse, zu erfahren, dass das
Hamburger Museum aus einem sog. „Ullnervverk für
den hamburgischen Zug" eine kleine Schnelle mit dem
Wappen und der Unterschrift «DEE ■ ENGELANDES .
FAEEE • GESELSCHOP . IN • HAMBOECH • » aus dem
Jahre 1595 erlangt hat (s. S. 197 oben). Die Ableitung des
Wortes Uliner vom lat. Ollarius hätte S. 252 Erwähnung
finden können. Wichtiger aber ist der Vorschlag Brinck-
Niederländische Leinenpresse der Spätrenaissance aus Eichen-
holz mit Ein- und Auflagen aus Ebenholz, ca. 1600. ca. Vjouat. Gr.
(Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.)
manns, für den jedes kulturgeschichtlichen Grundes ent-
behrenden Namen „Kreussener Trauerkrng" den Namen
„Kerbschnittkrug" einzuführen, welcher der herkömm-
lichen Verzierung aufs beste entspricht. Der Name
wird hoffentlich allgemeinen Eingang finden.
In der Behandlung der deutschen Bauerntöpferei
mit Bleiglasur ist die Abweisung der bisherigen An-
nahme von farbigem Zinn-
Email auf dem Grabdenkmal
eines 1290 verstorbenen schle-
sischen Herzogs in der Kreuz-
kirche zu Breslau von allge-
meinem Interesse. Noch mehr
aber fesselt in der Besprechung
der italienischen Fayencen, an
denen das nach Piccolpasso's
Beschreibung gegebene Ver-
fahren des Brennprozesses und
der Bemalung wieder mit jener
Gründlichkeit, Klarheit und An-
schaulichkeit geschildert wird,
welche wir in unsern gebräuch-
lichen Handbüchern so oft ver-
missen, der Widerspruch gegen
die sog. Mezza-Majolika, wel-
che Brinckmann als eine Fabel
hinstellt, die sich in unsere
keramische Litteratur einge-
drängt hat, zu deren gründ-
licher Austreibung es aber wohl
noch längerer Zeit bedürfen
wird (S. 266). Findet hier nun
ein Strich durch ein kerami-
sches Kapitel statt, so giebt es
anderswo auch wieder eine Be-
reicherung mit neuen Kapiteln.
Ein solches stellen z. B. die,
wie uns scheint, mit triftigen
Gründen als Hamburger Fa-
brikat nachgewiesenen gut
emaillirten und wirkungsvoll
ornamentirten großen schlan-
kenKannen undzweihenkeligen
Kummen für „Kaltschale" dar,
die sich in Hamburg selbst
und in seiner Nachbarschaft
öfter gefunden haben, und von
denen u. a. auch das Schweriner Kunstgewerbemuseum
einige treffliche Exemplare, zwei Kannen aus dem
1634 und eine nicht datirte Kumme; besitzt,
des Museums wie des Buches
Eouen und Delft. So aus-
wie sie im Ham-
Jahre 1634 und
Einen Glanzpunkt
bilden die Fayencen von
gezeichnete Zusammenstellungen beider.
burger Museum erreicht sind, findet man sonst nicht in
Deutschland und kann man auch anderswo lange suchen.
DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.
und dazu zählt ja auch das Hamburger — diesen Zweig
der Keramik den in erster Eeihe auf die Pflege klassi-
scher Archäologie und Philologie gerichteten Museen
und Verwaltungen überlassen. Demgemäss ist auch der
Bestand griechischer und römischer Thongefäße im
Hamburger Museum nur klein, jedoch sind immerhin
die Hauptgattungen der edlen griechischen Formenwelt
daselbst vertreten. Besonders
anziehend ist, bei dieser wie bei
allen nachfolgenden Gruppen,
die jedesmalige eingehende
Schilderung des technischen
Verfahrens und der Darstellung
ihrer Beziehungen zu Vorlagen
aus andern Gebieten der Kunst.
Man merkt, wie sehr der Ver-
fasser darin bewandert ist, und
es wird kaum einen Abschnitt
geben, in welchem nicht Laie
und Fachmann immer noch et-
was herausfinden, das ihnen
neu und lehrreich sei. In dieser
Beziehung gewinnt der Brinck-
mannsche Führer in der That
die Bedeutung eines weit über
den Eahmen des Hamburger
Museums hinausgehenden aus-
gezeichneten Handbuches, auf
welches nicht nachdrücklich ge-
nug hingewiesen werden kann.
So auch bei dem nachfolgenden
Steinzeug, dem sog. „gres de
Flandres", das aber, wie man
weiß, in weitaus überwiegen-
der Mehrheit nicht flandrischen,
sondern niederrheinischen und
deutschen Ursprunges ist. Nie-
derrlieinisches Steinzeug von
Siegburg, Frechen, Höhr, Grenz-
hausen, Eaeren, ferner das von
Kreussen im Fichtelgebirge,
ging über die ganze Welt, und
der Name Ullner oder Eullner,
wie man von römischer Zeit
her die fabri ollarii in den
rheinischen Landen hieß, soll
dort noch heute nicht vergessen
sein. Es ist von besonderem Interesse, zu erfahren, dass das
Hamburger Museum aus einem sog. „Ullnervverk für
den hamburgischen Zug" eine kleine Schnelle mit dem
Wappen und der Unterschrift «DEE ■ ENGELANDES .
FAEEE • GESELSCHOP . IN • HAMBOECH • » aus dem
Jahre 1595 erlangt hat (s. S. 197 oben). Die Ableitung des
Wortes Uliner vom lat. Ollarius hätte S. 252 Erwähnung
finden können. Wichtiger aber ist der Vorschlag Brinck-
Niederländische Leinenpresse der Spätrenaissance aus Eichen-
holz mit Ein- und Auflagen aus Ebenholz, ca. 1600. ca. Vjouat. Gr.
(Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.)
manns, für den jedes kulturgeschichtlichen Grundes ent-
behrenden Namen „Kreussener Trauerkrng" den Namen
„Kerbschnittkrug" einzuführen, welcher der herkömm-
lichen Verzierung aufs beste entspricht. Der Name
wird hoffentlich allgemeinen Eingang finden.
In der Behandlung der deutschen Bauerntöpferei
mit Bleiglasur ist die Abweisung der bisherigen An-
nahme von farbigem Zinn-
Email auf dem Grabdenkmal
eines 1290 verstorbenen schle-
sischen Herzogs in der Kreuz-
kirche zu Breslau von allge-
meinem Interesse. Noch mehr
aber fesselt in der Besprechung
der italienischen Fayencen, an
denen das nach Piccolpasso's
Beschreibung gegebene Ver-
fahren des Brennprozesses und
der Bemalung wieder mit jener
Gründlichkeit, Klarheit und An-
schaulichkeit geschildert wird,
welche wir in unsern gebräuch-
lichen Handbüchern so oft ver-
missen, der Widerspruch gegen
die sog. Mezza-Majolika, wel-
che Brinckmann als eine Fabel
hinstellt, die sich in unsere
keramische Litteratur einge-
drängt hat, zu deren gründ-
licher Austreibung es aber wohl
noch längerer Zeit bedürfen
wird (S. 266). Findet hier nun
ein Strich durch ein kerami-
sches Kapitel statt, so giebt es
anderswo auch wieder eine Be-
reicherung mit neuen Kapiteln.
Ein solches stellen z. B. die,
wie uns scheint, mit triftigen
Gründen als Hamburger Fa-
brikat nachgewiesenen gut
emaillirten und wirkungsvoll
ornamentirten großen schlan-
kenKannen undzweihenkeligen
Kummen für „Kaltschale" dar,
die sich in Hamburg selbst
und in seiner Nachbarschaft
öfter gefunden haben, und von
denen u. a. auch das Schweriner Kunstgewerbemuseum
einige treffliche Exemplare, zwei Kannen aus dem
1634 und eine nicht datirte Kumme; besitzt,
des Museums wie des Buches
Eouen und Delft. So aus-
wie sie im Ham-
Jahre 1634 und
Einen Glanzpunkt
bilden die Fayencen von
gezeichnete Zusammenstellungen beider.
burger Museum erreicht sind, findet man sonst nicht in
Deutschland und kann man auch anderswo lange suchen.