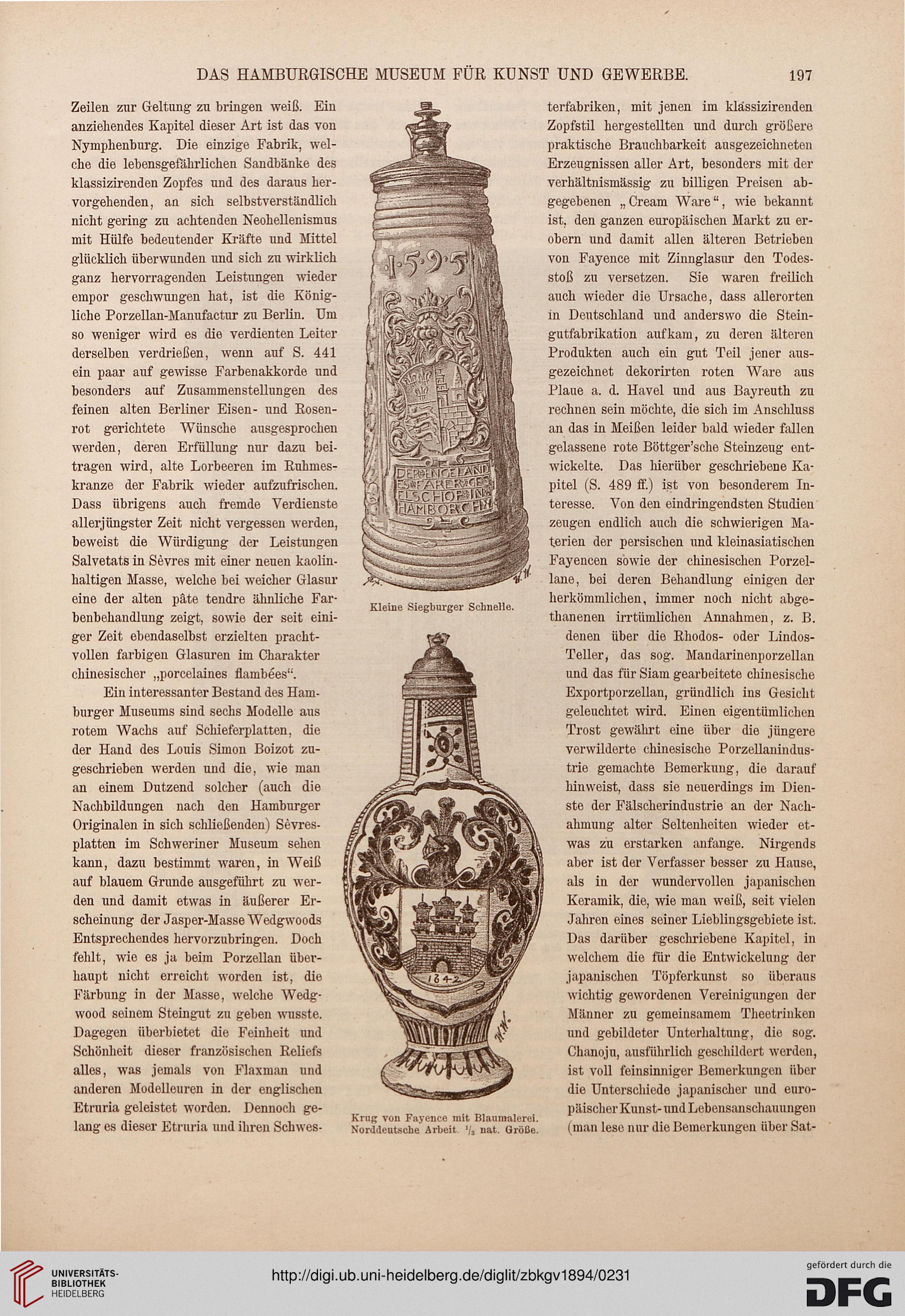DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.
197
Zeilen zur Geltung zu bringen weiß. Ein
anziehendes Kapitel dieser Art ist das von
Nymphenburg. Die einzige Fabrik, wel-
che die lebensgefährlichen Sandbänke des
klassizirenden Zopfes und des daraus her-
vorgehenden, an sich selbstverständlich
nicht gering zu achtenden Neohellenismus
mit Hülfe bedeutender Kräfte und Mittel
glücklich überwunden und sich zu wirklich
ganz hervorragenden Leistungen wieder
empor geschwungen hat, ist die König-
liche Porzellan-Manufactur zu Berlin. Um
so weniger wird es die verdienten Leiter
derselben verdrießen, wenn auf S. 441
ein paar auf gewisse Farbenakkorde und
besonders auf Zusammenstellungen des
feinen alten Berliner Eisen- und Bosen-
rot gerichtete Wünsche ausgesprochen
werden, deren Erfüllung nur dazu bei-
tragen wird, alte Lorbeeren im Euhmes-
kranze der Fabrik wieder aufzufrischen.
Dass übrigens auch fremde Verdienste
allerjüngster Zeit nicht vergessen werden,
beweist die Würdigung der Leistungen
Salvetats in Sevres mit einer neuen kaolin-
haltigen Masse, welche bei weicher Glasur
eine der alten päte tendre ähnliche Far-
benbehandlung zeigt, sowie der seit eini-
ger Zeit ebendaselbst erzielten pracht-
vollen farbigen Glasuren im Charakter
chinesischer „porcelaines flambees".
Ein interessanter Bestand des Ham-
burger Museums sind sechs Modelle aus
rotem Wachs auf Schieferplatten, die
der Hand des Louis Simon Boizot zu-
geschrieben werden und die, wie man
an einem Dutzend solcher (auch die
Nachbildungen nach den Hamburger
Originalen in sich schließenden) Sevres-
platten im Schweriner Museum sehen
kann, dazu bestimmt waren, in Weiß
auf blauem Grunde ausgeführt zu wer-
den und damit etwas in äußerer Er-
scheinung der Jasper-Masse Wedgwoods
Entsprechendes hervorzubringen. Doch
fehlt, wie es ja beim Porzellan über-
haupt nicht erreicht worden ist, die
Färbung in der Masse, welche Wedg-
wood seinem Steingut zu geben wusste.
Dagegen überbietet die Feinheit und
Schönheit dieser französischen Beliefs
alles, was jemals von Flaxman und
anderen Modelleuren in der englischen
Etruria geleistet worden. Dennoch ge-
lang es dieser Etruria und ihren Schwes-
Kleine Siegburger Schnelle.
Krug von Fayence mit Blaumalerei.
Norddeutsche Arbeit, >/a nat. Größe.
terfabriken, mit jenen im klassizirenden
Zopfstil hergestellten und durch größere
praktische Brauchbarkeit ausgezeichneten
Erzeugnissen aller Art, besonders mit der
verhältnismässig zu billigen Preisen ab-
gegebenen „Cream Ware", wie bekannt
ist, den ganzen europäischen Markt zu er-
obern und damit allen älteren Betrieben
von Fayence mit Zinnglasur den Todes-
stoß zu versetzen. Sie waren freilich
auch wieder die Ursache, dass allerorten
in Deutschland und anderswo die Stein-
gutfabrikation aufkam, zu deren älteren
Produkten auch ein gut Teil jener aus-
gezeichnet dekorirten roten Ware aus
Flaue a. d. Havel und aus Bayreuth zu
rechnen sein möchte, die sich im Anschluss
an das in Meißen leider bald wieder fallen
gelassene rote Böttger'sche Steinzeug ent-
wickelte. Das hierüber geschriebene Ka-
pitel (S. 489 ff.) ist von besonderem In-
teresse. Von den eindringendsten Studien
zeugen endlich auch die schwierigen Ma-
terien der persischen und kleinasiatischen
Fayencen sowie der chinesischen Porzel-
lane, bei deren Behandlung einigen der
herkömmlichen, immer noch nicht abge-
thanenen irrtümlichen Annahmen, z. B.
denen über die Rhodos- oder Lindos-
Teller, das sog. Mandarinenporzellan
und das für Siam gearbeitete chinesische
Exportporzellan, gründlich ins Gesicht
geleuchtet wird. Einen eigentümlichen
Trost gewährt eine über die jüngere
verwilderte chinesische Porzellanindus-
trie gemachte Bemerkung, die darauf
hinweist, dass sie neuerdings im Dien-
ste der Fälscherindustrie an der Nach-
ahmung alter Seltenheiten wieder et-
was zu erstarken anfange. Nirgends
aber ist der Verfasser besser zu Hause,
als in der wundervollen japanischen
Keramik, die, wie man weiß, seit vielen
Jahren eines seiner Lieblingsgebiete ist.
Das darüber geschriebene Kapitel, in
welchem die für die Entwickelung der
japanischen Töpferkunst so überaus
wichtig gewordenen Vereinigungen der
Männer zu gemeinsamem Theetrinken
und gebildeter Unterhaltung, die sog.
Chanoju, ausführlich geschildert werden,
ist voll feinsinniger Bemerkungen über
die Unterschiede japanischer und euro-
päischer Kunst- und Lebensanschauungen
(man lese nur die Bemerkungen über Sat-
197
Zeilen zur Geltung zu bringen weiß. Ein
anziehendes Kapitel dieser Art ist das von
Nymphenburg. Die einzige Fabrik, wel-
che die lebensgefährlichen Sandbänke des
klassizirenden Zopfes und des daraus her-
vorgehenden, an sich selbstverständlich
nicht gering zu achtenden Neohellenismus
mit Hülfe bedeutender Kräfte und Mittel
glücklich überwunden und sich zu wirklich
ganz hervorragenden Leistungen wieder
empor geschwungen hat, ist die König-
liche Porzellan-Manufactur zu Berlin. Um
so weniger wird es die verdienten Leiter
derselben verdrießen, wenn auf S. 441
ein paar auf gewisse Farbenakkorde und
besonders auf Zusammenstellungen des
feinen alten Berliner Eisen- und Bosen-
rot gerichtete Wünsche ausgesprochen
werden, deren Erfüllung nur dazu bei-
tragen wird, alte Lorbeeren im Euhmes-
kranze der Fabrik wieder aufzufrischen.
Dass übrigens auch fremde Verdienste
allerjüngster Zeit nicht vergessen werden,
beweist die Würdigung der Leistungen
Salvetats in Sevres mit einer neuen kaolin-
haltigen Masse, welche bei weicher Glasur
eine der alten päte tendre ähnliche Far-
benbehandlung zeigt, sowie der seit eini-
ger Zeit ebendaselbst erzielten pracht-
vollen farbigen Glasuren im Charakter
chinesischer „porcelaines flambees".
Ein interessanter Bestand des Ham-
burger Museums sind sechs Modelle aus
rotem Wachs auf Schieferplatten, die
der Hand des Louis Simon Boizot zu-
geschrieben werden und die, wie man
an einem Dutzend solcher (auch die
Nachbildungen nach den Hamburger
Originalen in sich schließenden) Sevres-
platten im Schweriner Museum sehen
kann, dazu bestimmt waren, in Weiß
auf blauem Grunde ausgeführt zu wer-
den und damit etwas in äußerer Er-
scheinung der Jasper-Masse Wedgwoods
Entsprechendes hervorzubringen. Doch
fehlt, wie es ja beim Porzellan über-
haupt nicht erreicht worden ist, die
Färbung in der Masse, welche Wedg-
wood seinem Steingut zu geben wusste.
Dagegen überbietet die Feinheit und
Schönheit dieser französischen Beliefs
alles, was jemals von Flaxman und
anderen Modelleuren in der englischen
Etruria geleistet worden. Dennoch ge-
lang es dieser Etruria und ihren Schwes-
Kleine Siegburger Schnelle.
Krug von Fayence mit Blaumalerei.
Norddeutsche Arbeit, >/a nat. Größe.
terfabriken, mit jenen im klassizirenden
Zopfstil hergestellten und durch größere
praktische Brauchbarkeit ausgezeichneten
Erzeugnissen aller Art, besonders mit der
verhältnismässig zu billigen Preisen ab-
gegebenen „Cream Ware", wie bekannt
ist, den ganzen europäischen Markt zu er-
obern und damit allen älteren Betrieben
von Fayence mit Zinnglasur den Todes-
stoß zu versetzen. Sie waren freilich
auch wieder die Ursache, dass allerorten
in Deutschland und anderswo die Stein-
gutfabrikation aufkam, zu deren älteren
Produkten auch ein gut Teil jener aus-
gezeichnet dekorirten roten Ware aus
Flaue a. d. Havel und aus Bayreuth zu
rechnen sein möchte, die sich im Anschluss
an das in Meißen leider bald wieder fallen
gelassene rote Böttger'sche Steinzeug ent-
wickelte. Das hierüber geschriebene Ka-
pitel (S. 489 ff.) ist von besonderem In-
teresse. Von den eindringendsten Studien
zeugen endlich auch die schwierigen Ma-
terien der persischen und kleinasiatischen
Fayencen sowie der chinesischen Porzel-
lane, bei deren Behandlung einigen der
herkömmlichen, immer noch nicht abge-
thanenen irrtümlichen Annahmen, z. B.
denen über die Rhodos- oder Lindos-
Teller, das sog. Mandarinenporzellan
und das für Siam gearbeitete chinesische
Exportporzellan, gründlich ins Gesicht
geleuchtet wird. Einen eigentümlichen
Trost gewährt eine über die jüngere
verwilderte chinesische Porzellanindus-
trie gemachte Bemerkung, die darauf
hinweist, dass sie neuerdings im Dien-
ste der Fälscherindustrie an der Nach-
ahmung alter Seltenheiten wieder et-
was zu erstarken anfange. Nirgends
aber ist der Verfasser besser zu Hause,
als in der wundervollen japanischen
Keramik, die, wie man weiß, seit vielen
Jahren eines seiner Lieblingsgebiete ist.
Das darüber geschriebene Kapitel, in
welchem die für die Entwickelung der
japanischen Töpferkunst so überaus
wichtig gewordenen Vereinigungen der
Männer zu gemeinsamem Theetrinken
und gebildeter Unterhaltung, die sog.
Chanoju, ausführlich geschildert werden,
ist voll feinsinniger Bemerkungen über
die Unterschiede japanischer und euro-
päischer Kunst- und Lebensanschauungen
(man lese nur die Bemerkungen über Sat-