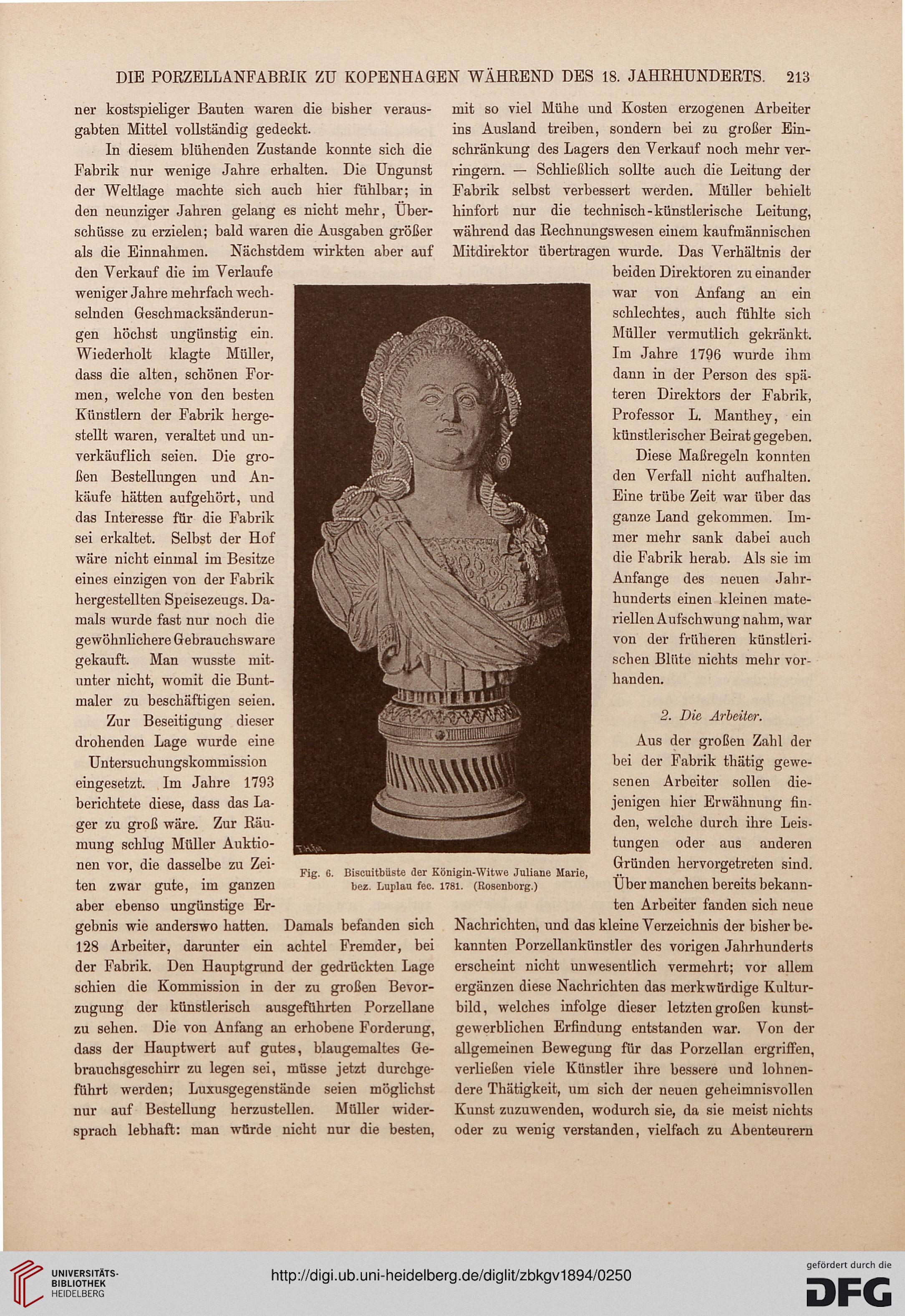DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 213
ner kostspieliger Bauten waren die bisher veraus-
gabten Mittel vollständig gedeckt.
In diesem blühenden Zustande konnte sich die
Fabrik nur wenige Jahre erhalten. Die Ungunst
der Weltlage machte sich auch hier fühlbar; in
den neunziger Jahren gelang es nicht mehr, Über-
schüsse zu erzielen; bald waren die Ausgaben größer
als die Einnahmen. Nächstdem wirkten aber auf
den Verkauf die im Verlaufe
weniger Jahre mehrfach wech-
selnden Geschmacksänderun-
gen höchst ungünstig ein.
Wiederholt klagte Müller,
dass die alten, schönen For-
men, welche von den besten
Künstlern der Fabrik herge-
stellt waren, veraltet und un-
verkäuflich seien. Die gro-
ßen Bestellungen und An-
käufe hätten aufgehört, und
das Interesse für die Fabrik
sei erkaltet. Selbst der Hof
wäre nicht einmal im Besitze
eines einzigen von der Fabrik
hergestellten Speisezeugs. Da-
mals wurde fast nur noch die
gewöhnlichere Gebrauchsware
gekauft. Man wusste mit-
unter nicht, womit die Bunt-
maler zu beschäftigen seien.
Zur Beseitigung dieser
drohenden Lage wurde eine
Untersuchungskommission
eingesetzt. Im Jahre 1793
berichtete diese, dass das La-
ger zu groß wäre. Zur Räu-
mung schlug Müller Auktio-
nen vor, die dasselbe zu Zei-
ten zwar gute, im ganzen
aber ebenso ungünstige Er-
gebnis wie anderswo hatten.
128 Arbeiter, darunter ein
der Fabrik. Den Hauptgrund der gedrückten Lage
schien die Kommission in der zu großen Bevor-
zugung der künstlerisch ausgeführten Porzellane
zu sehen. Die von Anfang an erhobene Forderung,
dass der Hauptwert auf gutes, blaugemaltes Ge-
brauchsgeschirr zu legen sei, müsse jetzt durchge-
führt werden; Luxusgegenstände seien möglichst
nur auf Bestellung herzustellen. Müller wider-
sprach lebhaft: man würde nicht nur die besten,
Fig. 6.
Damals befanden sich
achtel Fremder, bei
mit so viel Mühe und Kosten erzogenen Arbeiter
ins Ausland treiben, sondern bei zu großer Ein-
schränkung des Lagers den Verkauf noch mehr ver-
ringern. — Schließlich sollte auch die Leitung der
Fabrik selbst verbessert werden. Müller behielt
hinfort nur die technisch-künstlerische Leitung,
während das Rechnungswesen einem kaufmännischen
Mitdirektor übertragen wurde. Das Verhältnis der
beiden Direktoren zu einander
war von Anfang an ein
schlechtes, auch fühlte sich
Müller vermutlich gekränkt.
Im Jahre 1796 wurde ihm
dann in der Person des spä-
teren Direktors der Fabrik,
Professor L. Manthey, ein
künstlerischer Beirat gegeben.
Diese Maßregeln konnten
den Verfall nicht aufhalten.
Eine trübe Zeit war über das
ganze Land gekommen. Im-
mer mehr sank dabei auch
die Fabrik herab. Als sie im
Anfange des neuen Jahr-
hunderts einen kleinen mate-
riellen Aufschwung nahm, war
von der früheren künstleri-
schen Blüte nichts mehr vor-
handen.
2. Die Arbeiter.
Aus der großen Zahl der
bei der Fabrik thätig gewe-
senen Arbeiter sollen die-
jenigen hier Erwähnung fin-
den, welche durch ihre Leis-
tungen oder aus anderen
Gründen hervorgetreten sind.
Über manchen bereits bekann-
ten Arbeiter fanden sich neue
Nachrichten, und das kleine Verzeichnis der bisher be-
kannten Porzellankünstler des vorigen Jahrhunderts
erscheint nicht unwesentlich vermehrt; vor allem
ergänzen diese Nachrichten das merkwürdige Kultur-
bild, welches infolge dieser letzten großen kunst-
gewerblichen Erfindung entstanden war. Von der
allgemeinen Bewegung für das Porzellan ergriffen,
verließen viele Künstler ihre bessere und lohnen-
dere Thätigkeit, um sich der neuen geheimnisvollen
Kunst zuzuwenden, wodurch sie, da sie meist nichts
oder zu wenig verstanden, vielfach zu Abenteurern
Biscuitbüste der Königin-Witwe Juliane Marie,
bez. Luplau fee. 1781. (Rosenborg.)
ner kostspieliger Bauten waren die bisher veraus-
gabten Mittel vollständig gedeckt.
In diesem blühenden Zustande konnte sich die
Fabrik nur wenige Jahre erhalten. Die Ungunst
der Weltlage machte sich auch hier fühlbar; in
den neunziger Jahren gelang es nicht mehr, Über-
schüsse zu erzielen; bald waren die Ausgaben größer
als die Einnahmen. Nächstdem wirkten aber auf
den Verkauf die im Verlaufe
weniger Jahre mehrfach wech-
selnden Geschmacksänderun-
gen höchst ungünstig ein.
Wiederholt klagte Müller,
dass die alten, schönen For-
men, welche von den besten
Künstlern der Fabrik herge-
stellt waren, veraltet und un-
verkäuflich seien. Die gro-
ßen Bestellungen und An-
käufe hätten aufgehört, und
das Interesse für die Fabrik
sei erkaltet. Selbst der Hof
wäre nicht einmal im Besitze
eines einzigen von der Fabrik
hergestellten Speisezeugs. Da-
mals wurde fast nur noch die
gewöhnlichere Gebrauchsware
gekauft. Man wusste mit-
unter nicht, womit die Bunt-
maler zu beschäftigen seien.
Zur Beseitigung dieser
drohenden Lage wurde eine
Untersuchungskommission
eingesetzt. Im Jahre 1793
berichtete diese, dass das La-
ger zu groß wäre. Zur Räu-
mung schlug Müller Auktio-
nen vor, die dasselbe zu Zei-
ten zwar gute, im ganzen
aber ebenso ungünstige Er-
gebnis wie anderswo hatten.
128 Arbeiter, darunter ein
der Fabrik. Den Hauptgrund der gedrückten Lage
schien die Kommission in der zu großen Bevor-
zugung der künstlerisch ausgeführten Porzellane
zu sehen. Die von Anfang an erhobene Forderung,
dass der Hauptwert auf gutes, blaugemaltes Ge-
brauchsgeschirr zu legen sei, müsse jetzt durchge-
führt werden; Luxusgegenstände seien möglichst
nur auf Bestellung herzustellen. Müller wider-
sprach lebhaft: man würde nicht nur die besten,
Fig. 6.
Damals befanden sich
achtel Fremder, bei
mit so viel Mühe und Kosten erzogenen Arbeiter
ins Ausland treiben, sondern bei zu großer Ein-
schränkung des Lagers den Verkauf noch mehr ver-
ringern. — Schließlich sollte auch die Leitung der
Fabrik selbst verbessert werden. Müller behielt
hinfort nur die technisch-künstlerische Leitung,
während das Rechnungswesen einem kaufmännischen
Mitdirektor übertragen wurde. Das Verhältnis der
beiden Direktoren zu einander
war von Anfang an ein
schlechtes, auch fühlte sich
Müller vermutlich gekränkt.
Im Jahre 1796 wurde ihm
dann in der Person des spä-
teren Direktors der Fabrik,
Professor L. Manthey, ein
künstlerischer Beirat gegeben.
Diese Maßregeln konnten
den Verfall nicht aufhalten.
Eine trübe Zeit war über das
ganze Land gekommen. Im-
mer mehr sank dabei auch
die Fabrik herab. Als sie im
Anfange des neuen Jahr-
hunderts einen kleinen mate-
riellen Aufschwung nahm, war
von der früheren künstleri-
schen Blüte nichts mehr vor-
handen.
2. Die Arbeiter.
Aus der großen Zahl der
bei der Fabrik thätig gewe-
senen Arbeiter sollen die-
jenigen hier Erwähnung fin-
den, welche durch ihre Leis-
tungen oder aus anderen
Gründen hervorgetreten sind.
Über manchen bereits bekann-
ten Arbeiter fanden sich neue
Nachrichten, und das kleine Verzeichnis der bisher be-
kannten Porzellankünstler des vorigen Jahrhunderts
erscheint nicht unwesentlich vermehrt; vor allem
ergänzen diese Nachrichten das merkwürdige Kultur-
bild, welches infolge dieser letzten großen kunst-
gewerblichen Erfindung entstanden war. Von der
allgemeinen Bewegung für das Porzellan ergriffen,
verließen viele Künstler ihre bessere und lohnen-
dere Thätigkeit, um sich der neuen geheimnisvollen
Kunst zuzuwenden, wodurch sie, da sie meist nichts
oder zu wenig verstanden, vielfach zu Abenteurern
Biscuitbüste der Königin-Witwe Juliane Marie,
bez. Luplau fee. 1781. (Rosenborg.)