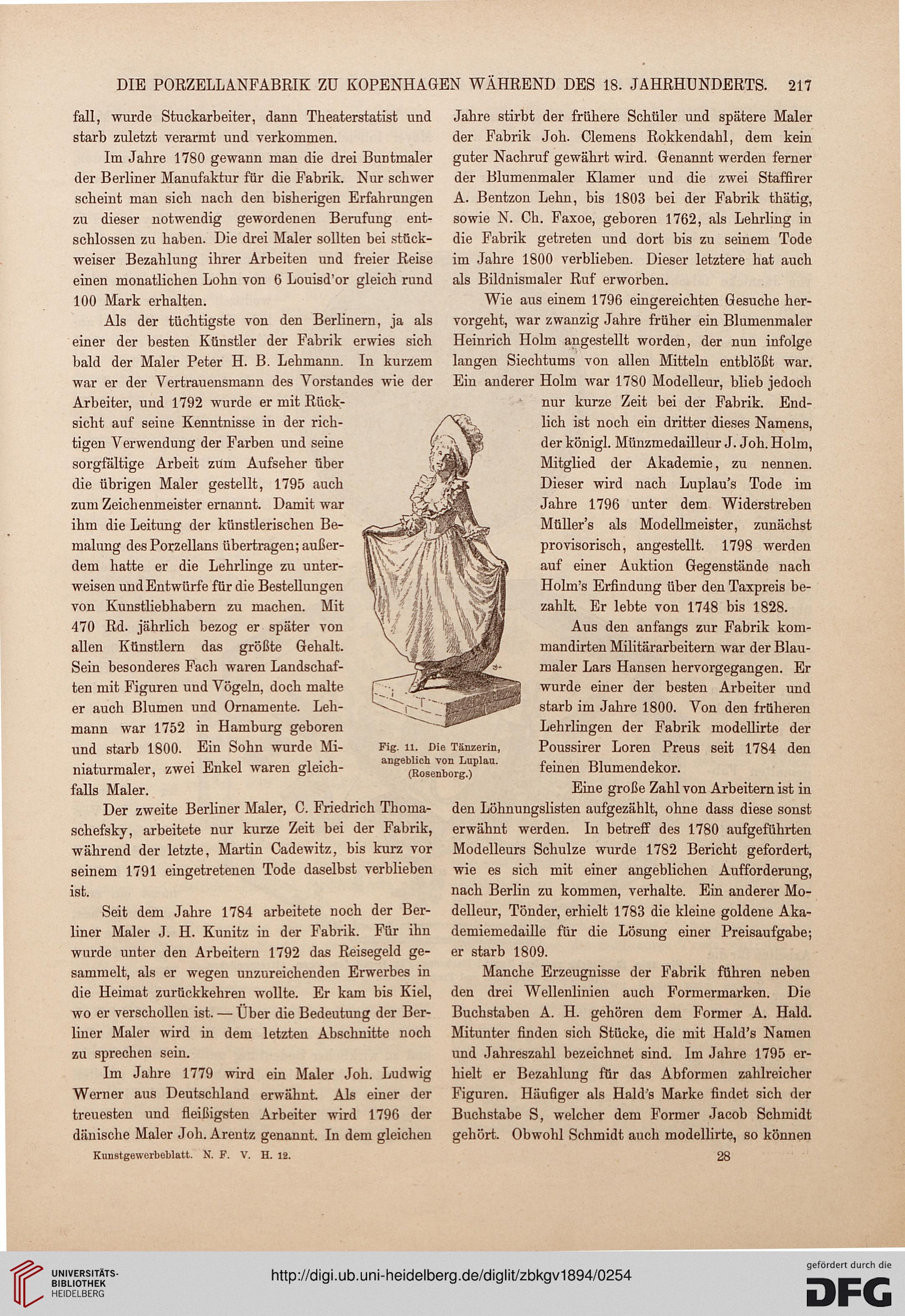DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 217
fall, wurde Stuckarbeiter, dann Theaterstatist und
starb zuletzt verarmt und verkommen.
Im Jahre 1780 gewann man die drei Buntmaler
der Berliner Manufaktur für die Fabrik. Nur schwer
scheint man sich nach den bisherigen Erfahrungen
zu dieser notwendig gewordenen Berufung ent-
schlossen zu haben. Die drei Maler sollten bei stück-
weiser Bezahlung ihrer Arbeiten und freier Reise
einen monatlichen Lohn von 6 Louisd'or gleich rund
100 Mark erhalten.
Als der tüchtigste von den Berlinern, ja als
einer der besten Künstler der Fabrik erwies sich
bald der Maler Peter H. B. Lehmann. In kurzem
war er der Vertrauensmann des Vorstandes wie der
Arbeiter, und 1792 wurde er mit Rück-
sicht auf seine Kenntnisse in der rich-
tigen Verwendung der Farben und seine
sorgfältige Arbeit zum Aufseher über
die übrigen Maler gestellt, 1795 auch
zum Zeichenmeister ernannt. Damit war
ihm die Leitung der künstlerischen Be-
malung des Porzellans übertragen; außer-
dem hatte er die Lehrlinge zu unter-
weisen und Entwürfe für die Bestellungen
von Kunstliebhabern zu machen. Mit
470 Rd. jährlich bezog er später von
allen Künstlern das größte Gehalt.
Sein besonderes Fach waren Landschaf-
ten mit Figuren und Vögeln, doch malte
er auch Blumen und Ornamente. Leh-
mann war 1752 in Hamburg geboren
und starb 1800. Ein Sohn wurde Mi-
niaturmaler, zwei Enkel waren gleich-
falls Maler.
Der zweite Berliner Maler, C. Friedrich Thoma-
schefsky, arbeitete nur kurze Zeit bei der Fabrik,
während der letzte, Martin Cadewitz, bis kurz vor
seinem 1791 eingetretenen Tode daselbst verblieben
ist.
Seit dem Jahre 1784 arbeitete noch der Ber-
liner Maler J. H. Kunitz in der Fabrik. Für ihn
wurde unter den Arbeitern 1792 das Reisegeld ge-
sammelt, als er wegen unzureichenden Erwerbes in
die Heimat zurückkehren wollte. Er kam bis Kiel,
wo er verschollen ist. — Über die Bedeutung der Ber-
liner Maler wird in dem letzten Abschnitte noch
zu sprechen sein.
Im Jahre 1779 wird ein Maler Joh. Ludwig
Werner aus Deutschland erwähnt. Als einer der
treuesten und fleißigsten Arbeiter wird 1796 der
dänische Maler Joh. Arentz genannt. In dem gleichen
Kunstgewerbeblatt. N. F. V. H. 12.
Fig. 11. Die Tänzerin,
angeblich von Luplau.
(Rosenborg.)
Jahre stirbt der frühere Schüler und spätere Maler
der Fabrik Joh. Clemens Rokkendahl, dem kein
guter Nachruf gewährt wird. Genannt werden ferner
der Blumenmaler Klamer und die zwei Staffirer
A. Bentzon Lehn, bis 1803 bei der Fabrik thätig,
sowie N. Ch. Faxoe, geboren 1762, als Lehrling in
die Fabrik getreten und dort bis zu seinem Tode
im Jahre 1800 verblieben. Dieser letztere hat auch
als Bildnismaler Ruf erworben.
Wie aus einem 1796 eingereichten Gesuche her-
vorgeht, war zwanzig Jahre früher ein Blumenmaler
Heinrich Holm angestellt worden, der nun infolge
langen Siechtums von allen Mitteln entblößt war.
Ein anderer Holm war 1780 Modelleur, blieb jedoch
nur kurze Zeit bei der Fabrik. End-
lich ist noch ein dritter dieses Namens,
der königl. Münzmedailleur J. Joh. Holm,
Mitglied der Akademie, zu nennen.
Dieser wird nach Luplau's Tode im
Jahre 1796 unter dem Widerstreben
Müllers als Modellmeister, zunächst
provisorisch, angestellt. 1798 werden
auf einer Auktion Gegenstände nach
Holm's Erfindung über den Taxpreis be-
zahlt. Er lebte von 1748 bis 1828.
Aus den anfangs zur Fabrik kom-
mandirten Militärarbeitern war der Blau-
maler Lars Hansen hervorgegangen. Er
wurde einer der besten Arbeiter und
starb im Jahre 1800. Von den früheren
Lehrlingen der Fabrik modellirte der
Poussirer Loren Preus seit 1784 den
feinen Blumendekor.
Eine große Zahl von Arbeitern ist in
den Löhnungslisten aufgezählt, ohne dass diese sonst
erwähnt werden. In betreff des 1780 aufgeführten
Modelleurs Schulze wurde 1782 Bericht gefordert,
wie es sich mit einer angeblichen Aufforderung,
nach Berlin zu kommen, verhalte. Ein anderer Mo-
delleur, Tönder, erhielt 1783 die kleine goldene Aka-
demiemedaille für die Lösung einer Preisaufgabe;
er starb 1809.
Manche Erzeugnisse der Fabrik führen neben
den drei Wellenlinien auch Formermarken. Die
Buchstaben A. H. gehören dem Former A. Hald.
Mitunter finden sich Stücke, die mit Hald's Namen
und Jahreszahl bezeichnet sind. Im Jahre 1795 er-
hielt er Bezahlung für das Abformen zahlreicher
Figuren. Häufiger als Hald's Marke findet sich der
Buchstabe S, welcher dem Former Jacob Schmidt
gehört. Obwohl Schmidt auch modellirte, so können
28
fall, wurde Stuckarbeiter, dann Theaterstatist und
starb zuletzt verarmt und verkommen.
Im Jahre 1780 gewann man die drei Buntmaler
der Berliner Manufaktur für die Fabrik. Nur schwer
scheint man sich nach den bisherigen Erfahrungen
zu dieser notwendig gewordenen Berufung ent-
schlossen zu haben. Die drei Maler sollten bei stück-
weiser Bezahlung ihrer Arbeiten und freier Reise
einen monatlichen Lohn von 6 Louisd'or gleich rund
100 Mark erhalten.
Als der tüchtigste von den Berlinern, ja als
einer der besten Künstler der Fabrik erwies sich
bald der Maler Peter H. B. Lehmann. In kurzem
war er der Vertrauensmann des Vorstandes wie der
Arbeiter, und 1792 wurde er mit Rück-
sicht auf seine Kenntnisse in der rich-
tigen Verwendung der Farben und seine
sorgfältige Arbeit zum Aufseher über
die übrigen Maler gestellt, 1795 auch
zum Zeichenmeister ernannt. Damit war
ihm die Leitung der künstlerischen Be-
malung des Porzellans übertragen; außer-
dem hatte er die Lehrlinge zu unter-
weisen und Entwürfe für die Bestellungen
von Kunstliebhabern zu machen. Mit
470 Rd. jährlich bezog er später von
allen Künstlern das größte Gehalt.
Sein besonderes Fach waren Landschaf-
ten mit Figuren und Vögeln, doch malte
er auch Blumen und Ornamente. Leh-
mann war 1752 in Hamburg geboren
und starb 1800. Ein Sohn wurde Mi-
niaturmaler, zwei Enkel waren gleich-
falls Maler.
Der zweite Berliner Maler, C. Friedrich Thoma-
schefsky, arbeitete nur kurze Zeit bei der Fabrik,
während der letzte, Martin Cadewitz, bis kurz vor
seinem 1791 eingetretenen Tode daselbst verblieben
ist.
Seit dem Jahre 1784 arbeitete noch der Ber-
liner Maler J. H. Kunitz in der Fabrik. Für ihn
wurde unter den Arbeitern 1792 das Reisegeld ge-
sammelt, als er wegen unzureichenden Erwerbes in
die Heimat zurückkehren wollte. Er kam bis Kiel,
wo er verschollen ist. — Über die Bedeutung der Ber-
liner Maler wird in dem letzten Abschnitte noch
zu sprechen sein.
Im Jahre 1779 wird ein Maler Joh. Ludwig
Werner aus Deutschland erwähnt. Als einer der
treuesten und fleißigsten Arbeiter wird 1796 der
dänische Maler Joh. Arentz genannt. In dem gleichen
Kunstgewerbeblatt. N. F. V. H. 12.
Fig. 11. Die Tänzerin,
angeblich von Luplau.
(Rosenborg.)
Jahre stirbt der frühere Schüler und spätere Maler
der Fabrik Joh. Clemens Rokkendahl, dem kein
guter Nachruf gewährt wird. Genannt werden ferner
der Blumenmaler Klamer und die zwei Staffirer
A. Bentzon Lehn, bis 1803 bei der Fabrik thätig,
sowie N. Ch. Faxoe, geboren 1762, als Lehrling in
die Fabrik getreten und dort bis zu seinem Tode
im Jahre 1800 verblieben. Dieser letztere hat auch
als Bildnismaler Ruf erworben.
Wie aus einem 1796 eingereichten Gesuche her-
vorgeht, war zwanzig Jahre früher ein Blumenmaler
Heinrich Holm angestellt worden, der nun infolge
langen Siechtums von allen Mitteln entblößt war.
Ein anderer Holm war 1780 Modelleur, blieb jedoch
nur kurze Zeit bei der Fabrik. End-
lich ist noch ein dritter dieses Namens,
der königl. Münzmedailleur J. Joh. Holm,
Mitglied der Akademie, zu nennen.
Dieser wird nach Luplau's Tode im
Jahre 1796 unter dem Widerstreben
Müllers als Modellmeister, zunächst
provisorisch, angestellt. 1798 werden
auf einer Auktion Gegenstände nach
Holm's Erfindung über den Taxpreis be-
zahlt. Er lebte von 1748 bis 1828.
Aus den anfangs zur Fabrik kom-
mandirten Militärarbeitern war der Blau-
maler Lars Hansen hervorgegangen. Er
wurde einer der besten Arbeiter und
starb im Jahre 1800. Von den früheren
Lehrlingen der Fabrik modellirte der
Poussirer Loren Preus seit 1784 den
feinen Blumendekor.
Eine große Zahl von Arbeitern ist in
den Löhnungslisten aufgezählt, ohne dass diese sonst
erwähnt werden. In betreff des 1780 aufgeführten
Modelleurs Schulze wurde 1782 Bericht gefordert,
wie es sich mit einer angeblichen Aufforderung,
nach Berlin zu kommen, verhalte. Ein anderer Mo-
delleur, Tönder, erhielt 1783 die kleine goldene Aka-
demiemedaille für die Lösung einer Preisaufgabe;
er starb 1809.
Manche Erzeugnisse der Fabrik führen neben
den drei Wellenlinien auch Formermarken. Die
Buchstaben A. H. gehören dem Former A. Hald.
Mitunter finden sich Stücke, die mit Hald's Namen
und Jahreszahl bezeichnet sind. Im Jahre 1795 er-
hielt er Bezahlung für das Abformen zahlreicher
Figuren. Häufiger als Hald's Marke findet sich der
Buchstabe S, welcher dem Former Jacob Schmidt
gehört. Obwohl Schmidt auch modellirte, so können
28