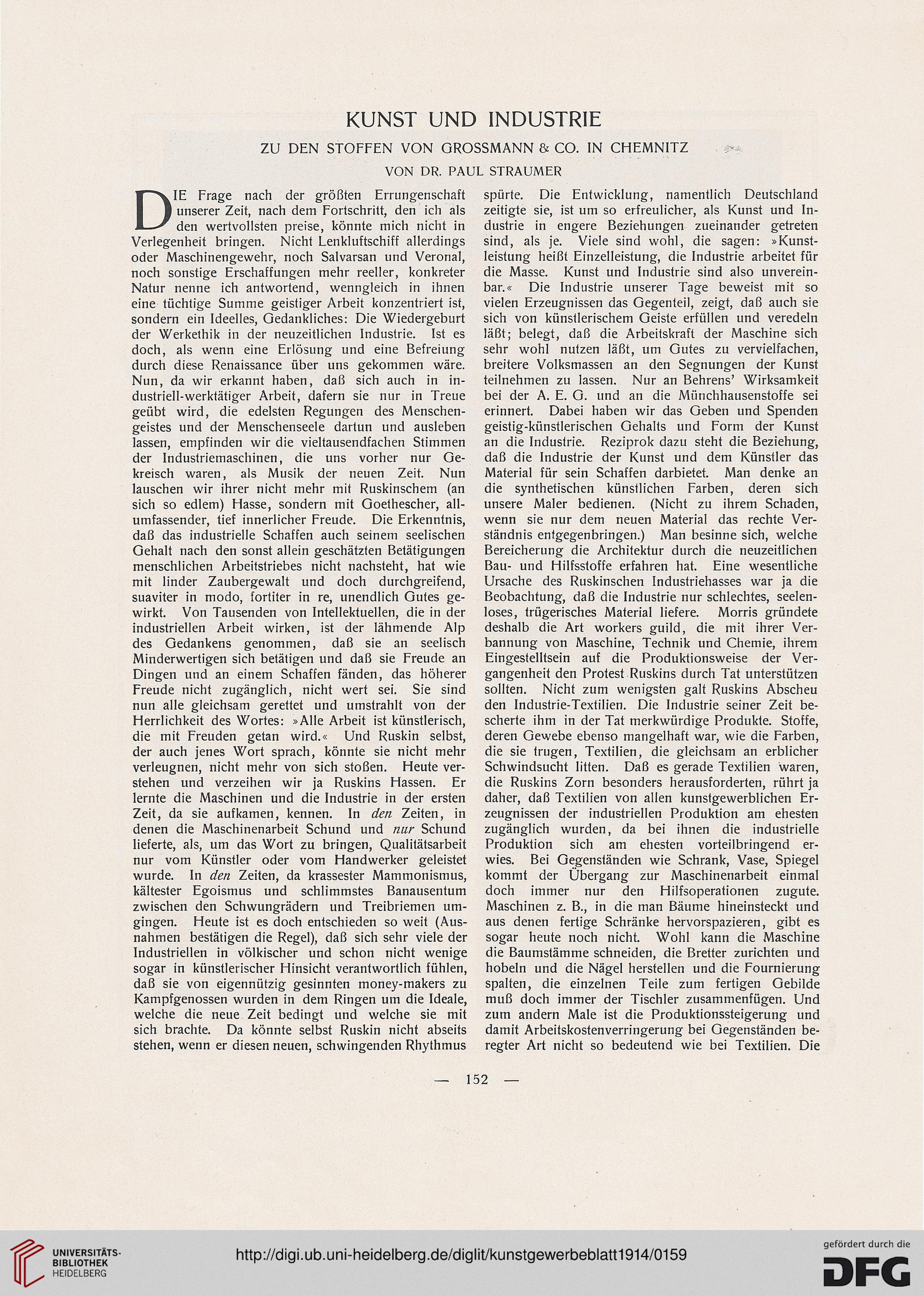KUNST UND INDUSTRIE
ZU DEN STOFFEN VON OROSSMANN & CO. IN CHEMNITZ
VON DR. PAUL STRAUMER
DIE Frage nach der größten Errungenschaft
unserer Zeit, nach dem Fortschritt, den ich als
den wertvollsten preise, könnte mich nicht in
Verlegenheit bringen. Nicht Lenkluftschiff allerdings
oder Maschinengewehr, noch Salvarsan und Veronal,
noch sonstige Erschaffungen mehr reeller, konkreter
Natur nenne ich antwortend, wenngleich in ihnen
eine tüchtige Summe geistiger Arbeit konzentriert ist,
sondern ein Ideelles, Gedankliches: Die Wiedergeburt
der Werkethik in der neuzeitlichen Industrie. Ist es
doch, als wenn eine Erlösung und eine Befreiung
durch diese Renaissance über uns gekommen wäre.
Nun, da wir erkannt haben, daß sich auch in in-
dustriell-werktätiger Arbeit, dafern sie nur in Treue
geübt wird, die edelsten Regungen des Menschen-
geistes und der Menschenseele dartun und ausleben
lassen, empfinden wir die vieltausendfachen Stimmen
der Industriemaschinen, die uns vorher nur Ge-
kreisch waren, als Musik der neuen Zeit. Nun
lauschen wir ihrer nicht mehr mit Ruskinschem (an
sich so edlem) Hasse, sondern mit Goethescher, all-
umfassender, tief innerlicher Freude. Die Erkenntnis,
daß das industrielle Schaffen auch seinem seelischen
Gehalt nach den sonst allein geschätzten Betätigungen
menschlichen Arbeitstriebes nicht nachsteht, hat wie
mit linder Zaubergewalt und doch durchgreifend,
suaviter in modo, fortiter in re, unendlich Gutes ge-
wirkt. Von Tausenden von Intellektuellen, die in der
industriellen Arbeit wirken, ist der lähmende Alp
des Gedankens genommen, daß sie an seelisch
Minderwertigen sich betätigen und daß sie Freude an
Dingen und an einem Schaffen fänden, das höherer
Freude nicht zugänglich, nicht wert sei. Sie sind
nun alle gleichsam gerettet und umstrahlt von der
Herrlichkeit des Wortes: »Alle Arbeit ist künstlerisch,
die mit Freuden getan wird.« Und Ruskin selbst,
der auch jenes Wort sprach, könnte sie nicht mehr
verleugnen, nicht mehr von sich stoßen. Heute ver-
stehen und verzeihen wir ja Ruskins Hassen. Er
lernte die Maschinen und die Industrie in der ersten
Zeit, da sie auf kamen, kennen. In den Zeiten, in
denen die Maschinenarbeit Schund und nur Schund
lieferte, als, um das Wort zu bringen, Qualitätsarbeit
nur vom Künstler oder vom Handwerker geleistet
wurde. In den Zeiten, da krassester Mammonismus,
kältester Egoismus und schlimmstes Banausentum
zwischen den Schwungrädern und Treibriemen um-
gingen. Heute ist es doch entschieden so weit (Aus-
nahmen bestätigen die Regel), daß sich sehr viele der
Industriellen in völkischer und schon nicht wenige
sogar in künstlerischer Hinsicht verantwortlich fühlen,
daß sie von eigennützig gesinnten money-makers zu
Kampfgenossen wurden in dem Ringen um die Ideale,
welche die neue Zeit bedingt und welche sie mit
sich brachte. Da könnte selbst Ruskin nicht abseits
stehen, wenn er diesen neuen, schwingenden Rhythmus
spürte. Die Entwicklung, namentlich Deutschland
zeitigte sie, ist um so erfreulicher, als Kunst und In-
dustrie in engere Beziehungen zueinander getreten
sind, als je. Viele sind wohl, die sagen: »Kunst-
leistung heißt Einzelleistung, die Industrie arbeitet für
die Masse. Kunst und Industrie sind also unverein-
bar.« Die Industrie unserer Tage beweist mit so
vielen Erzeugnissen das Gegenteil, zeigt, daß auch sie
sich von künstlerischem Geiste erfüllen und veredeln
läßt; belegt, daß die Arbeitskraft der Maschine sich
sehr wohl nutzen läßt, um Gutes zu vervielfachen,
breitere Volksmassen an den Segnungen der Kunst
teilnehmen zu lassen. Nur an Behrens’ Wirksamkeit
bei der A. E. G. und an die Münchhausenstoffe sei
erinnert. Dabei haben wir das Geben und Spenden
geistig-künstlerischen Gehalts und Form der Kunst
an die Industrie. Reziprok dazu steht die Beziehung,
daß die Industrie der Kunst und dem Künstler das
Material für sein Schaffen darbietet. Man denke an
die synthetischen künstlichen Farben, deren sich
unsere Maler bedienen. (Nicht zu ihrem Schaden,
wenn sie nur dem neuen Material das rechte Ver-
ständnis entgegenbringen.) Man besinne sich, welche
Bereicherung die Architektur durch die neuzeitlichen
Bau- und Hilfsstoffe erfahren hat. Eine wesentliche
Ursache des Ruskinschen Industriehasses war ja die
Beobachtung, daß die Industrie nur schlechtes, seelen-
loses, trügerisches Material liefere. Morris gründete
deshalb die Art workers guild, die mit ihrer Ver-
bannung von Maschine, Technik und Chemie, ihrem
Eingestelltsein auf die Produktionsweise der Ver-
gangenheit den Protest Ruskins durch Tat unterstützen
sollten. Nicht zum wenigsten galt Ruskins Abscheu
den Industrie-Textilien. Die Industrie seiner Zeit be-
scherte ihm in der Tat merkwürdige Produkte. Stoffe,
deren Gewebe ebenso mangelhaft war, wie die Farben,
die sie trugen, Textilien, die gleichsam an erblicher
Schwindsucht litten. Daß es gerade Textilien waren,
die Ruskins Zorn besonders herausforderten, rührt ja
daher, daß Textilien von allen kunstgewerblichen Er-
zeugnissen der industriellen Produktion am ehesten
zugänglich wurden, da bei ihnen die industrielle
Produktion sich am ehesten vorteilbringend er-
wies. Bei Gegenständen wie Schrank, Vase, Spiegel
kommt der Übergang zur Maschinenarbeit einmal
doch immer nur den Hilfsoperationen zugute.
Maschinen z. B., in die man Bäume hineinsteckt und
aus denen fertige Schränke hervorspazieren, gibt es
sogar heute noch nicht. Wohl kann die Maschine
die Baumstämme schneiden, die Bretter zurichten und
hobeln und die Nägel hersteilen und die Fournierung
spalten, die einzelnen Teile zum fertigen Gebilde
muß doch immer der Tischler zusammenfügen. Und
zum andern Male ist die Produktionssteigerung und
damit Arbeitskostenverringerung bei Gegenständen be-
regter Art nicht so bedeutend wie bei Textilien. Die
152
ZU DEN STOFFEN VON OROSSMANN & CO. IN CHEMNITZ
VON DR. PAUL STRAUMER
DIE Frage nach der größten Errungenschaft
unserer Zeit, nach dem Fortschritt, den ich als
den wertvollsten preise, könnte mich nicht in
Verlegenheit bringen. Nicht Lenkluftschiff allerdings
oder Maschinengewehr, noch Salvarsan und Veronal,
noch sonstige Erschaffungen mehr reeller, konkreter
Natur nenne ich antwortend, wenngleich in ihnen
eine tüchtige Summe geistiger Arbeit konzentriert ist,
sondern ein Ideelles, Gedankliches: Die Wiedergeburt
der Werkethik in der neuzeitlichen Industrie. Ist es
doch, als wenn eine Erlösung und eine Befreiung
durch diese Renaissance über uns gekommen wäre.
Nun, da wir erkannt haben, daß sich auch in in-
dustriell-werktätiger Arbeit, dafern sie nur in Treue
geübt wird, die edelsten Regungen des Menschen-
geistes und der Menschenseele dartun und ausleben
lassen, empfinden wir die vieltausendfachen Stimmen
der Industriemaschinen, die uns vorher nur Ge-
kreisch waren, als Musik der neuen Zeit. Nun
lauschen wir ihrer nicht mehr mit Ruskinschem (an
sich so edlem) Hasse, sondern mit Goethescher, all-
umfassender, tief innerlicher Freude. Die Erkenntnis,
daß das industrielle Schaffen auch seinem seelischen
Gehalt nach den sonst allein geschätzten Betätigungen
menschlichen Arbeitstriebes nicht nachsteht, hat wie
mit linder Zaubergewalt und doch durchgreifend,
suaviter in modo, fortiter in re, unendlich Gutes ge-
wirkt. Von Tausenden von Intellektuellen, die in der
industriellen Arbeit wirken, ist der lähmende Alp
des Gedankens genommen, daß sie an seelisch
Minderwertigen sich betätigen und daß sie Freude an
Dingen und an einem Schaffen fänden, das höherer
Freude nicht zugänglich, nicht wert sei. Sie sind
nun alle gleichsam gerettet und umstrahlt von der
Herrlichkeit des Wortes: »Alle Arbeit ist künstlerisch,
die mit Freuden getan wird.« Und Ruskin selbst,
der auch jenes Wort sprach, könnte sie nicht mehr
verleugnen, nicht mehr von sich stoßen. Heute ver-
stehen und verzeihen wir ja Ruskins Hassen. Er
lernte die Maschinen und die Industrie in der ersten
Zeit, da sie auf kamen, kennen. In den Zeiten, in
denen die Maschinenarbeit Schund und nur Schund
lieferte, als, um das Wort zu bringen, Qualitätsarbeit
nur vom Künstler oder vom Handwerker geleistet
wurde. In den Zeiten, da krassester Mammonismus,
kältester Egoismus und schlimmstes Banausentum
zwischen den Schwungrädern und Treibriemen um-
gingen. Heute ist es doch entschieden so weit (Aus-
nahmen bestätigen die Regel), daß sich sehr viele der
Industriellen in völkischer und schon nicht wenige
sogar in künstlerischer Hinsicht verantwortlich fühlen,
daß sie von eigennützig gesinnten money-makers zu
Kampfgenossen wurden in dem Ringen um die Ideale,
welche die neue Zeit bedingt und welche sie mit
sich brachte. Da könnte selbst Ruskin nicht abseits
stehen, wenn er diesen neuen, schwingenden Rhythmus
spürte. Die Entwicklung, namentlich Deutschland
zeitigte sie, ist um so erfreulicher, als Kunst und In-
dustrie in engere Beziehungen zueinander getreten
sind, als je. Viele sind wohl, die sagen: »Kunst-
leistung heißt Einzelleistung, die Industrie arbeitet für
die Masse. Kunst und Industrie sind also unverein-
bar.« Die Industrie unserer Tage beweist mit so
vielen Erzeugnissen das Gegenteil, zeigt, daß auch sie
sich von künstlerischem Geiste erfüllen und veredeln
läßt; belegt, daß die Arbeitskraft der Maschine sich
sehr wohl nutzen läßt, um Gutes zu vervielfachen,
breitere Volksmassen an den Segnungen der Kunst
teilnehmen zu lassen. Nur an Behrens’ Wirksamkeit
bei der A. E. G. und an die Münchhausenstoffe sei
erinnert. Dabei haben wir das Geben und Spenden
geistig-künstlerischen Gehalts und Form der Kunst
an die Industrie. Reziprok dazu steht die Beziehung,
daß die Industrie der Kunst und dem Künstler das
Material für sein Schaffen darbietet. Man denke an
die synthetischen künstlichen Farben, deren sich
unsere Maler bedienen. (Nicht zu ihrem Schaden,
wenn sie nur dem neuen Material das rechte Ver-
ständnis entgegenbringen.) Man besinne sich, welche
Bereicherung die Architektur durch die neuzeitlichen
Bau- und Hilfsstoffe erfahren hat. Eine wesentliche
Ursache des Ruskinschen Industriehasses war ja die
Beobachtung, daß die Industrie nur schlechtes, seelen-
loses, trügerisches Material liefere. Morris gründete
deshalb die Art workers guild, die mit ihrer Ver-
bannung von Maschine, Technik und Chemie, ihrem
Eingestelltsein auf die Produktionsweise der Ver-
gangenheit den Protest Ruskins durch Tat unterstützen
sollten. Nicht zum wenigsten galt Ruskins Abscheu
den Industrie-Textilien. Die Industrie seiner Zeit be-
scherte ihm in der Tat merkwürdige Produkte. Stoffe,
deren Gewebe ebenso mangelhaft war, wie die Farben,
die sie trugen, Textilien, die gleichsam an erblicher
Schwindsucht litten. Daß es gerade Textilien waren,
die Ruskins Zorn besonders herausforderten, rührt ja
daher, daß Textilien von allen kunstgewerblichen Er-
zeugnissen der industriellen Produktion am ehesten
zugänglich wurden, da bei ihnen die industrielle
Produktion sich am ehesten vorteilbringend er-
wies. Bei Gegenständen wie Schrank, Vase, Spiegel
kommt der Übergang zur Maschinenarbeit einmal
doch immer nur den Hilfsoperationen zugute.
Maschinen z. B., in die man Bäume hineinsteckt und
aus denen fertige Schränke hervorspazieren, gibt es
sogar heute noch nicht. Wohl kann die Maschine
die Baumstämme schneiden, die Bretter zurichten und
hobeln und die Nägel hersteilen und die Fournierung
spalten, die einzelnen Teile zum fertigen Gebilde
muß doch immer der Tischler zusammenfügen. Und
zum andern Male ist die Produktionssteigerung und
damit Arbeitskostenverringerung bei Gegenständen be-
regter Art nicht so bedeutend wie bei Textilien. Die
152