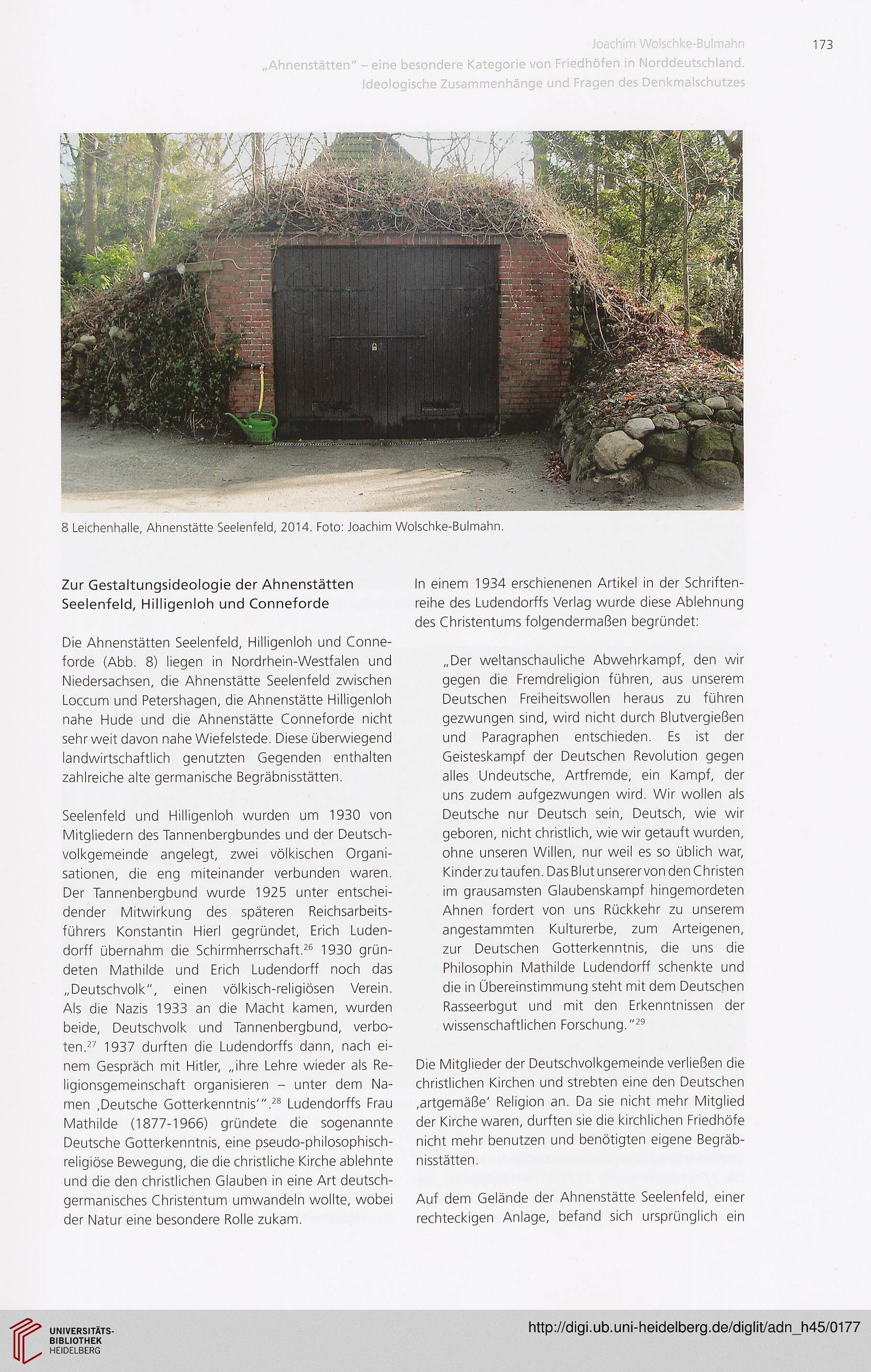Joachim Wolschke-Bulmahn
tätten" - eine besondere Kategorie von Friedhöfen in Norddeutschland.
Ideologische Zusammenhänge und Fragen des Denkmalschutzes
173
8 Leichenhalle, Ahnenstätte Seeienfeld, 2014. Foto: Joachim Wolschke-Bulmahn.
Zur Gestaltungsideologie der Ahnenstätten
Seelenfeld, Hilligenloh und Conneforde
Die Ahnenstätten Seelenfeld, Hilligenloh und Conne-
forde (Abb. 8) liegen in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen, die Ahnenstätte Seelenfeld zwischen
Loccum und Petershagen, die Ahnenstätte Hilligenloh
nahe Hude und die Ahnenstätte Conneforde nicht
sehr weit davon nahe Wiefelstede. Diese überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Gegenden enthalten
zahlreiche alte germanische Begräbnisstätten.
Seelenfeld und Hilligenloh wurden um 1930 von
Mitgliedern des Tannenbergbundes und der Deutsch-
volkgemeinde angelegt, zwei völkischen Organi-
sationen, die eng miteinander verbunden waren.
Der Tannenbergbund wurde 1925 unter entschei-
dender Mitwirkung des späteren Reichsarbeits-
führers Konstantin Hierl gegründet, Erich Luden-
dorff übernahm die Schirmherrschaft.26 1930 grün-
deten Mathilde und Erich Ludendorff noch das
„Deutschvolk", einen völkisch-religiösen Verein.
Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, wurden
beide, Deutschvolk und Tannenbergbund, verbo-
ten.27 1937 durften die Ludendorffs dann, nach ei-
nem Gespräch mit Hitler, „ihre Lehre wieder als Re-
ligionsgemeinschaft organisieren - unter dem Na-
men .Deutsche Gotterkenntnis'".28 Ludendorffs Frau
Mathilde (1877-1966) gründete die sogenannte
Deutsche Gotterkenntnis, eine pseudo-philosophisch-
religiöse Bewegung, die die christliche Kirche ablehnte
und die den christlichen Glauben in eine Art deutsch-
germanisches Christentum umwandeln wollte, wobei
der Natur eine besondere Rolle zukam.
In einem 1934 erschienenen Artikel in der Schriften-
reihe des Ludendorffs Verlag wurde diese Ablehnung
des Christentums folgendermaßen begründet:
„Der weltanschauliche Abwehrkampf, den wir
gegen die Fremdreligion führen, aus unserem
Deutschen Freiheitswollen heraus zu führen
gezwungen sind, wird nicht durch Blutvergießen
und Paragraphen entschieden. Es ist der
Geisteskampf der Deutschen Revolution gegen
alles Undeutsche, Artfremde, ein Kampf, der
uns zudem aufgezwungen wird. Wir wollen als
Deutsche nur Deutsch sein, Deutsch, wie wir
geboren, nicht christlich, wie wir getauft wurden,
ohne unseren Willen, nur weil es so üblich war,
Kinder zu taufen. Das Blut unserervon den Christen
im grausamsten Glaubenskampf hingemordeten
Ahnen fordert von uns Rückkehr zu unserem
angestammten Kulturerbe, zum Arteigenen,
zur Deutschen Gotterkenntnis, die uns die
Philosophin Mathilde Ludendorff schenkte und
die in Übereinstimmung steht mit dem Deutschen
Rasseerbgut und mit den Erkenntnissen der
wissenschaftlichen Forschung. "29
Die Mitglieder der Deutschvolkgemeinde verließen die
christlichen Kirchen und strebten eine den Deutschen
,artgemäße' Religion an. Da sie nicht mehr Mitglied
der Kirche waren, durften sie die kirchlichen Friedhöfe
nicht mehr benutzen und benötigten eigene Begräb-
nisstätten.
Auf dem Gelände der Ahnenstätte Seelenfeld, einer
rechteckigen Anlage, befand sich ursprünglich ein
tätten" - eine besondere Kategorie von Friedhöfen in Norddeutschland.
Ideologische Zusammenhänge und Fragen des Denkmalschutzes
173
8 Leichenhalle, Ahnenstätte Seeienfeld, 2014. Foto: Joachim Wolschke-Bulmahn.
Zur Gestaltungsideologie der Ahnenstätten
Seelenfeld, Hilligenloh und Conneforde
Die Ahnenstätten Seelenfeld, Hilligenloh und Conne-
forde (Abb. 8) liegen in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen, die Ahnenstätte Seelenfeld zwischen
Loccum und Petershagen, die Ahnenstätte Hilligenloh
nahe Hude und die Ahnenstätte Conneforde nicht
sehr weit davon nahe Wiefelstede. Diese überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Gegenden enthalten
zahlreiche alte germanische Begräbnisstätten.
Seelenfeld und Hilligenloh wurden um 1930 von
Mitgliedern des Tannenbergbundes und der Deutsch-
volkgemeinde angelegt, zwei völkischen Organi-
sationen, die eng miteinander verbunden waren.
Der Tannenbergbund wurde 1925 unter entschei-
dender Mitwirkung des späteren Reichsarbeits-
führers Konstantin Hierl gegründet, Erich Luden-
dorff übernahm die Schirmherrschaft.26 1930 grün-
deten Mathilde und Erich Ludendorff noch das
„Deutschvolk", einen völkisch-religiösen Verein.
Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, wurden
beide, Deutschvolk und Tannenbergbund, verbo-
ten.27 1937 durften die Ludendorffs dann, nach ei-
nem Gespräch mit Hitler, „ihre Lehre wieder als Re-
ligionsgemeinschaft organisieren - unter dem Na-
men .Deutsche Gotterkenntnis'".28 Ludendorffs Frau
Mathilde (1877-1966) gründete die sogenannte
Deutsche Gotterkenntnis, eine pseudo-philosophisch-
religiöse Bewegung, die die christliche Kirche ablehnte
und die den christlichen Glauben in eine Art deutsch-
germanisches Christentum umwandeln wollte, wobei
der Natur eine besondere Rolle zukam.
In einem 1934 erschienenen Artikel in der Schriften-
reihe des Ludendorffs Verlag wurde diese Ablehnung
des Christentums folgendermaßen begründet:
„Der weltanschauliche Abwehrkampf, den wir
gegen die Fremdreligion führen, aus unserem
Deutschen Freiheitswollen heraus zu führen
gezwungen sind, wird nicht durch Blutvergießen
und Paragraphen entschieden. Es ist der
Geisteskampf der Deutschen Revolution gegen
alles Undeutsche, Artfremde, ein Kampf, der
uns zudem aufgezwungen wird. Wir wollen als
Deutsche nur Deutsch sein, Deutsch, wie wir
geboren, nicht christlich, wie wir getauft wurden,
ohne unseren Willen, nur weil es so üblich war,
Kinder zu taufen. Das Blut unserervon den Christen
im grausamsten Glaubenskampf hingemordeten
Ahnen fordert von uns Rückkehr zu unserem
angestammten Kulturerbe, zum Arteigenen,
zur Deutschen Gotterkenntnis, die uns die
Philosophin Mathilde Ludendorff schenkte und
die in Übereinstimmung steht mit dem Deutschen
Rasseerbgut und mit den Erkenntnissen der
wissenschaftlichen Forschung. "29
Die Mitglieder der Deutschvolkgemeinde verließen die
christlichen Kirchen und strebten eine den Deutschen
,artgemäße' Religion an. Da sie nicht mehr Mitglied
der Kirche waren, durften sie die kirchlichen Friedhöfe
nicht mehr benutzen und benötigten eigene Begräb-
nisstätten.
Auf dem Gelände der Ahnenstätte Seelenfeld, einer
rechteckigen Anlage, befand sich ursprünglich ein