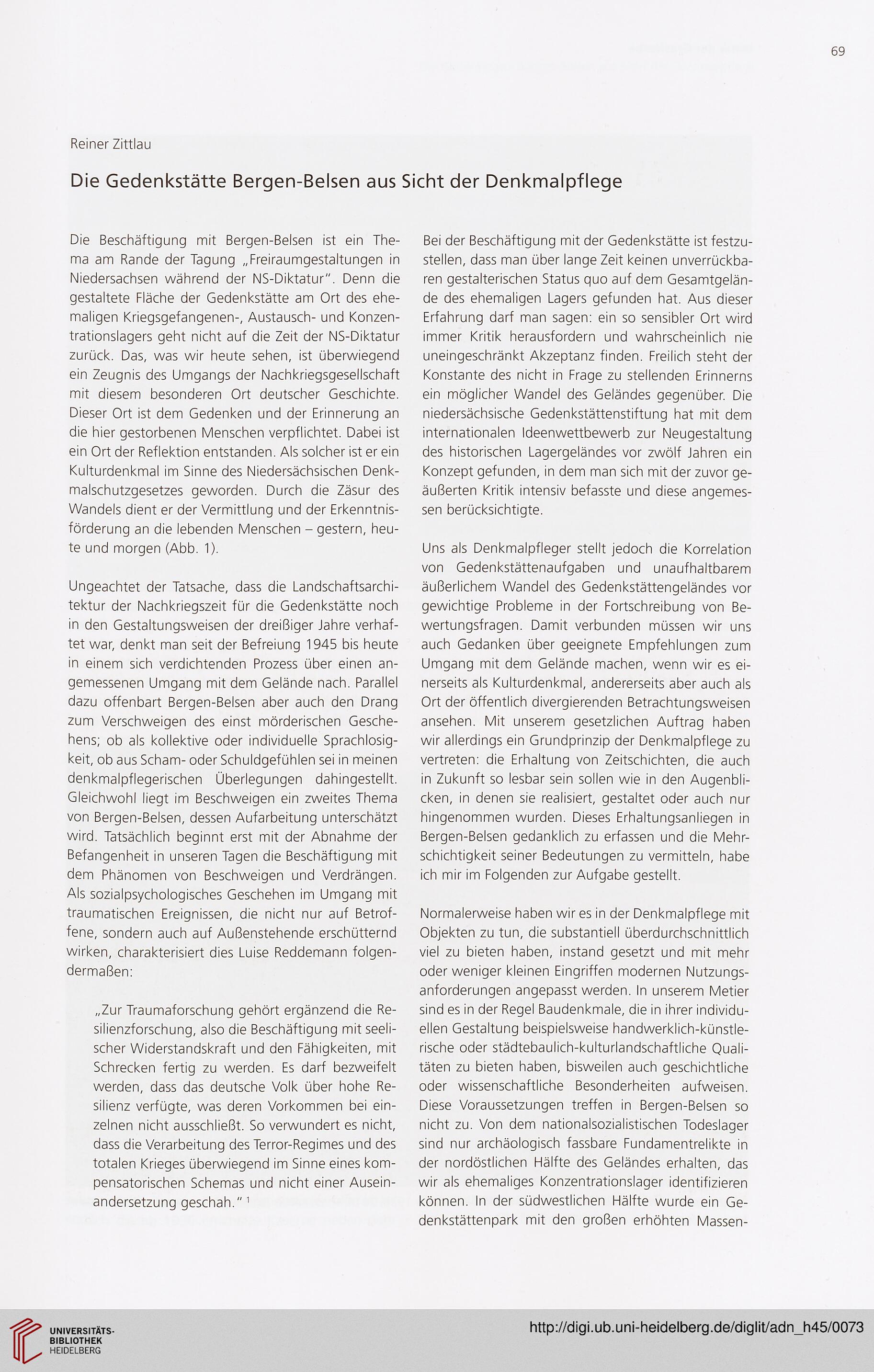69
Reiner Zittlau
Die Gedenkstätte Bergen-Belsen aus Sicht der Denkmalpflege
Die Beschäftigung mit Bergen-Belsen ist ein The-
ma am Rande der Tagung „Freiraumgestaltungen in
Niedersachsen während der NS-Diktatur". Denn die
gestaltete Fläche der Gedenkstätte am Ort des ehe-
maligen Kriegsgefangenen-, Austausch- und Konzen-
trationslagers geht nicht auf die Zeit der NS-Diktatur
zurück. Das, was wir heute sehen, ist überwiegend
ein Zeugnis des Umgangs der Nachkriegsgesellschaft
mit diesem besonderen Ort deutscher Geschichte.
Dieser Ort ist dem Gedenken und der Erinnerung an
die hier gestorbenen Menschen verpflichtet. Dabei ist
ein Ort der Reflektion entstanden. Als solcher ist er ein
Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes geworden. Durch die Zäsur des
Wandels dient er der Vermittlung und der Erkenntnis-
förderung an die lebenden Menschen - gestern, heu-
te und morgen (Abb. 1).
Ungeachtet der Tatsache, dass die Landschaftsarchi-
tektur der Nachkriegszeit für die Gedenkstätte noch
in den Gestaltungsweisen der dreißiger Jahre verhaf-
tet war, denkt man seit der Befreiung 1945 bis heute
in einem sich verdichtenden Prozess über einen an-
gemessenen Umgang mit dem Gelände nach. Parallel
dazu offenbart Bergen-Belsen aber auch den Drang
zum Verschweigen des einst mörderischen Gesche-
hens; ob als kollektive oder individuelle Sprachlosig-
keit, ob aus Scham- oder Schuldgefühlen sei in meinen
denkmalpflegerischen Überlegungen dahingestellt.
Gleichwohl liegt im Beschweigen ein zweites Thema
von Bergen-Belsen, dessen Aufarbeitung unterschätzt
wird. Tatsächlich beginnt erst mit der Abnahme der
Befangenheit in unseren Tagen die Beschäftigung mit
dem Phänomen von Beschweigen und Verdrängen.
Als sozialpsychologisches Geschehen im Umgang mit
traumatischen Ereignissen, die nicht nur auf Betrof-
fene, sondern auch auf Außenstehende erschütternd
wirken, charakterisiert dies Luise Reddemann folgen-
dermaßen:
„Zur Traumaforschung gehört ergänzend die Re-
silienzforschung, also die Beschäftigung mit seeli-
scher Widerstandskraft und den Fähigkeiten, mit
Schrecken fertig zu werden. Es darf bezweifelt
werden, dass das deutsche Volk über hohe Re-
silienz verfügte, was deren Vorkommen bei ein-
zelnen nicht ausschließt. So verwundert es nicht,
dass die Verarbeitung des Terror-Regimes und des
totalen Krieges überwiegend im Sinne eines kom-
pensatorischen Schemas und nicht einer Ausein-
andersetzung geschah."'
Bei der Beschäftigung mit der Gedenkstätte ist festzu-
stellen, dass man über lange Zeit keinen unverrückba-
ren gestalterischen Status quo auf dem Gesamtgelän-
de des ehemaligen Lagers gefunden hat. Aus dieser
Erfahrung darf man sagen: ein so sensibler Ort wird
immer Kritik herausfordern und wahrscheinlich nie
uneingeschränkt Akzeptanz finden. Freilich steht der
Konstante des nicht in Frage zu stellenden Erinnerns
ein möglicher Wandel des Geländes gegenüber. Die
niedersächsische Gedenkstättenstiftung hat mit dem
internationalen Ideenwettbewerb zur Neugestaltung
des historischen Lagergeländes vor zwölf Jahren ein
Konzept gefunden, in dem man sich mit der zuvor ge-
äußerten Kritik intensiv befasste und diese angemes-
sen berücksichtigte.
Uns als Denkmalpfleger stellt jedoch die Korrelation
von Gedenkstättenaufgaben und unaufhaltbarem
äußerlichem Wandel des Gedenkstättengeländes vor
gewichtige Probleme in der Fortschreibung von Be-
wertungsfragen. Damit verbunden müssen wir uns
auch Gedanken über geeignete Empfehlungen zum
Umgang mit dem Gelände machen, wenn wir es ei-
nerseits als Kulturdenkmal, andererseits aber auch als
Ort der öffentlich divergierenden Betrachtungsweisen
ansehen. Mit unserem gesetzlichen Auftrag haben
wir allerdings ein Grundprinzip der Denkmalpflege zu
vertreten: die Erhaltung von Zeitschichten, die auch
in Zukunft so lesbar sein sollen wie in den Augenbli-
cken, in denen sie realisiert, gestaltet oder auch nur
hingenommen wurden. Dieses Erhaltungsanliegen in
Bergen-Belsen gedanklich zu erfassen und die Mehr-
schichtigkeit seiner Bedeutungen zu vermitteln, habe
ich mir im Folgenden zur Aufgabe gestellt.
Normalerweise haben wir es in der Denkmalpflege mit
Objekten zu tun, die substantiell überdurchschnittlich
viel zu bieten haben, instand gesetzt und mit mehr
oder weniger kleinen Eingriffen modernen Nutzungs-
anforderungen angepasst werden. In unserem Metier
sind es in der Regel Baudenkmale, die in ihrer individu-
ellen Gestaltung beispielsweise handwerklich-künstle-
rische oder städtebaulich-kulturlandschaftliche Quali-
täten zu bieten haben, bisweilen auch geschichtliche
oder wissenschaftliche Besonderheiten aufweisen.
Diese Voraussetzungen treffen in Bergen-Belsen so
nicht zu. Von dem nationalsozialistischen Todeslager
sind nur archäologisch fassbare Fundamentrelikte in
der nordöstlichen Hälfte des Geländes erhalten, das
wir als ehemaliges Konzentrationslager identifizieren
können. In der südwestlichen Hälfte wurde ein Ge-
denkstättenpark mit den großen erhöhten Massen-
Reiner Zittlau
Die Gedenkstätte Bergen-Belsen aus Sicht der Denkmalpflege
Die Beschäftigung mit Bergen-Belsen ist ein The-
ma am Rande der Tagung „Freiraumgestaltungen in
Niedersachsen während der NS-Diktatur". Denn die
gestaltete Fläche der Gedenkstätte am Ort des ehe-
maligen Kriegsgefangenen-, Austausch- und Konzen-
trationslagers geht nicht auf die Zeit der NS-Diktatur
zurück. Das, was wir heute sehen, ist überwiegend
ein Zeugnis des Umgangs der Nachkriegsgesellschaft
mit diesem besonderen Ort deutscher Geschichte.
Dieser Ort ist dem Gedenken und der Erinnerung an
die hier gestorbenen Menschen verpflichtet. Dabei ist
ein Ort der Reflektion entstanden. Als solcher ist er ein
Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes geworden. Durch die Zäsur des
Wandels dient er der Vermittlung und der Erkenntnis-
förderung an die lebenden Menschen - gestern, heu-
te und morgen (Abb. 1).
Ungeachtet der Tatsache, dass die Landschaftsarchi-
tektur der Nachkriegszeit für die Gedenkstätte noch
in den Gestaltungsweisen der dreißiger Jahre verhaf-
tet war, denkt man seit der Befreiung 1945 bis heute
in einem sich verdichtenden Prozess über einen an-
gemessenen Umgang mit dem Gelände nach. Parallel
dazu offenbart Bergen-Belsen aber auch den Drang
zum Verschweigen des einst mörderischen Gesche-
hens; ob als kollektive oder individuelle Sprachlosig-
keit, ob aus Scham- oder Schuldgefühlen sei in meinen
denkmalpflegerischen Überlegungen dahingestellt.
Gleichwohl liegt im Beschweigen ein zweites Thema
von Bergen-Belsen, dessen Aufarbeitung unterschätzt
wird. Tatsächlich beginnt erst mit der Abnahme der
Befangenheit in unseren Tagen die Beschäftigung mit
dem Phänomen von Beschweigen und Verdrängen.
Als sozialpsychologisches Geschehen im Umgang mit
traumatischen Ereignissen, die nicht nur auf Betrof-
fene, sondern auch auf Außenstehende erschütternd
wirken, charakterisiert dies Luise Reddemann folgen-
dermaßen:
„Zur Traumaforschung gehört ergänzend die Re-
silienzforschung, also die Beschäftigung mit seeli-
scher Widerstandskraft und den Fähigkeiten, mit
Schrecken fertig zu werden. Es darf bezweifelt
werden, dass das deutsche Volk über hohe Re-
silienz verfügte, was deren Vorkommen bei ein-
zelnen nicht ausschließt. So verwundert es nicht,
dass die Verarbeitung des Terror-Regimes und des
totalen Krieges überwiegend im Sinne eines kom-
pensatorischen Schemas und nicht einer Ausein-
andersetzung geschah."'
Bei der Beschäftigung mit der Gedenkstätte ist festzu-
stellen, dass man über lange Zeit keinen unverrückba-
ren gestalterischen Status quo auf dem Gesamtgelän-
de des ehemaligen Lagers gefunden hat. Aus dieser
Erfahrung darf man sagen: ein so sensibler Ort wird
immer Kritik herausfordern und wahrscheinlich nie
uneingeschränkt Akzeptanz finden. Freilich steht der
Konstante des nicht in Frage zu stellenden Erinnerns
ein möglicher Wandel des Geländes gegenüber. Die
niedersächsische Gedenkstättenstiftung hat mit dem
internationalen Ideenwettbewerb zur Neugestaltung
des historischen Lagergeländes vor zwölf Jahren ein
Konzept gefunden, in dem man sich mit der zuvor ge-
äußerten Kritik intensiv befasste und diese angemes-
sen berücksichtigte.
Uns als Denkmalpfleger stellt jedoch die Korrelation
von Gedenkstättenaufgaben und unaufhaltbarem
äußerlichem Wandel des Gedenkstättengeländes vor
gewichtige Probleme in der Fortschreibung von Be-
wertungsfragen. Damit verbunden müssen wir uns
auch Gedanken über geeignete Empfehlungen zum
Umgang mit dem Gelände machen, wenn wir es ei-
nerseits als Kulturdenkmal, andererseits aber auch als
Ort der öffentlich divergierenden Betrachtungsweisen
ansehen. Mit unserem gesetzlichen Auftrag haben
wir allerdings ein Grundprinzip der Denkmalpflege zu
vertreten: die Erhaltung von Zeitschichten, die auch
in Zukunft so lesbar sein sollen wie in den Augenbli-
cken, in denen sie realisiert, gestaltet oder auch nur
hingenommen wurden. Dieses Erhaltungsanliegen in
Bergen-Belsen gedanklich zu erfassen und die Mehr-
schichtigkeit seiner Bedeutungen zu vermitteln, habe
ich mir im Folgenden zur Aufgabe gestellt.
Normalerweise haben wir es in der Denkmalpflege mit
Objekten zu tun, die substantiell überdurchschnittlich
viel zu bieten haben, instand gesetzt und mit mehr
oder weniger kleinen Eingriffen modernen Nutzungs-
anforderungen angepasst werden. In unserem Metier
sind es in der Regel Baudenkmale, die in ihrer individu-
ellen Gestaltung beispielsweise handwerklich-künstle-
rische oder städtebaulich-kulturlandschaftliche Quali-
täten zu bieten haben, bisweilen auch geschichtliche
oder wissenschaftliche Besonderheiten aufweisen.
Diese Voraussetzungen treffen in Bergen-Belsen so
nicht zu. Von dem nationalsozialistischen Todeslager
sind nur archäologisch fassbare Fundamentrelikte in
der nordöstlichen Hälfte des Geländes erhalten, das
wir als ehemaliges Konzentrationslager identifizieren
können. In der südwestlichen Hälfte wurde ein Ge-
denkstättenpark mit den großen erhöhten Massen-