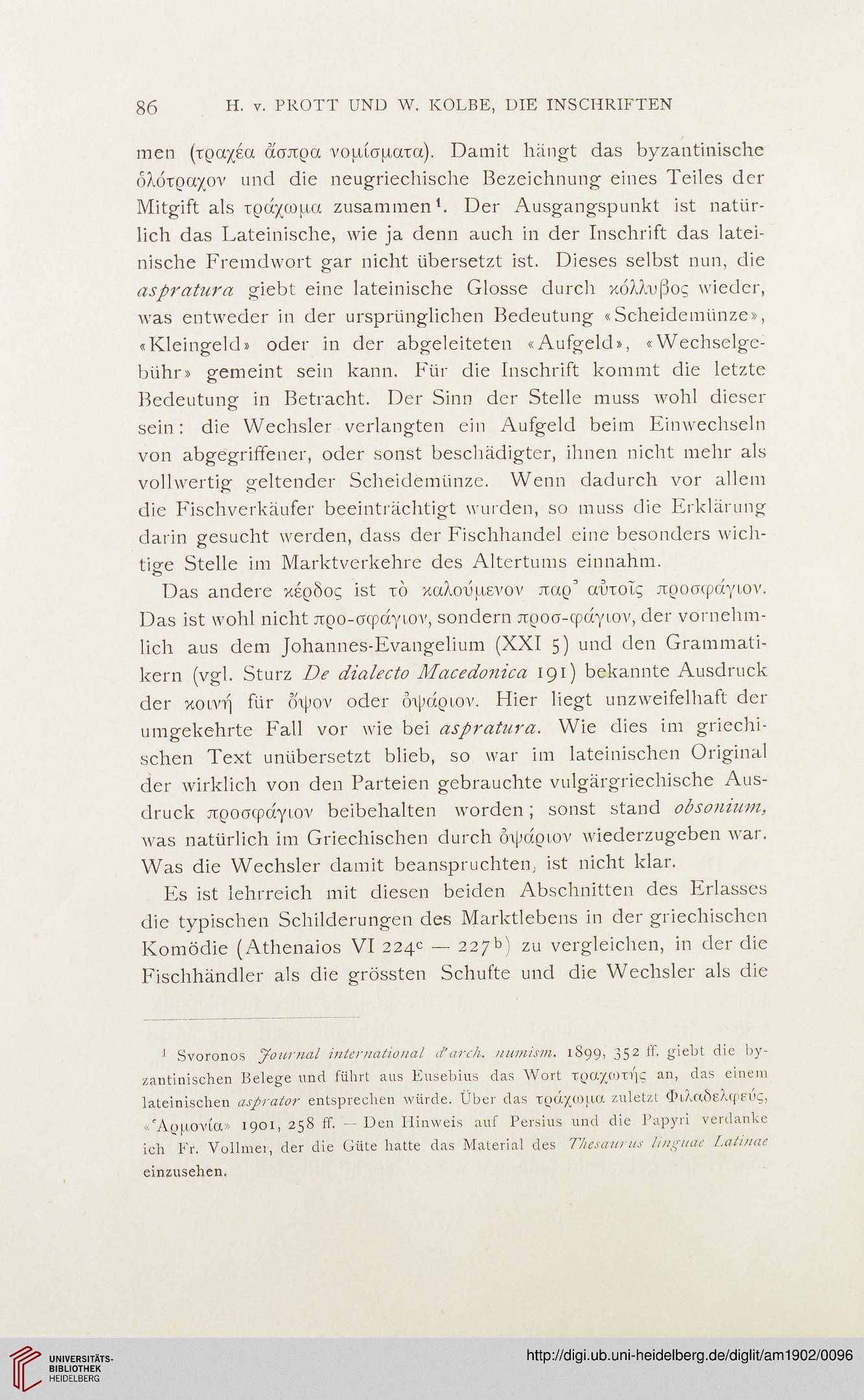86
Η. V. PROTT UND W. KOLBE, DIE INSCHRIFTEN
men (τραχέα άσπρα νομίσματα). Damit hängt das byzantinische
όλότραχον und die neugriechische Bezeichnung eines Teiles der
Mitgift als τράχωμα zusammen1. Der Ausgangspunkt ist natür-
lich das Lateinische, wie ja denn auch in der Inschrift das latei-
nische Fremdwort gar nicht übersetzt ist. Dieses selbst nun, die
aspratura giebt eine lateinische Glosse durch κόλλυβος wieder,
was entweder in der ursprünglichen Bedeutung «Scheidemünze»,
«Kleingeld» oder in der abgeleiteten «Aufgeld», «Wechselge-
bühr» gemeint sein kann. Für die Inschrift kommt die letzte
Bedeutung in Betracht. Der Sinn der Stelle muss wohl dieser
sein: die Wechsler verlangten ein Aufgeld beim Einwechseln
von abgegriffener, oder sonst beschädigter, ihnen nicht mehr als
vollwertig geltender Scheidemünze. Wenn dadurch vor allem
die Fischverkäufer beeinträchtigt wurden, so muss die Erklärung
darin gesucht werden, dass der Fischhandel eine besonders wich-
tige Stelle im Marktverkehre des Altertums einnahm.
Das andere κέρδος ist τό καλού μενον παρ’ αυτοίς προσφάγιον.
Das ist wohl nicht προ-σφάγιον, sondern προσ-φάγιον, der vornehm-
lich aus dem Johannes-Evangelium (XXI 5) und den Grammati-
kern (vgl. Sturz De dialecto Macedonica 191) bekannte Ausdruck
der κοινή für δψον oder όψάριον. Hier hegt unzweifelhaft der
umgekehrte Fall vor wie bei aspratura. Wie dies im griechi-
schen Text uniibersetzt blieb, so war im lateinischen Original
der wirklich von den Parteien gebrauchte vulgärgriechische Aus-
druck προσφάγιον beibehalten worden; sonst stand obsomum,
was natürlich im Griechischen durch όψάριον wiederzugeben war.
Was die Wechsler damit beanspruchten,, ist nicht klar.
Es ist lehrreich mit diesen beiden Abschnitten des Erlasses
die typischen Schilderungen des Marktlebens in der griechischen
Komödie (Athenaios VI 224c — 227b) zu vergleichen, in der die
Fischhändler als die grössten Schufte und die Wechsler als die
1 Svoronos Journal international d’arch. numism. 1899, 352 ff. giebt die by-
zantinischen Belege und führt aus Eusebius das Wort τραχωτής an, das einem
lateinischen asprator entsprechen würde. Über das τράχωμα zuletzt Φιλαδελφεΰς,
«Αρμονία» 1901, 258 ff. — Den Hinweis auf Persius und die Papyri verdanke
ich Fr. Vollmer, der die Güte hatte das Material des Thesaurus linguac Latinac
einzusehen.
Η. V. PROTT UND W. KOLBE, DIE INSCHRIFTEN
men (τραχέα άσπρα νομίσματα). Damit hängt das byzantinische
όλότραχον und die neugriechische Bezeichnung eines Teiles der
Mitgift als τράχωμα zusammen1. Der Ausgangspunkt ist natür-
lich das Lateinische, wie ja denn auch in der Inschrift das latei-
nische Fremdwort gar nicht übersetzt ist. Dieses selbst nun, die
aspratura giebt eine lateinische Glosse durch κόλλυβος wieder,
was entweder in der ursprünglichen Bedeutung «Scheidemünze»,
«Kleingeld» oder in der abgeleiteten «Aufgeld», «Wechselge-
bühr» gemeint sein kann. Für die Inschrift kommt die letzte
Bedeutung in Betracht. Der Sinn der Stelle muss wohl dieser
sein: die Wechsler verlangten ein Aufgeld beim Einwechseln
von abgegriffener, oder sonst beschädigter, ihnen nicht mehr als
vollwertig geltender Scheidemünze. Wenn dadurch vor allem
die Fischverkäufer beeinträchtigt wurden, so muss die Erklärung
darin gesucht werden, dass der Fischhandel eine besonders wich-
tige Stelle im Marktverkehre des Altertums einnahm.
Das andere κέρδος ist τό καλού μενον παρ’ αυτοίς προσφάγιον.
Das ist wohl nicht προ-σφάγιον, sondern προσ-φάγιον, der vornehm-
lich aus dem Johannes-Evangelium (XXI 5) und den Grammati-
kern (vgl. Sturz De dialecto Macedonica 191) bekannte Ausdruck
der κοινή für δψον oder όψάριον. Hier hegt unzweifelhaft der
umgekehrte Fall vor wie bei aspratura. Wie dies im griechi-
schen Text uniibersetzt blieb, so war im lateinischen Original
der wirklich von den Parteien gebrauchte vulgärgriechische Aus-
druck προσφάγιον beibehalten worden; sonst stand obsomum,
was natürlich im Griechischen durch όψάριον wiederzugeben war.
Was die Wechsler damit beanspruchten,, ist nicht klar.
Es ist lehrreich mit diesen beiden Abschnitten des Erlasses
die typischen Schilderungen des Marktlebens in der griechischen
Komödie (Athenaios VI 224c — 227b) zu vergleichen, in der die
Fischhändler als die grössten Schufte und die Wechsler als die
1 Svoronos Journal international d’arch. numism. 1899, 352 ff. giebt die by-
zantinischen Belege und führt aus Eusebius das Wort τραχωτής an, das einem
lateinischen asprator entsprechen würde. Über das τράχωμα zuletzt Φιλαδελφεΰς,
«Αρμονία» 1901, 258 ff. — Den Hinweis auf Persius und die Papyri verdanke
ich Fr. Vollmer, der die Güte hatte das Material des Thesaurus linguac Latinac
einzusehen.