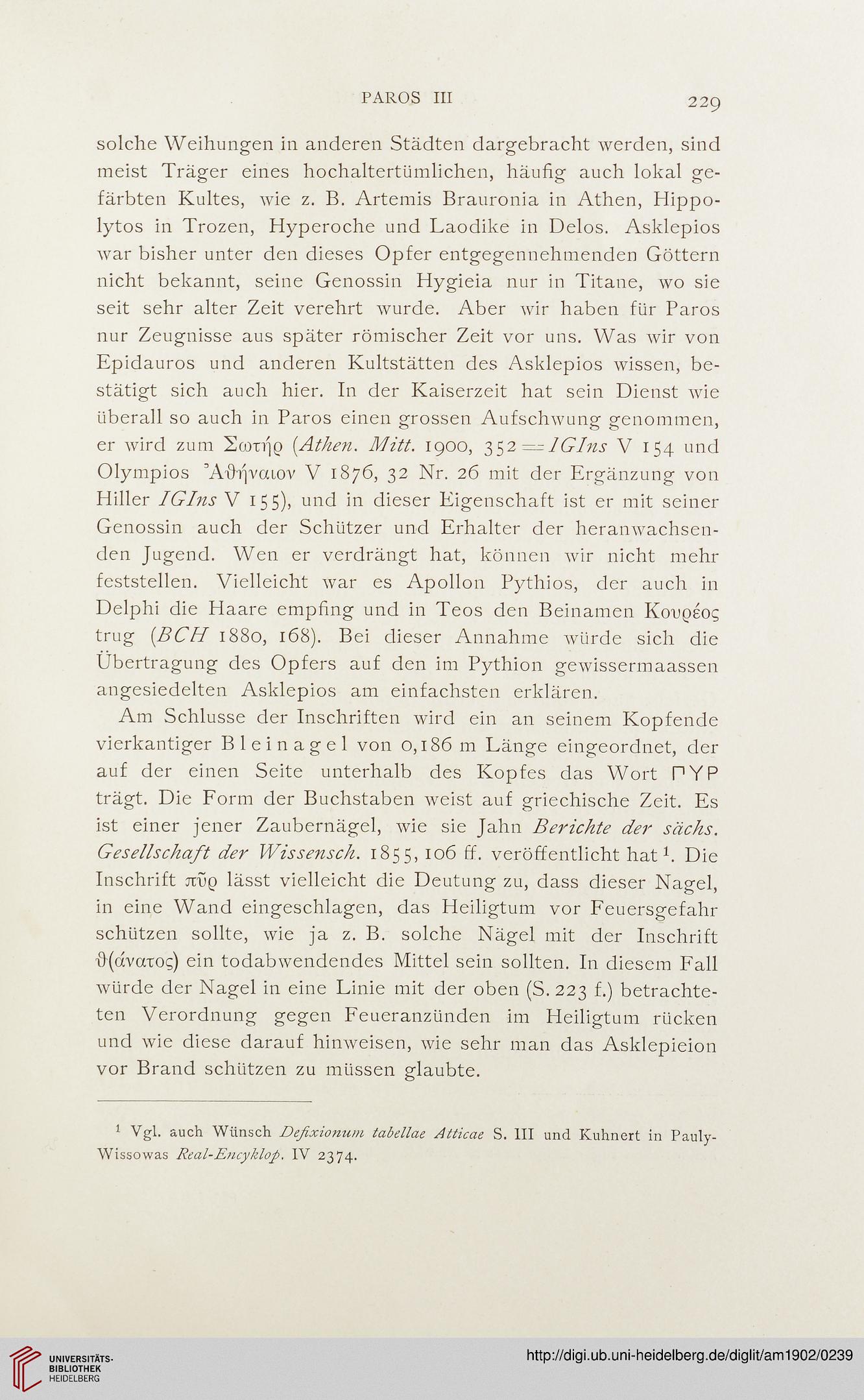PAROS III
229
solche Weihungen in anderen Städten dargebracht werden, sind
meist Träger eines hochaltertümlichen, häufig auch lokal ge-
färbten Kultes, wie z. B. Artemis Brauronia in Athen, Hippo-
lytos in Trozen, Hyperoche und Laodike in Delos. Asklepios
war bisher unter den dieses Opfer entgegennehmenden Göttern
nicht bekannt, seine Genossin Hygieia nur in Titane, wo sie
seit sehr alter Zeit verehrt wurde. Aber wir haben für Paros
nur Zeugnisse aus später römischer Zeit vor uns. Was wir von
Epidauros und anderen Kultstätten des Asklepios wissen, be-
stätigt sich auch hier. In der Kaiserzeit hat sein Dienst wie
überall so auch in Paros einen grossen Aufschwung genommen,
er wird zum Σωτήρ (Athen. Mitt. 1900, 352— IGlns V 154 und
Olympios Adfrjvatov V 1876, 32 Nr. 26 mit der Ergänzung von
Hiller IGlns V 155), und in dieser Eigenschaft ist er mit seiner
Genossin auch der Schützer und Erhalter der heranwachsen-
den Jugend. Wen er verdrängt hat, können wir nicht mehr
feststellen. Vielleicht war es Apollon Pythios, der auch in
Delphi die Haare empfing und in Teos den Beinamen Κουρέος
trug (BCH 1880, 168). Bei dieser Annahme würde sich die
Übertragung des Opfers auf den im Pythion gewissermaassen
angesiedelten Asklepios am einfachsten erklären.
Am Schlüsse der Inschriften wird ein an seinem Kopfende
vierkantiger Bleinagel von 0,186 m Länge eingeordnet, der
auf der einen Seite unterhalb des Kopfes das Wort ΠΥΡ
trägt. Die Form der Buchstaben weist auf griechische Zeit. Es
ist einer jener Zaubernägel, wie sie Jahn Berichte der sächs.
Gesellschaft der Wissensch. 1855, 106 ff. veröffentlicht hat1. Die
Inschrift πϋρ lässt vielleicht die Deutung zu, dass dieser Nagel,
in eine Wand eingeschlagen, das Heiligtum vor Feuersgefahr
schützen sollte, wie ja z. B. solche Nägel mit der Inschrift
■θ(σνατος) ein toclabwendendes Mittel sein sollten. In diesem Fall
würde der Nagel in eine Linie mit der oben (S. 223 f.) betrachte-
ten Verordnung gegen Feueranzünden im Heiligtum rücken
und wie diese darauf hinweisen, wie sehr man das Asldepieion
vor Brand schützen zu müssen glaubte.
1 Vgl. auch Wünsch Defixionum tabellae Atticae S. III und Kuhnert in Pauly-
Wissowas Real-Encyklop. IV 2374.
229
solche Weihungen in anderen Städten dargebracht werden, sind
meist Träger eines hochaltertümlichen, häufig auch lokal ge-
färbten Kultes, wie z. B. Artemis Brauronia in Athen, Hippo-
lytos in Trozen, Hyperoche und Laodike in Delos. Asklepios
war bisher unter den dieses Opfer entgegennehmenden Göttern
nicht bekannt, seine Genossin Hygieia nur in Titane, wo sie
seit sehr alter Zeit verehrt wurde. Aber wir haben für Paros
nur Zeugnisse aus später römischer Zeit vor uns. Was wir von
Epidauros und anderen Kultstätten des Asklepios wissen, be-
stätigt sich auch hier. In der Kaiserzeit hat sein Dienst wie
überall so auch in Paros einen grossen Aufschwung genommen,
er wird zum Σωτήρ (Athen. Mitt. 1900, 352— IGlns V 154 und
Olympios Adfrjvatov V 1876, 32 Nr. 26 mit der Ergänzung von
Hiller IGlns V 155), und in dieser Eigenschaft ist er mit seiner
Genossin auch der Schützer und Erhalter der heranwachsen-
den Jugend. Wen er verdrängt hat, können wir nicht mehr
feststellen. Vielleicht war es Apollon Pythios, der auch in
Delphi die Haare empfing und in Teos den Beinamen Κουρέος
trug (BCH 1880, 168). Bei dieser Annahme würde sich die
Übertragung des Opfers auf den im Pythion gewissermaassen
angesiedelten Asklepios am einfachsten erklären.
Am Schlüsse der Inschriften wird ein an seinem Kopfende
vierkantiger Bleinagel von 0,186 m Länge eingeordnet, der
auf der einen Seite unterhalb des Kopfes das Wort ΠΥΡ
trägt. Die Form der Buchstaben weist auf griechische Zeit. Es
ist einer jener Zaubernägel, wie sie Jahn Berichte der sächs.
Gesellschaft der Wissensch. 1855, 106 ff. veröffentlicht hat1. Die
Inschrift πϋρ lässt vielleicht die Deutung zu, dass dieser Nagel,
in eine Wand eingeschlagen, das Heiligtum vor Feuersgefahr
schützen sollte, wie ja z. B. solche Nägel mit der Inschrift
■θ(σνατος) ein toclabwendendes Mittel sein sollten. In diesem Fall
würde der Nagel in eine Linie mit der oben (S. 223 f.) betrachte-
ten Verordnung gegen Feueranzünden im Heiligtum rücken
und wie diese darauf hinweisen, wie sehr man das Asldepieion
vor Brand schützen zu müssen glaubte.
1 Vgl. auch Wünsch Defixionum tabellae Atticae S. III und Kuhnert in Pauly-
Wissowas Real-Encyklop. IV 2374.