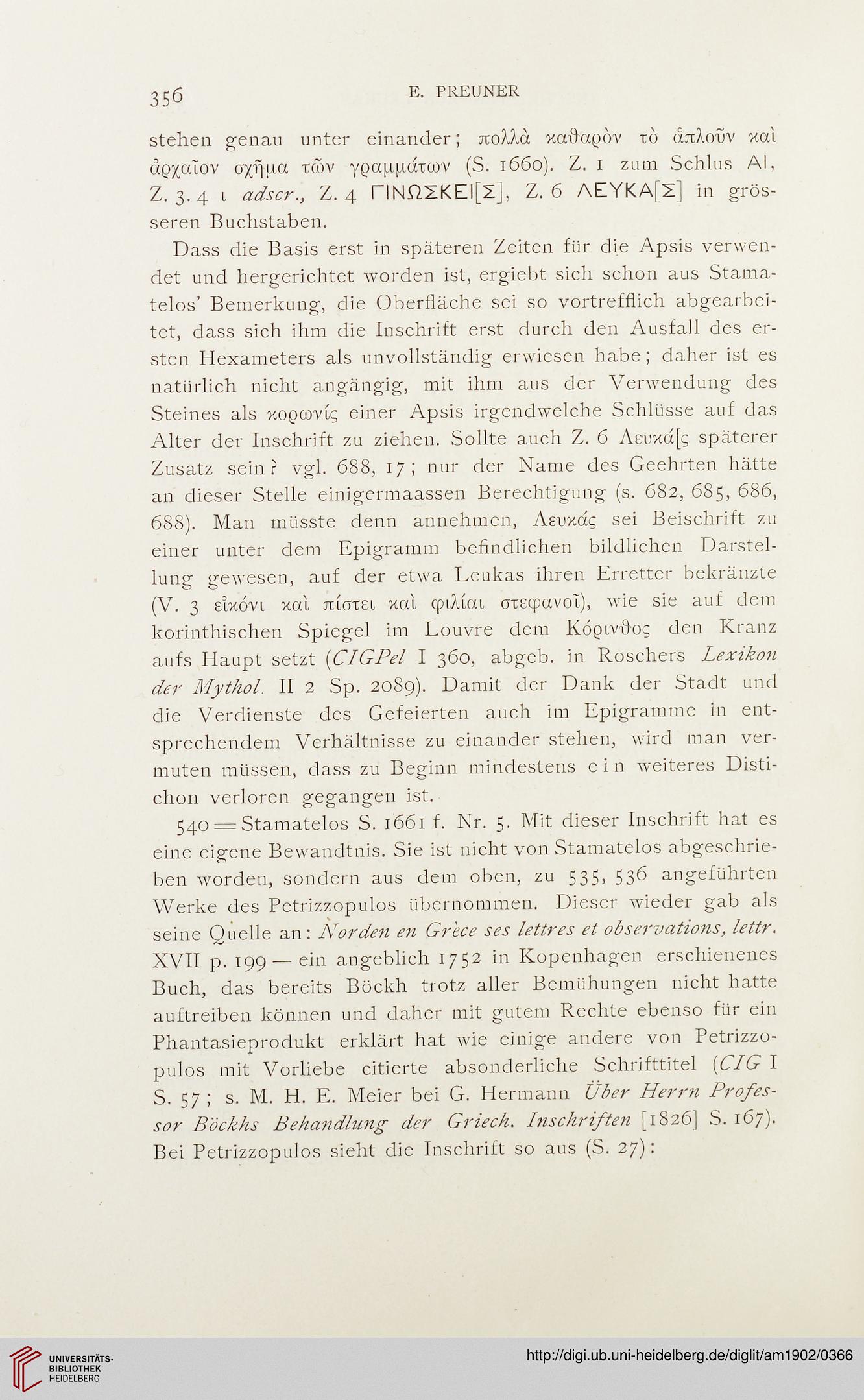356
E. PREUNER
stehen genau unter einander; πολλά καθαρόν τό άπλοΰν κα'ι
άρχαΐον σχήμα των γραμμάτων (S. ι66ο). Ζ. ι zum Schlus AI,
Ζ. 3· 4 1 adscr., Ζ. 4 ΓΙΝΩΣΚΕΙ[Σ], Ζ. 6 ΛΕΥΚΑ[Σ] in grös-
seren Buchstaben.
Dass die Basis erst in späteren Zeiten für die Apsis verwen-
det und hergerichtet worden ist, ergiebt sich schon aus Stama-
telos’ Bemerkung, die Oberfläche sei so vortrefflich abgearbei-
tet, dass sich ihm die Inschrift erst durch den Ausfall des er-
sten Hexameters als unvollständig erwiesen habe; daher ist es
natürlich nicht angängig, mit ihm aus der Verwendung des
Steines als κορωνίς einer Apsis irgendwelche Schlüsse auf das
Alter der Inschrift zu ziehen. Sollte auch Z. 6 Λευκά[ς späterer
Zusatz sein? vgl. 688, 17; nur der Name des Geehrten hätte
an dieser Stelle einigermaassen Berechtigung (s. 682, 685, 686,
688). Man müsste denn annehmen, Λεύκάς sei Beischrift zu
einer unter dem Epigramm befindlichen bildlichen Darstel-
lung gewesen, auf der etwa Leukas ihren Erretter bekränzte
(V. 3 εΐ,κόνι κα'ι πίστει κα'ι φιλίαι στέφανοι), wie sie auf dem
korinthischen Spiegel im Louvre dem Κόρινθος den Kranz
aufs Haupt setzt (CIGPel I 360, abgeb. in Roschers Lexikon
der Mythol. II 2 Sp. 2089). Damit der Dank der Stadt und
die Verdienste des Gefeierten auch im Epigramme in ent-
sprechendem Verhältnisse zu einander stehen, wird man ver-
muten müssen, dass zu Beginn mindestens e i 11 weiteres Disti-
chon verloren gegangen ist.
540 = Stamatelos S. 1661 f. Nr. 5. Mit dieser Inschrift hat es
eine eigene Bewandtnis. Sie ist nicht von Stamatelos abgeschrie-
ben worden, sondern aus dem oben, zu 535) 536 angeführten
Werke des Petrizzopulos übernommen. Dieser wieder gab als
seine Quelle an : Norden en Gr'ece ses lettres et observations, lettr.
XVII p. 199 — ein angeblich 1752 in Kopenhagen erschienenes
Buch, das bereits Böckh trotz aller Bemühungen nicht hatte
auftreiben können und daher mit gutem Rechte ebenso für ein
Phantasieprodukt erklärt hat wie einige andere von Petrizzo-
pulos mit Vorliebe citierte absonderliche Schrifttitel (CIG I
S. 57 ; s. Μ. Η. E. Meier bei G. Hermann Über Herrn Profes-
sor Böckhs Behandlung der Griech. Inschriften [1826] S. 167).
Bei Petrizzopulos sieht die Inschrift so aus (S. 27):
E. PREUNER
stehen genau unter einander; πολλά καθαρόν τό άπλοΰν κα'ι
άρχαΐον σχήμα των γραμμάτων (S. ι66ο). Ζ. ι zum Schlus AI,
Ζ. 3· 4 1 adscr., Ζ. 4 ΓΙΝΩΣΚΕΙ[Σ], Ζ. 6 ΛΕΥΚΑ[Σ] in grös-
seren Buchstaben.
Dass die Basis erst in späteren Zeiten für die Apsis verwen-
det und hergerichtet worden ist, ergiebt sich schon aus Stama-
telos’ Bemerkung, die Oberfläche sei so vortrefflich abgearbei-
tet, dass sich ihm die Inschrift erst durch den Ausfall des er-
sten Hexameters als unvollständig erwiesen habe; daher ist es
natürlich nicht angängig, mit ihm aus der Verwendung des
Steines als κορωνίς einer Apsis irgendwelche Schlüsse auf das
Alter der Inschrift zu ziehen. Sollte auch Z. 6 Λευκά[ς späterer
Zusatz sein? vgl. 688, 17; nur der Name des Geehrten hätte
an dieser Stelle einigermaassen Berechtigung (s. 682, 685, 686,
688). Man müsste denn annehmen, Λεύκάς sei Beischrift zu
einer unter dem Epigramm befindlichen bildlichen Darstel-
lung gewesen, auf der etwa Leukas ihren Erretter bekränzte
(V. 3 εΐ,κόνι κα'ι πίστει κα'ι φιλίαι στέφανοι), wie sie auf dem
korinthischen Spiegel im Louvre dem Κόρινθος den Kranz
aufs Haupt setzt (CIGPel I 360, abgeb. in Roschers Lexikon
der Mythol. II 2 Sp. 2089). Damit der Dank der Stadt und
die Verdienste des Gefeierten auch im Epigramme in ent-
sprechendem Verhältnisse zu einander stehen, wird man ver-
muten müssen, dass zu Beginn mindestens e i 11 weiteres Disti-
chon verloren gegangen ist.
540 = Stamatelos S. 1661 f. Nr. 5. Mit dieser Inschrift hat es
eine eigene Bewandtnis. Sie ist nicht von Stamatelos abgeschrie-
ben worden, sondern aus dem oben, zu 535) 536 angeführten
Werke des Petrizzopulos übernommen. Dieser wieder gab als
seine Quelle an : Norden en Gr'ece ses lettres et observations, lettr.
XVII p. 199 — ein angeblich 1752 in Kopenhagen erschienenes
Buch, das bereits Böckh trotz aller Bemühungen nicht hatte
auftreiben können und daher mit gutem Rechte ebenso für ein
Phantasieprodukt erklärt hat wie einige andere von Petrizzo-
pulos mit Vorliebe citierte absonderliche Schrifttitel (CIG I
S. 57 ; s. Μ. Η. E. Meier bei G. Hermann Über Herrn Profes-
sor Böckhs Behandlung der Griech. Inschriften [1826] S. 167).
Bei Petrizzopulos sieht die Inschrift so aus (S. 27):