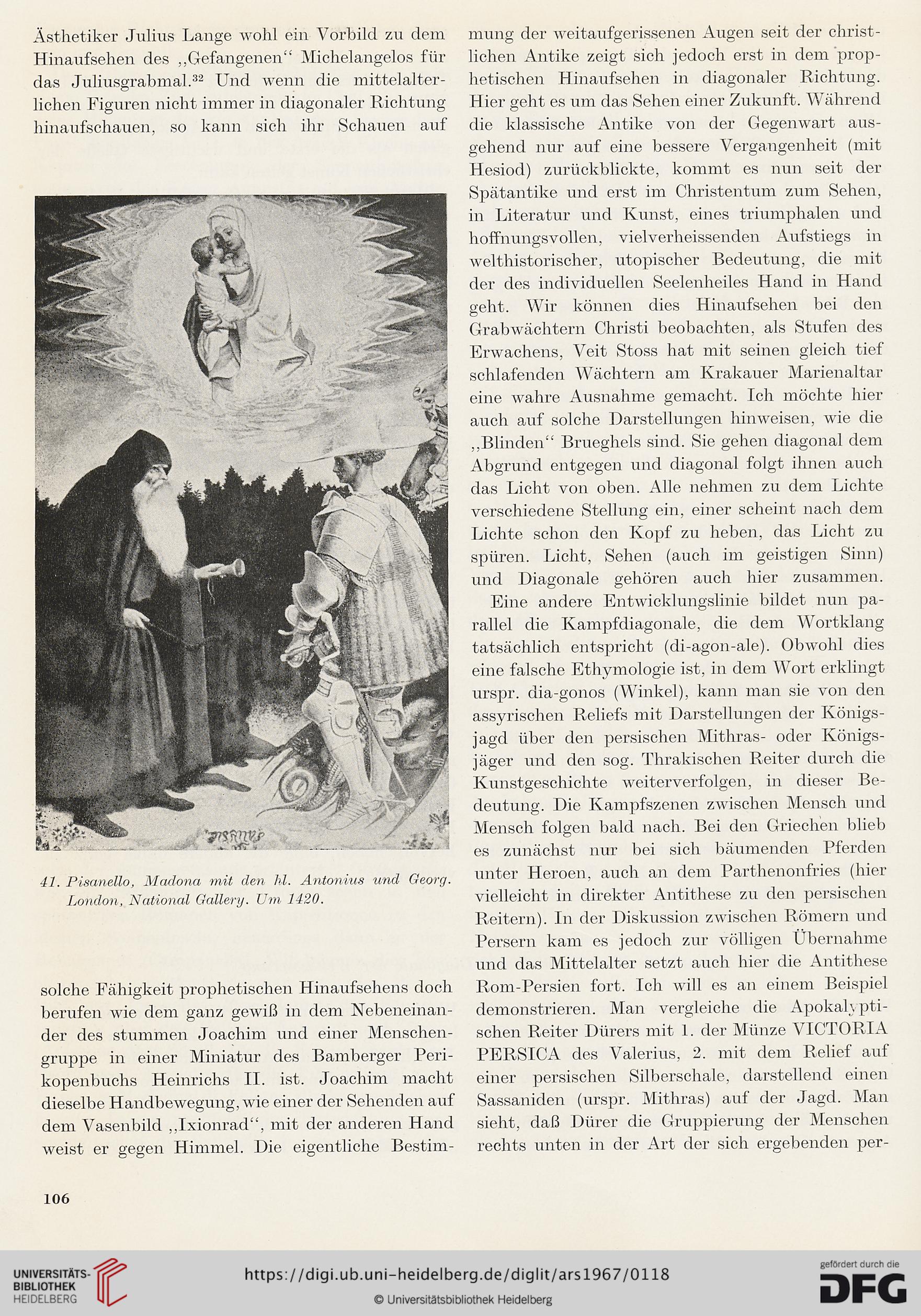Ästhetiker Julius Lange wohl ein Vorbild zu dem
Hinaufsehen des „Gefangenen“ Michelangelos für
das Juliusgrabmal.32 Und wenn die mittelalter-
lichen Figuren nicht immer in diagonaler Richtung
hinaufschauen, so kann sich ihr Schauen auf
41. Pisandlo, Madona mit den Id. Antonius und Georg.
London, National Gallery. Um 1420.
solche Fähigkeit prophetischen Hinaufsehens doch
berufen wie dem ganz gewiß in dem Nebeneinan-
der des stummen Joachim und einer Menschen-
gruppe in einer Miniatur des Bamberger Peri-
kopenbuchs Heinrichs II. ist. Joachim macht
dieselbe Handbewegung, wie einer der Sehenden auf
dem Vasenbild „Ixionrad“, mit der anderen Hand
weist er gegen Himmel. Die eigentliche Bestim-
mung der weitaufgerissenen Augen seit der christ-
lichen Antike zeigt sich jedoch erst in dem prop-
hetischen Hinaufsehen in diagonaler Richtung.
Hier geht es um das Sehen einer Zukunft. Während
die klassische Antike von der Gegenwart aus-
gehend nur auf eine bessere Vergangenheit (mit
Hesiod) zurückblickte, kommt es nun seit der
Spätantike und erst im Christentum zum Sehen,
in Literatur’ und Kunst, eines triumphalen und
hoffnungsvollen, vielverheissenden Aufstiegs in
welthistorischer, utopischer Bedeutung, die mit
der des individuellen Seelenheiles Hand in Hand
geht. Wir können dies Hinaufsehen bei den
Grabwächtern Christi beobachten, als Stufen des
Erwachens, Veit Stoss hat mit seinen gleich tief
schlafenden Wächtern am Krakauer Marienaltar
eine wahre Ausnahme gemacht. Ich möchte hier
auch auf solche Darstellungen hinweisen, wie die
„Blinden“ Brueghels sind. Sie gehen diagonal dem
Abgrund entgegen und diagonal folgt ihnen auch
das Licht von oben. Alle nehmen zu dem Lichte
verschiedene Stellung ein, einer scheint nach dem
Lichte schon den Kopf zu heben, das Licht zu
spüren. Licht, Sehen (auch im geistigen Sinn)
und Diagonale gehören auch hier zusammen.
Eine andere Entwicklungslinie bildet nun pa-
rallel die Kampf diagonale, die dem Wortklang
tatsächlich entspricht (di-agon-ale). Obwohl dies
eine falsche Ethymologie ist, in dem Wort erklingt
urspr. dia-gonos (Winkel), kann man sie von den
assyrischen Reliefs mit Darstellungen der Königs-
jagd über den persischen Mithras- oder Königs-
jäger und den sog. Thrakischen Reiter durch die
Kunstgeschichte weiterverfolgen, in dieser Be-
deutung. Die Kampfszenen zwischen Mensch und
Mensch folgen bald nach. Bei den Griechen blieb
es zunächst nur bei sich bäumenden Pferden
unter Heroen, auch an dem Parthenonfries (hier
vielleicht in direkter Antithese zu den persischen
Reitern). In der Diskussion zwischen Römern und
Persern kam es jedoch zur völligen Übernahme
und das Mittelalter setzt auch hier die Antithese
Rom-Persien fort. Ich will es an einem Beispiel
demonstrieren. Man vergleiche die Apokalypti-
schen Reiter Dürers mit 1. der Münze VICTORIA
PERSICA des Valerius, 2. mit dem Relief auf
einer persischen Silberschale, darstellend einen
Sassaniden (urspr. Mithras) auf der Jagd. Man
sieht, daß Dürer die Gruppierung der Menschen
rechts unten in der Art der sich ergebenden per-
106
Hinaufsehen des „Gefangenen“ Michelangelos für
das Juliusgrabmal.32 Und wenn die mittelalter-
lichen Figuren nicht immer in diagonaler Richtung
hinaufschauen, so kann sich ihr Schauen auf
41. Pisandlo, Madona mit den Id. Antonius und Georg.
London, National Gallery. Um 1420.
solche Fähigkeit prophetischen Hinaufsehens doch
berufen wie dem ganz gewiß in dem Nebeneinan-
der des stummen Joachim und einer Menschen-
gruppe in einer Miniatur des Bamberger Peri-
kopenbuchs Heinrichs II. ist. Joachim macht
dieselbe Handbewegung, wie einer der Sehenden auf
dem Vasenbild „Ixionrad“, mit der anderen Hand
weist er gegen Himmel. Die eigentliche Bestim-
mung der weitaufgerissenen Augen seit der christ-
lichen Antike zeigt sich jedoch erst in dem prop-
hetischen Hinaufsehen in diagonaler Richtung.
Hier geht es um das Sehen einer Zukunft. Während
die klassische Antike von der Gegenwart aus-
gehend nur auf eine bessere Vergangenheit (mit
Hesiod) zurückblickte, kommt es nun seit der
Spätantike und erst im Christentum zum Sehen,
in Literatur’ und Kunst, eines triumphalen und
hoffnungsvollen, vielverheissenden Aufstiegs in
welthistorischer, utopischer Bedeutung, die mit
der des individuellen Seelenheiles Hand in Hand
geht. Wir können dies Hinaufsehen bei den
Grabwächtern Christi beobachten, als Stufen des
Erwachens, Veit Stoss hat mit seinen gleich tief
schlafenden Wächtern am Krakauer Marienaltar
eine wahre Ausnahme gemacht. Ich möchte hier
auch auf solche Darstellungen hinweisen, wie die
„Blinden“ Brueghels sind. Sie gehen diagonal dem
Abgrund entgegen und diagonal folgt ihnen auch
das Licht von oben. Alle nehmen zu dem Lichte
verschiedene Stellung ein, einer scheint nach dem
Lichte schon den Kopf zu heben, das Licht zu
spüren. Licht, Sehen (auch im geistigen Sinn)
und Diagonale gehören auch hier zusammen.
Eine andere Entwicklungslinie bildet nun pa-
rallel die Kampf diagonale, die dem Wortklang
tatsächlich entspricht (di-agon-ale). Obwohl dies
eine falsche Ethymologie ist, in dem Wort erklingt
urspr. dia-gonos (Winkel), kann man sie von den
assyrischen Reliefs mit Darstellungen der Königs-
jagd über den persischen Mithras- oder Königs-
jäger und den sog. Thrakischen Reiter durch die
Kunstgeschichte weiterverfolgen, in dieser Be-
deutung. Die Kampfszenen zwischen Mensch und
Mensch folgen bald nach. Bei den Griechen blieb
es zunächst nur bei sich bäumenden Pferden
unter Heroen, auch an dem Parthenonfries (hier
vielleicht in direkter Antithese zu den persischen
Reitern). In der Diskussion zwischen Römern und
Persern kam es jedoch zur völligen Übernahme
und das Mittelalter setzt auch hier die Antithese
Rom-Persien fort. Ich will es an einem Beispiel
demonstrieren. Man vergleiche die Apokalypti-
schen Reiter Dürers mit 1. der Münze VICTORIA
PERSICA des Valerius, 2. mit dem Relief auf
einer persischen Silberschale, darstellend einen
Sassaniden (urspr. Mithras) auf der Jagd. Man
sieht, daß Dürer die Gruppierung der Menschen
rechts unten in der Art der sich ergebenden per-
106