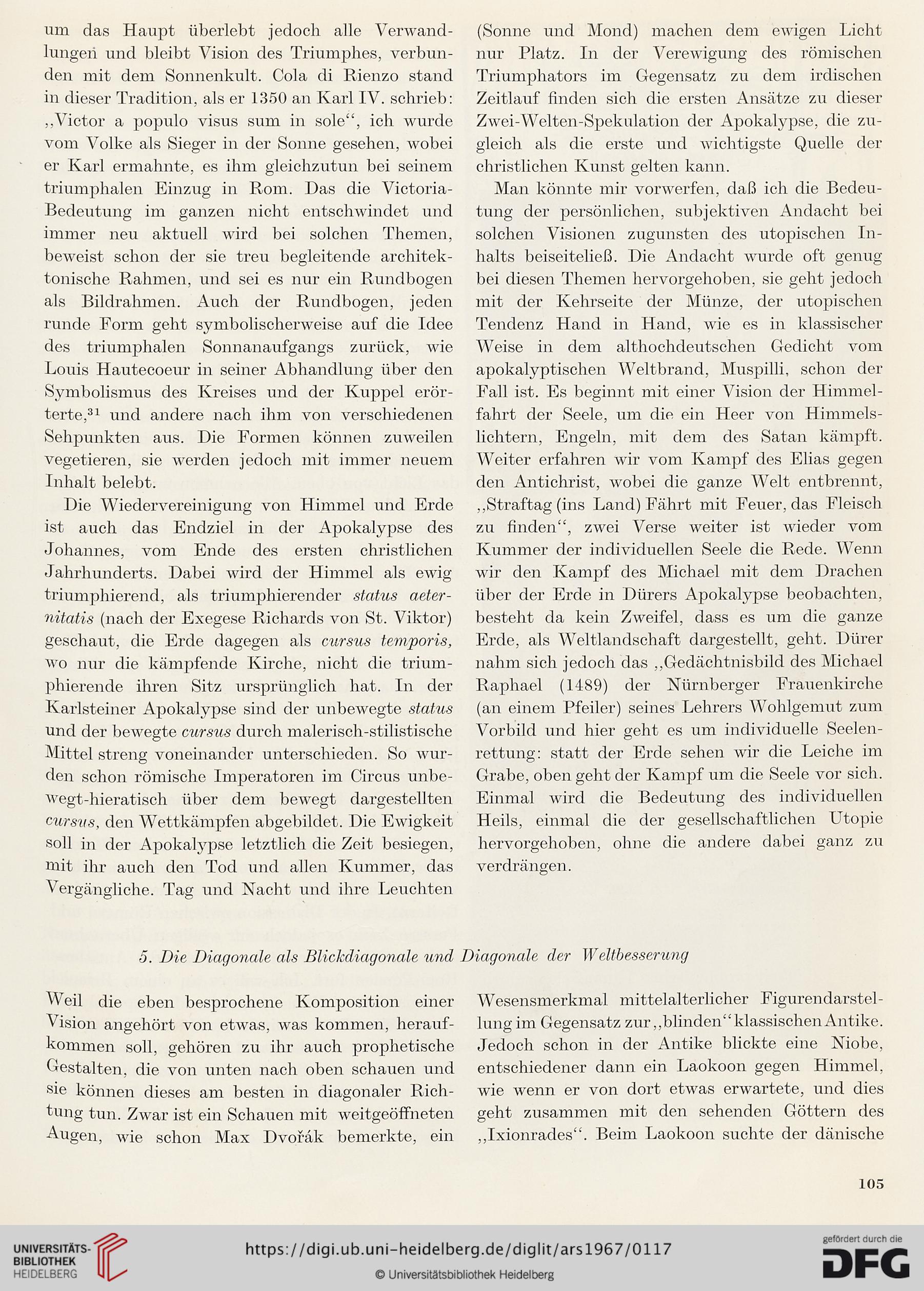um das Haupt überlebt jedoch alle Verwand-
lungen und bleibt Vision des Triumphes, verbun-
den mit dem Sonnenkult. Cola di Rienzo stand
in dieser Tradition, als er 1350 an Karl IV. schrieb:
„Victor a populo visus sum in sole“, ich wurde
vom Volke als Sieger in der Sonne gesehen, wobei
er Karl ermahnte, es ihm gleichzutun bei seinem
triumphalen Einzug in Rom. Das die Victoria-
Bedeutung im ganzen nicht entschwindet und
immer neu aktuell wird bei solchen Themen,
beweist schon der sie treu begleitende architek-
tonische Rahmen, und sei es nur ein Rundbogen
als Bildrahmen. Auch der Rundbogen, jeden
runde Form geht symbolischerweise auf die Idee
des triumphalen Sonnanaufgangs zurück, wie
Louis Hautecoeur in seiner Abhandlung über den
Symbolismus des Kreises und der Kuppel erör-
terte,31 und andere nach ihm von verschiedenen
Sehpunkten aus. Die Formen können zuweilen
vegetieren, sie werden jedoch mit immer neuem
Inhalt belebt.
Die Wiedervereinigung von Himmel und Erde
ist auch das Endziel in der Apokalypse des
Johannes, vom Ende des ersten christlichen
Jahrhunderts. Dabei wird der Himmel als ewig
triumphierend, als triumphierender status aeter-
nitatis (nach der Exegese Richards von St. Viktor)
geschaut, die Erde dagegen als cursus temporis,
wo nur die kämpfende Kirche, nicht die trium-
phierende ihren Sitz ursprünglich hat. In der
Karlsteiner Apokalypse sind der unbewegte status
und der bewegte cursus durch malerisch-stilistische
Mittel streng voneinander unterschieden. So wur-
den schon römische Imperatoren im Circus unbe-
wegt-hieratisch über dem bewegt dargestellten
cursus, den Wettkämpfen abgebildet. Die Ewigkeit
soll in der Apokalypse letztlich die Zeit besiegen,
mit ihr auch den Tod und allen Kummer, das
Vergängliche. Tag und Nacht und ihre Leuchten
(Sonne und Mond) machen dem ewigen Licht
nur Platz. In der Verewigung des römischen
Triumphators im Gegensatz zu dem irdischen
Zeitlauf finden sich die ersten Ansätze zu dieser
Zwei-Welten-Spekulation der Apokalypse, die zu-
gleich als die erste und wichtigste Quelle der
christlichen Kunst gelten kann.
Man könnte mir vorwerfen, daß ich die Bedeu-
tung der persönlichen, subjektiven Andacht bei
solchen Visionen zugunsten des utopischen In-
halts beiseiteließ. Die Andacht wurde oft genug
bei diesen Themen hervorgehoben, sie geht jedoch
mit der Kehrseite der Münze, der utopischen
Tendenz Hand in Hand, wie es in klassischer
Weise in dem althochdeutschen Gedicht vom
apokalyptischen Weltbrand, Muspilli, schon der
Fall ist. Es beginnt mit einer Vision der Himmel-
fahrt der Seele, um die ein Heer von Himmels-
lichtern, Engeln, mit dem des Satan kämpft.
Weiter erfahren wir vom Kampf des Elias gegen
den Antichrist, wobei die ganze Welt entbrennt,
„Straftag (ins Land) Fährt mit Feuer, das Fleisch
zu finden“, zwei Verse weiter ist wieder vom
Kummer der individuellen Seele die Rede. Wenn
wir den Kampf des Michael mit dem Drachen
über der Erde in Dürers Apokalypse beobachten,
besteht da kein Zweifel, dass es um die ganze
Erde, als Weltlandschaft dargestellt, geht. Dürer
nahm sich jedoch das „Gedächtnisbild des Michael
Raphael (1489) der Nürnberger Frauenkirche
(an einem Pfeiler) seines Lehrers Wohlgemut zum
Vorbild und hier geht es um individuelle Seelen-
rettung: statt der Erde sehen wir die Leiche im
Grabe, oben geht der Kampf um die Seele vor sich.
Einmal wird die Bedeutung des individuellen
Heils, einmal die der gesellschaftlichen Utopie
hervorgehoben, ohne die andere dabei ganz zu
verdrängen.
5. Die Diagonale als Blickdiagonale und Diagonale der Weltbesserung
Weil die eben besprochene Komposition einer
Vision angehört von etwas, was kommen, herauf-
kommen soll, gehören zu ihr auch prophetische
Gestalten, die von unten nach oben schauen und
sie können dieses am besten in diagonaler Rich-
tung tun. Zwar ist ein Schauen mit weitgeöffneten
Augen, wie schon Max Dvořák bemerkte, ein
Wesensmerkmal mittelalterlicher Figurendarstel-
lung im Gegensatz zur,,blinden“ klassischen Antike.
Jedoch schon in der Antike blickte eine Niobe,
entschiedener dann ein Laokoon gegen Himmel,
wie wenn er von dort etwas erwartete, und dies
geht zusammen mit den sehenden Göttern des
„Ixionrades“. Beim Laokoon suchte der dänische
105
lungen und bleibt Vision des Triumphes, verbun-
den mit dem Sonnenkult. Cola di Rienzo stand
in dieser Tradition, als er 1350 an Karl IV. schrieb:
„Victor a populo visus sum in sole“, ich wurde
vom Volke als Sieger in der Sonne gesehen, wobei
er Karl ermahnte, es ihm gleichzutun bei seinem
triumphalen Einzug in Rom. Das die Victoria-
Bedeutung im ganzen nicht entschwindet und
immer neu aktuell wird bei solchen Themen,
beweist schon der sie treu begleitende architek-
tonische Rahmen, und sei es nur ein Rundbogen
als Bildrahmen. Auch der Rundbogen, jeden
runde Form geht symbolischerweise auf die Idee
des triumphalen Sonnanaufgangs zurück, wie
Louis Hautecoeur in seiner Abhandlung über den
Symbolismus des Kreises und der Kuppel erör-
terte,31 und andere nach ihm von verschiedenen
Sehpunkten aus. Die Formen können zuweilen
vegetieren, sie werden jedoch mit immer neuem
Inhalt belebt.
Die Wiedervereinigung von Himmel und Erde
ist auch das Endziel in der Apokalypse des
Johannes, vom Ende des ersten christlichen
Jahrhunderts. Dabei wird der Himmel als ewig
triumphierend, als triumphierender status aeter-
nitatis (nach der Exegese Richards von St. Viktor)
geschaut, die Erde dagegen als cursus temporis,
wo nur die kämpfende Kirche, nicht die trium-
phierende ihren Sitz ursprünglich hat. In der
Karlsteiner Apokalypse sind der unbewegte status
und der bewegte cursus durch malerisch-stilistische
Mittel streng voneinander unterschieden. So wur-
den schon römische Imperatoren im Circus unbe-
wegt-hieratisch über dem bewegt dargestellten
cursus, den Wettkämpfen abgebildet. Die Ewigkeit
soll in der Apokalypse letztlich die Zeit besiegen,
mit ihr auch den Tod und allen Kummer, das
Vergängliche. Tag und Nacht und ihre Leuchten
(Sonne und Mond) machen dem ewigen Licht
nur Platz. In der Verewigung des römischen
Triumphators im Gegensatz zu dem irdischen
Zeitlauf finden sich die ersten Ansätze zu dieser
Zwei-Welten-Spekulation der Apokalypse, die zu-
gleich als die erste und wichtigste Quelle der
christlichen Kunst gelten kann.
Man könnte mir vorwerfen, daß ich die Bedeu-
tung der persönlichen, subjektiven Andacht bei
solchen Visionen zugunsten des utopischen In-
halts beiseiteließ. Die Andacht wurde oft genug
bei diesen Themen hervorgehoben, sie geht jedoch
mit der Kehrseite der Münze, der utopischen
Tendenz Hand in Hand, wie es in klassischer
Weise in dem althochdeutschen Gedicht vom
apokalyptischen Weltbrand, Muspilli, schon der
Fall ist. Es beginnt mit einer Vision der Himmel-
fahrt der Seele, um die ein Heer von Himmels-
lichtern, Engeln, mit dem des Satan kämpft.
Weiter erfahren wir vom Kampf des Elias gegen
den Antichrist, wobei die ganze Welt entbrennt,
„Straftag (ins Land) Fährt mit Feuer, das Fleisch
zu finden“, zwei Verse weiter ist wieder vom
Kummer der individuellen Seele die Rede. Wenn
wir den Kampf des Michael mit dem Drachen
über der Erde in Dürers Apokalypse beobachten,
besteht da kein Zweifel, dass es um die ganze
Erde, als Weltlandschaft dargestellt, geht. Dürer
nahm sich jedoch das „Gedächtnisbild des Michael
Raphael (1489) der Nürnberger Frauenkirche
(an einem Pfeiler) seines Lehrers Wohlgemut zum
Vorbild und hier geht es um individuelle Seelen-
rettung: statt der Erde sehen wir die Leiche im
Grabe, oben geht der Kampf um die Seele vor sich.
Einmal wird die Bedeutung des individuellen
Heils, einmal die der gesellschaftlichen Utopie
hervorgehoben, ohne die andere dabei ganz zu
verdrängen.
5. Die Diagonale als Blickdiagonale und Diagonale der Weltbesserung
Weil die eben besprochene Komposition einer
Vision angehört von etwas, was kommen, herauf-
kommen soll, gehören zu ihr auch prophetische
Gestalten, die von unten nach oben schauen und
sie können dieses am besten in diagonaler Rich-
tung tun. Zwar ist ein Schauen mit weitgeöffneten
Augen, wie schon Max Dvořák bemerkte, ein
Wesensmerkmal mittelalterlicher Figurendarstel-
lung im Gegensatz zur,,blinden“ klassischen Antike.
Jedoch schon in der Antike blickte eine Niobe,
entschiedener dann ein Laokoon gegen Himmel,
wie wenn er von dort etwas erwartete, und dies
geht zusammen mit den sehenden Göttern des
„Ixionrades“. Beim Laokoon suchte der dänische
105