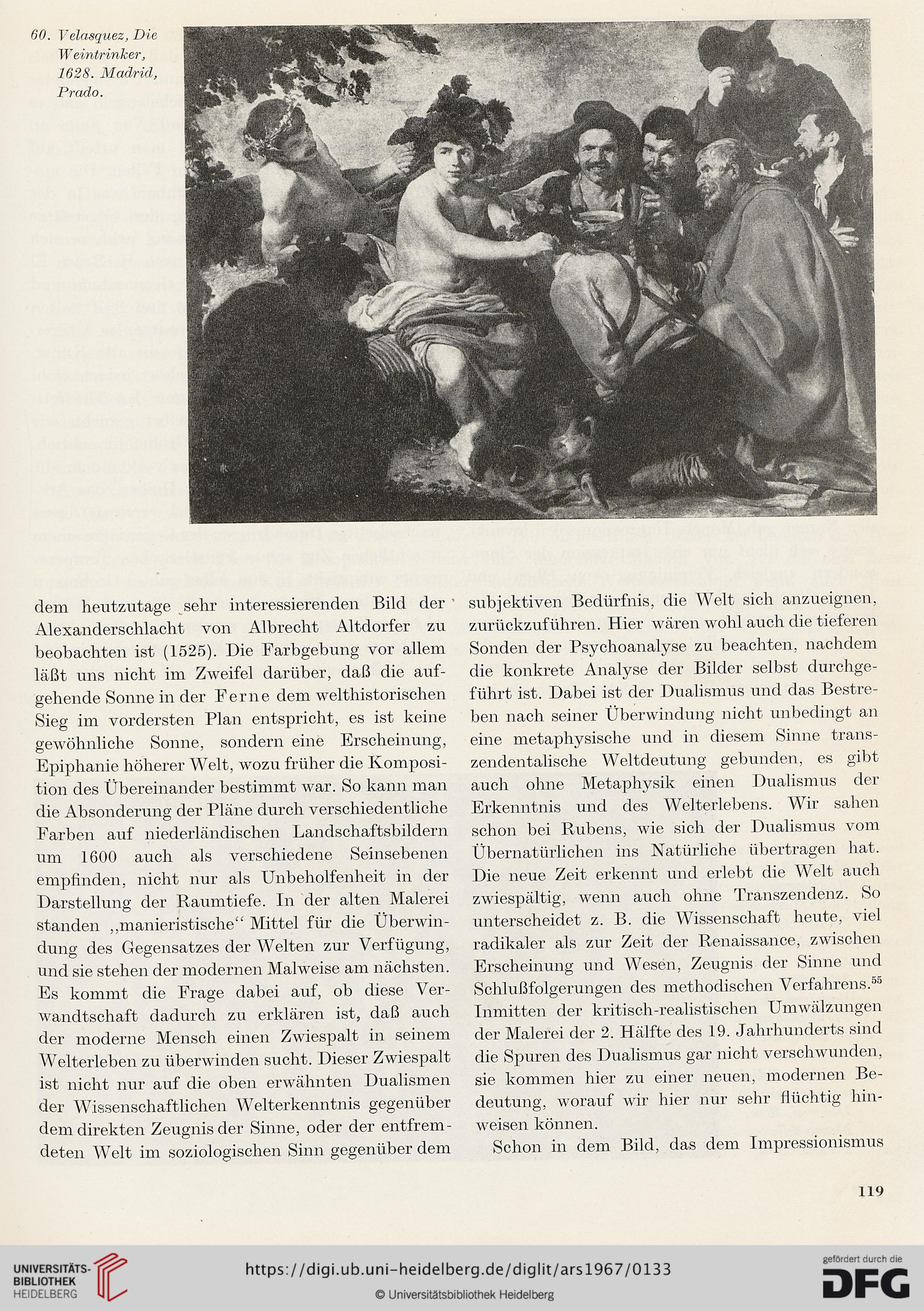60. Velasquez, Die
Weintrinker,
1628. Madrid,
Prado.
dem heutzutage sehr interessierenden Bild der
Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer zu
beobachten ist (1525). Die Farbgebung vor allem
läßt uns nicht im Zweifel darüber, daß die auf-
gehende Sonne in der F er ne dem welthistorischen
Sieg im vordersten Plan entspricht, es ist keine
gewöhnliche Sonne, sondern eine Erscheinung,
Epiphanie höherer Welt, wozu früher die Komposi-
tion des Übereinander bestimmt war. So kann man
die Absonderung der Pläne durch verschiedentliche
Farben auf niederländischen Landschaftsbildern
um 1600 auch als verschiedene Seinsebenen
empfinden, nicht nur als Unbeholfenheit in der
Darstellung der Raumtiefe. In der alten Malerei
standen „manieristische“ Mittel für die Überwin-
dung des Gegensatzes der Welten zur Verfügung,
und sie stehen der modernen Malweise am nächsten.
Es kommt die Frage dabei auf, ob diese Ver-
wandtschaft dadurch zu erklären ist, daß auch
der moderne Mensch einen Zwiespalt in seinem
Welterleben zu überwinden sucht. Dieser Zwiespalt
ist nicht nur auf die oben erwähnten Dualismen
der Wissenschaftlichen Welterkenntnis gegenüber
dem direkten Zeugnis der Sinne, oder der entfrem -
deten Welt im soziologischen Sinn gegenüber dem
subjektiven Bedürfnis, die Welt sich anzueignen,
zurückzuführen. Hier wären wohl auch die tieferen
Sonden der Psychoanalyse zu beachten, nachdem
die konkrete Analyse der Bilder selbst durchge-
führt ist. Dabei ist der Dualismus und das Bestre-
ben nach seiner Überwindung nicht unbedingt an
eine metaphysische und in diesem Sinne trans-
zendentalische Weltdeutung gebunden, es gibt
auch ohne Metaphysik einen Dualismus der
Erkenntnis und des Welterlebens. Wir sahen
schon bei Rubens, wie sich der Dualismus vom
Übernatürlichen ins Natürliche übertragen hat.
Die neue Zeit erkennt und erlebt die Welt auch
zwiespältig, wenn auch ohne Transzendenz. So
unterscheidet z. B. die Wissenschaft heute, viel
radikaler als zur Zeit der Renaissance, zwischen
Erscheinung und Wesen, Zeugnis der Sinne und
Schlußfolgerungen des methodischen Verfahrens.55
Inmitten der kritisch-realistischen Umwälzungen
der Malerei der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind
die Spuren des Dualismus gar nicht verschwunden,
sie kommen hier zu einer neuen, modernen Be-
deutung, worauf wir hier nur sehr flüchtig hin-
weisen können.
Schon in dem Bild, das dem Impressionismus
119
Weintrinker,
1628. Madrid,
Prado.
dem heutzutage sehr interessierenden Bild der
Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer zu
beobachten ist (1525). Die Farbgebung vor allem
läßt uns nicht im Zweifel darüber, daß die auf-
gehende Sonne in der F er ne dem welthistorischen
Sieg im vordersten Plan entspricht, es ist keine
gewöhnliche Sonne, sondern eine Erscheinung,
Epiphanie höherer Welt, wozu früher die Komposi-
tion des Übereinander bestimmt war. So kann man
die Absonderung der Pläne durch verschiedentliche
Farben auf niederländischen Landschaftsbildern
um 1600 auch als verschiedene Seinsebenen
empfinden, nicht nur als Unbeholfenheit in der
Darstellung der Raumtiefe. In der alten Malerei
standen „manieristische“ Mittel für die Überwin-
dung des Gegensatzes der Welten zur Verfügung,
und sie stehen der modernen Malweise am nächsten.
Es kommt die Frage dabei auf, ob diese Ver-
wandtschaft dadurch zu erklären ist, daß auch
der moderne Mensch einen Zwiespalt in seinem
Welterleben zu überwinden sucht. Dieser Zwiespalt
ist nicht nur auf die oben erwähnten Dualismen
der Wissenschaftlichen Welterkenntnis gegenüber
dem direkten Zeugnis der Sinne, oder der entfrem -
deten Welt im soziologischen Sinn gegenüber dem
subjektiven Bedürfnis, die Welt sich anzueignen,
zurückzuführen. Hier wären wohl auch die tieferen
Sonden der Psychoanalyse zu beachten, nachdem
die konkrete Analyse der Bilder selbst durchge-
führt ist. Dabei ist der Dualismus und das Bestre-
ben nach seiner Überwindung nicht unbedingt an
eine metaphysische und in diesem Sinne trans-
zendentalische Weltdeutung gebunden, es gibt
auch ohne Metaphysik einen Dualismus der
Erkenntnis und des Welterlebens. Wir sahen
schon bei Rubens, wie sich der Dualismus vom
Übernatürlichen ins Natürliche übertragen hat.
Die neue Zeit erkennt und erlebt die Welt auch
zwiespältig, wenn auch ohne Transzendenz. So
unterscheidet z. B. die Wissenschaft heute, viel
radikaler als zur Zeit der Renaissance, zwischen
Erscheinung und Wesen, Zeugnis der Sinne und
Schlußfolgerungen des methodischen Verfahrens.55
Inmitten der kritisch-realistischen Umwälzungen
der Malerei der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind
die Spuren des Dualismus gar nicht verschwunden,
sie kommen hier zu einer neuen, modernen Be-
deutung, worauf wir hier nur sehr flüchtig hin-
weisen können.
Schon in dem Bild, das dem Impressionismus
119