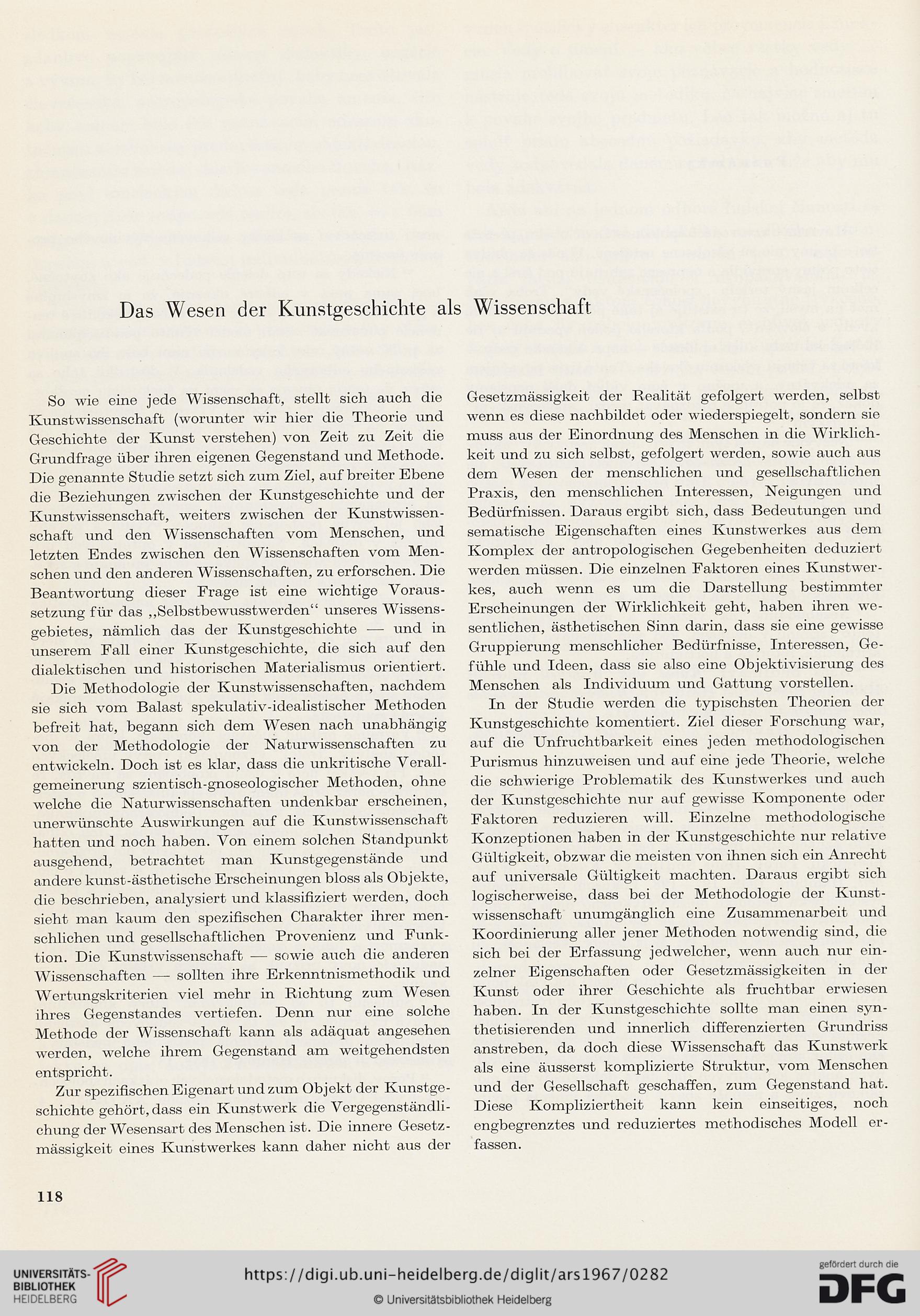Das Wesen der Kunstgeschichte als Wissenschaft
So wie eine jede Wissenschaft, stellt sich auch die
Kunstwissenschaft (worunter wir hier die Theorie und
Geschichte der Kunst verstehen) von Zeit zu Zeit die
Grundfrage über ihren eigenen Gegenstand und Methode.
Die genannte Studie setzt sich zum Ziel, auf breiter Ebene
die Beziehungen zwischen der Kunstgeschichte und der
Kunstwissenschaft, weiters zwischen der Kunstwissen-
schaft und den Wissenschaften vom Menschen, und
letzten Endes zwischen den Wissenschaften vom Men-
schen und den anderen Wissenschaften, zu erforschen. Die
Beantwortung dieser Frage ist eine wichtige Voraus-
setzung für das „Selbstbewusstwerden“ unseres Wissens-
gebietes, nämlich das der Kunstgeschichte — und in
unserem Fall einer Kunstgeschichte, die sich auf den
dialektischen und historischen Materialismus orientiert.
Die Methodologie der Kunstwissenschaften, nachdem
sie sich vom Balast spekulativ-idealistischer Methoden
befreit hat, begann sich dem Wesen nach unabhängig
von der Methodologie der Naturwissenschaften zu
entwickeln. Doch ist es klar, dass die unkritische Verall-
gemeinerung szientisch-gnoseologischer Methoden, ohne
welche die Naturwissenschaften undenkbar erscheinen,
unerwünschte Auswirkungen auf die Kunstwissenschaft
hatten und noch haben. Von einem solchen Standpunkt
ausgehend, betrachtet man Kunstgegenstände und
andere kunst-ästhetische Erscheinungen bloss als Objekte,
die beschrieben, analysiert und klassifiziert werden, doch
sieht man kaum den spezifischen Charakter ihrer men-
schlichen und gesellschaftlichen Provenienz und Funk-
tion. Die Kunstwissenschaft — sowie auch die anderen
Wissenschaften — sollten ihre Erkenntnismethodik und
Wertungskriterien viel mehr in Richtung zum Wesen
ihres Gegenstandes vertiefen. Denn nur eine solche
Methode der Wissenschaft kann als adäquat angesehen
werden, welche ihrem Gegenstand am weitgehendsten
entspricht.
Zur spezifischen Eigenart und zum Objekt der Kunstge-
schichte gehört, dass ein Kunstwerk die Vergegenständli-
chung der Wesensart des Menschen ist. Die innere Gesetz-
mässigkeit eines Kunstwerkes kann daher nicht aus der
Gesetzmässigkeit der Realität gefolgert werden, selbst
wenn es diese nachbildet oder wiederspiegelt, sondern sie
muss aus der Einordnung des Menschen in die Wirklich-
keit und zu sich selbst, gefolgert werden, sowie auch aus
dem Wesen der menschlichen und gesellschaftlichen
Praxis, den menschlichen Interessen, Neigungen und
Bedürfnissen. Daraus ergibt sich, dass Bedeutungen und
sematische Eigenschaften eines Kunstwerkes aus dem
Komplex der antropologischen Gegebenheiten deduziert
werden müssen. Die einzelnen Faktoren eines Kunstwer-
kes, auch wenn es um die Darstellung bestimmter
Erscheinungen der Wirklichkeit geht, haben ihren we-
sentlichen, ästhetischen Sinn darin, dass sie eine gewisse
Gruppierung menschlicher Bedürfnisse, Interessen, Ge-
fühle und Ideen, dass sie also eine Objektivisierung des
Menschen als Individuum und Gattung vorstellen.
In der Studie werden die typischsten Theorien der
Kunstgeschichte komentiert. Ziel dieser Forschung war,
auf die Unfruchtbarkeit eines jeden methodologischen
Purismus hinzuweisen und auf eine jede Theorie, welche
die schwierige Problematik des Kunstwerkes und auch
der Kunstgeschichte nur auf gewisse Komponente oder
Faktoren reduzieren will. Einzelne methodologische
Konzeptionen haben in der Kunstgeschichte nur relative
Gültigkeit, obzwar die meisten von ihnen sich ein Anrecht
auf universale Gültigkeit machten. Daraus ergibt sich
logischerweise, dass bei der Methodologie der Kunst-
wissenschaft unumgänglich eine Zusammenarbeit und
Koordinierung aller jener Methoden notwendig sind, die
sich bei der Erfassung jedwelcher, wenn auch nur ein-
zelner Eigenschaften oder Gesetzmässigkeiten in der
Kunst oder ihrer Geschichte als fruchtbar erwiesen
haben. In der Kunstgeschichte sollte man einen syn-
thetisierenden und innerlich differenzierten Grundriss
anstreben, da doch diese Wissenschaft das Kunstwerk
als eine äusserst komplizierte Struktur, vom Menschen
und der Gesellschaft geschaffen, zum Gegenstand hat.
Diese Kompliziertheit kann kein einseitiges, noch
engbegrenztes und reduziertes methodisches Modell er-
fassen.
118
So wie eine jede Wissenschaft, stellt sich auch die
Kunstwissenschaft (worunter wir hier die Theorie und
Geschichte der Kunst verstehen) von Zeit zu Zeit die
Grundfrage über ihren eigenen Gegenstand und Methode.
Die genannte Studie setzt sich zum Ziel, auf breiter Ebene
die Beziehungen zwischen der Kunstgeschichte und der
Kunstwissenschaft, weiters zwischen der Kunstwissen-
schaft und den Wissenschaften vom Menschen, und
letzten Endes zwischen den Wissenschaften vom Men-
schen und den anderen Wissenschaften, zu erforschen. Die
Beantwortung dieser Frage ist eine wichtige Voraus-
setzung für das „Selbstbewusstwerden“ unseres Wissens-
gebietes, nämlich das der Kunstgeschichte — und in
unserem Fall einer Kunstgeschichte, die sich auf den
dialektischen und historischen Materialismus orientiert.
Die Methodologie der Kunstwissenschaften, nachdem
sie sich vom Balast spekulativ-idealistischer Methoden
befreit hat, begann sich dem Wesen nach unabhängig
von der Methodologie der Naturwissenschaften zu
entwickeln. Doch ist es klar, dass die unkritische Verall-
gemeinerung szientisch-gnoseologischer Methoden, ohne
welche die Naturwissenschaften undenkbar erscheinen,
unerwünschte Auswirkungen auf die Kunstwissenschaft
hatten und noch haben. Von einem solchen Standpunkt
ausgehend, betrachtet man Kunstgegenstände und
andere kunst-ästhetische Erscheinungen bloss als Objekte,
die beschrieben, analysiert und klassifiziert werden, doch
sieht man kaum den spezifischen Charakter ihrer men-
schlichen und gesellschaftlichen Provenienz und Funk-
tion. Die Kunstwissenschaft — sowie auch die anderen
Wissenschaften — sollten ihre Erkenntnismethodik und
Wertungskriterien viel mehr in Richtung zum Wesen
ihres Gegenstandes vertiefen. Denn nur eine solche
Methode der Wissenschaft kann als adäquat angesehen
werden, welche ihrem Gegenstand am weitgehendsten
entspricht.
Zur spezifischen Eigenart und zum Objekt der Kunstge-
schichte gehört, dass ein Kunstwerk die Vergegenständli-
chung der Wesensart des Menschen ist. Die innere Gesetz-
mässigkeit eines Kunstwerkes kann daher nicht aus der
Gesetzmässigkeit der Realität gefolgert werden, selbst
wenn es diese nachbildet oder wiederspiegelt, sondern sie
muss aus der Einordnung des Menschen in die Wirklich-
keit und zu sich selbst, gefolgert werden, sowie auch aus
dem Wesen der menschlichen und gesellschaftlichen
Praxis, den menschlichen Interessen, Neigungen und
Bedürfnissen. Daraus ergibt sich, dass Bedeutungen und
sematische Eigenschaften eines Kunstwerkes aus dem
Komplex der antropologischen Gegebenheiten deduziert
werden müssen. Die einzelnen Faktoren eines Kunstwer-
kes, auch wenn es um die Darstellung bestimmter
Erscheinungen der Wirklichkeit geht, haben ihren we-
sentlichen, ästhetischen Sinn darin, dass sie eine gewisse
Gruppierung menschlicher Bedürfnisse, Interessen, Ge-
fühle und Ideen, dass sie also eine Objektivisierung des
Menschen als Individuum und Gattung vorstellen.
In der Studie werden die typischsten Theorien der
Kunstgeschichte komentiert. Ziel dieser Forschung war,
auf die Unfruchtbarkeit eines jeden methodologischen
Purismus hinzuweisen und auf eine jede Theorie, welche
die schwierige Problematik des Kunstwerkes und auch
der Kunstgeschichte nur auf gewisse Komponente oder
Faktoren reduzieren will. Einzelne methodologische
Konzeptionen haben in der Kunstgeschichte nur relative
Gültigkeit, obzwar die meisten von ihnen sich ein Anrecht
auf universale Gültigkeit machten. Daraus ergibt sich
logischerweise, dass bei der Methodologie der Kunst-
wissenschaft unumgänglich eine Zusammenarbeit und
Koordinierung aller jener Methoden notwendig sind, die
sich bei der Erfassung jedwelcher, wenn auch nur ein-
zelner Eigenschaften oder Gesetzmässigkeiten in der
Kunst oder ihrer Geschichte als fruchtbar erwiesen
haben. In der Kunstgeschichte sollte man einen syn-
thetisierenden und innerlich differenzierten Grundriss
anstreben, da doch diese Wissenschaft das Kunstwerk
als eine äusserst komplizierte Struktur, vom Menschen
und der Gesellschaft geschaffen, zum Gegenstand hat.
Diese Kompliziertheit kann kein einseitiges, noch
engbegrenztes und reduziertes methodisches Modell er-
fassen.
118