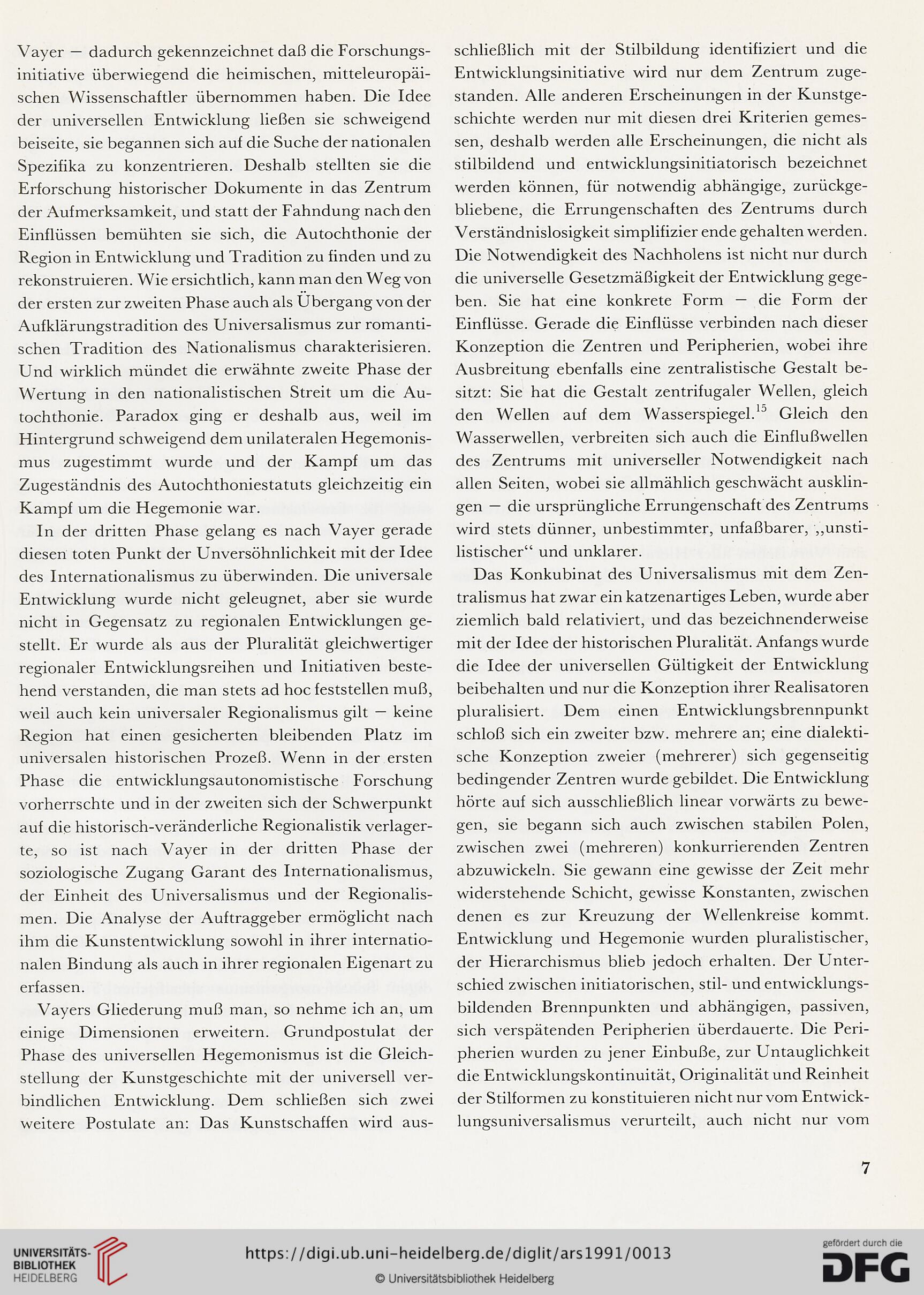Vayer — dadurch gekennzeichnet daß die Forschungs-
initiative überwiegend die heimischen, mitteleuropäi-
schen Wissenschaftler übernommen haben. Die Idee
der universellen Entwicklung ließen sie schweigend
beiseite, sie begannen sich auf die Suche der nationalen
Spezifika zu konzentrieren. Deshalb stellten sie die
Erforschung historischer Dokumente in das Zentrum
der Aufmerksamkeit, und statt der Fahndung nach den
Einflüssen bemühten sie sich, die Autochthonie der
Region in Entwicklung und Tradition zu finden und zu
rekonstruieren. Wie ersichtlich, kann man den Weg von
der ersten zur zweiten Phase auch als Übergang von der
Aufklärungstradition des Universalismus zur romanti-
schen Tradition des Nationalismus charakterisieren.
Und wirklich mündet die erwähnte zweite Phase der
Wertung in den nationalistischen Streit um die Au-
tochthonie. Paradox ging er deshalb aus, weil im
Hintergrund schweigend dem unilateralen Hegemonis-
mus zugestimmt wurde und der Kampf um das
Zugeständnis des Autochthoniestatuts gleichzeitig ein
Kampf um die Hegemonie war.
In der dritten Phase gelang es nach Vayer gerade
diesen toten Punkt der Unversöhnlichkeit mit der Idee
des Internationalismus zu überwinden. Die universale
Entwicklung wurde nicht geleugnet, aber sie wurde
nicht in Gegensatz zu regionalen Entwicklungen ge-
stellt. Er wurde als aus der Pluralität gleichwertiger
regionaler Entwicklungsreihen und Initiativen beste-
hend verstanden, die man stets ad hoc feststellen muß,
weil auch kein universaler Regionalismus gilt — keine
Region hat einen gesicherten bleibenden Platz im
universalen historischen Prozeß. Wenn in der ersten
Phase die entwicklungsautonomistische Forschung
vorherrschte und in der zweiten sich der Schwerpunkt
auf die historisch-veränderliche Regionalistik verlager-
te, so ist nach Vayer in der dritten Phase der
soziologische Zugang Garant des Internationalismus,
der Einheit des Universalismus und der Regionalis-
men. Die Analyse der Auftraggeber ermöglicht nach
ihm die Kunstentwicklung sowohl in ihrer internatio-
nalen Bindung als auch in ihrer regionalen Eigenart zu
erfassen.
Vayers Gliederung muß man, so nehme ich an, um
einige Dimensionen erweitern. Grundpostulat der
Phase des universellen Hegemonismus ist die Gleich-
stellung der Kunstgeschichte mit der universell ver-
bindlichen Entwicklung. Dem schließen sich zwei
weitere Postuláte an: Das Kunstschaffen wird aus-
schließlich mit der Stilbildung identifiziert und die
Entwicklungsinitiative wird nur dem Zentrum zuge-
standen. Alle anderen Erscheinungen in der Kunstge-
schichte werden nur mit diesen drei Kriterien gemes-
sen, deshalb werden alle Erscheinungen, die nicht als
stilbildend und entwicklungsinitiatorisch bezeichnet
werden können, für notwendig abhängige, zurückge-
bliebene, die Errungenschaften des Zentrums durch
Verständnislosigkeit simplifizier ende gehalten werden.
Die Notwendigkeit des Nachholens ist nicht nur durch
die universelle Gesetzmäßigkeit der Entwicklung gege-
ben. Sie hat eine konkrete Form — die Form der
Einflüsse. Gerade die Einflüsse verbinden nach dieser
Konzeption die Zentren und Peripherien, wobei ihre
Ausbreitung ebenfalls eine zentralistische Gestalt be-
sitzt: Sie hat die Gestalt zentrifugaler Wellen, gleich
den Wellen auf dem Wasserspiegel.13 Gleich den
Wasserwellen, verbreiten sich auch die Einflußwellen
des Zentrums mit universeller Notwendigkeit nach
allen Seiten, wobei sie allmählich geschwächt ausklin-
gen — die ursprüngliche Errungenschaft des Zentrums
wird stets dünner, unbestimmter, unfaßbarer, „unsti-
listischer“ und unklarer.
Das Konkubinat des Universalismus mit dem Zen-
tralismus hat zwar ein katzenartiges Leben, wurde aber
ziemlich bald relativiert, und das bezeichnenderweise
mit der Idee der historischen Pluralität. Anfangs wurde
die Idee der universellen Gültigkeit der Entwicklung
beibehalten und nur die Konzeption ihrer Realisatoren
pluralisiert. Dem einen Entwicklungsbrennpunkt
schloß sich ein zweiter bzw. mehrere an; eine dialekti-
sche Konzeption zweier (mehrerer) sich gegenseitig
bedingender Zentren wurde gebildet. Die Entwicklung
hörte auf sich ausschließlich linear vorwärts zu bewe-
gen, sie begann sich auch zwischen stabilen Polen,
zwischen zwei (mehreren) konkurrierenden Zentren
abzuwickeln. Sie gewann eine gewisse der Zeit mehr
widerstehende Schicht, gewisse Konstanten, zwischen
denen es zur Kreuzung der Wellenkreise kommt.
Entwicklung und Hegemonie wurden pluralistischer,
der Hierarchismus blieb jedoch erhalten. Der Unter-
schied zwischen initiatorischen, Stil- und entwicklungs-
bildenden Brennpunkten und abhängigen, passiven,
sich verspätenden Peripherien überdauerte. Die Peri-
pherien wurden zu jener Einbuße, zur Untauglichkeit
die Entwicklungskontinuität, Originalität und Reinheit
der Stilformen zu konstituieren nicht nur vom Entwick-
lungsuniversalismus verurteilt, auch nicht nur vom
7
initiative überwiegend die heimischen, mitteleuropäi-
schen Wissenschaftler übernommen haben. Die Idee
der universellen Entwicklung ließen sie schweigend
beiseite, sie begannen sich auf die Suche der nationalen
Spezifika zu konzentrieren. Deshalb stellten sie die
Erforschung historischer Dokumente in das Zentrum
der Aufmerksamkeit, und statt der Fahndung nach den
Einflüssen bemühten sie sich, die Autochthonie der
Region in Entwicklung und Tradition zu finden und zu
rekonstruieren. Wie ersichtlich, kann man den Weg von
der ersten zur zweiten Phase auch als Übergang von der
Aufklärungstradition des Universalismus zur romanti-
schen Tradition des Nationalismus charakterisieren.
Und wirklich mündet die erwähnte zweite Phase der
Wertung in den nationalistischen Streit um die Au-
tochthonie. Paradox ging er deshalb aus, weil im
Hintergrund schweigend dem unilateralen Hegemonis-
mus zugestimmt wurde und der Kampf um das
Zugeständnis des Autochthoniestatuts gleichzeitig ein
Kampf um die Hegemonie war.
In der dritten Phase gelang es nach Vayer gerade
diesen toten Punkt der Unversöhnlichkeit mit der Idee
des Internationalismus zu überwinden. Die universale
Entwicklung wurde nicht geleugnet, aber sie wurde
nicht in Gegensatz zu regionalen Entwicklungen ge-
stellt. Er wurde als aus der Pluralität gleichwertiger
regionaler Entwicklungsreihen und Initiativen beste-
hend verstanden, die man stets ad hoc feststellen muß,
weil auch kein universaler Regionalismus gilt — keine
Region hat einen gesicherten bleibenden Platz im
universalen historischen Prozeß. Wenn in der ersten
Phase die entwicklungsautonomistische Forschung
vorherrschte und in der zweiten sich der Schwerpunkt
auf die historisch-veränderliche Regionalistik verlager-
te, so ist nach Vayer in der dritten Phase der
soziologische Zugang Garant des Internationalismus,
der Einheit des Universalismus und der Regionalis-
men. Die Analyse der Auftraggeber ermöglicht nach
ihm die Kunstentwicklung sowohl in ihrer internatio-
nalen Bindung als auch in ihrer regionalen Eigenart zu
erfassen.
Vayers Gliederung muß man, so nehme ich an, um
einige Dimensionen erweitern. Grundpostulat der
Phase des universellen Hegemonismus ist die Gleich-
stellung der Kunstgeschichte mit der universell ver-
bindlichen Entwicklung. Dem schließen sich zwei
weitere Postuláte an: Das Kunstschaffen wird aus-
schließlich mit der Stilbildung identifiziert und die
Entwicklungsinitiative wird nur dem Zentrum zuge-
standen. Alle anderen Erscheinungen in der Kunstge-
schichte werden nur mit diesen drei Kriterien gemes-
sen, deshalb werden alle Erscheinungen, die nicht als
stilbildend und entwicklungsinitiatorisch bezeichnet
werden können, für notwendig abhängige, zurückge-
bliebene, die Errungenschaften des Zentrums durch
Verständnislosigkeit simplifizier ende gehalten werden.
Die Notwendigkeit des Nachholens ist nicht nur durch
die universelle Gesetzmäßigkeit der Entwicklung gege-
ben. Sie hat eine konkrete Form — die Form der
Einflüsse. Gerade die Einflüsse verbinden nach dieser
Konzeption die Zentren und Peripherien, wobei ihre
Ausbreitung ebenfalls eine zentralistische Gestalt be-
sitzt: Sie hat die Gestalt zentrifugaler Wellen, gleich
den Wellen auf dem Wasserspiegel.13 Gleich den
Wasserwellen, verbreiten sich auch die Einflußwellen
des Zentrums mit universeller Notwendigkeit nach
allen Seiten, wobei sie allmählich geschwächt ausklin-
gen — die ursprüngliche Errungenschaft des Zentrums
wird stets dünner, unbestimmter, unfaßbarer, „unsti-
listischer“ und unklarer.
Das Konkubinat des Universalismus mit dem Zen-
tralismus hat zwar ein katzenartiges Leben, wurde aber
ziemlich bald relativiert, und das bezeichnenderweise
mit der Idee der historischen Pluralität. Anfangs wurde
die Idee der universellen Gültigkeit der Entwicklung
beibehalten und nur die Konzeption ihrer Realisatoren
pluralisiert. Dem einen Entwicklungsbrennpunkt
schloß sich ein zweiter bzw. mehrere an; eine dialekti-
sche Konzeption zweier (mehrerer) sich gegenseitig
bedingender Zentren wurde gebildet. Die Entwicklung
hörte auf sich ausschließlich linear vorwärts zu bewe-
gen, sie begann sich auch zwischen stabilen Polen,
zwischen zwei (mehreren) konkurrierenden Zentren
abzuwickeln. Sie gewann eine gewisse der Zeit mehr
widerstehende Schicht, gewisse Konstanten, zwischen
denen es zur Kreuzung der Wellenkreise kommt.
Entwicklung und Hegemonie wurden pluralistischer,
der Hierarchismus blieb jedoch erhalten. Der Unter-
schied zwischen initiatorischen, Stil- und entwicklungs-
bildenden Brennpunkten und abhängigen, passiven,
sich verspätenden Peripherien überdauerte. Die Peri-
pherien wurden zu jener Einbuße, zur Untauglichkeit
die Entwicklungskontinuität, Originalität und Reinheit
der Stilformen zu konstituieren nicht nur vom Entwick-
lungsuniversalismus verurteilt, auch nicht nur vom
7