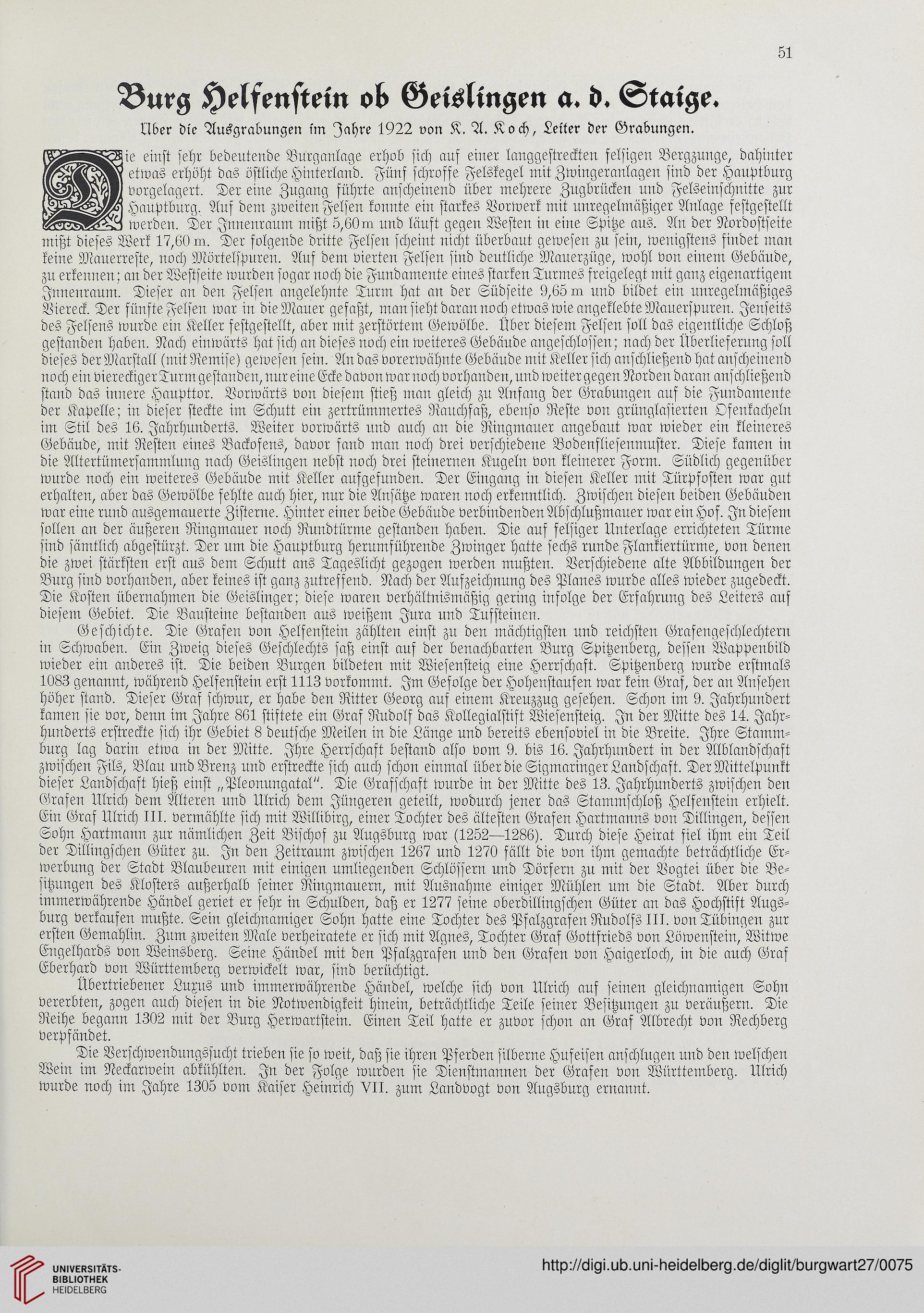51
Burg Helfenstein ob Geislingen a. d. Staige.
Aber die Ausgrabungen im Jahre 1922 von K. A. Koch, Letter der Grabungen.
ie einst sehr bedeutende Bnrganlage erhob sich auf einer langgestreckten felsigen Bergzunge, dahinter
etwas erhöht das östliche Hinterland. Fünf schroffe Felskegel mit Zwingeranlagen sind der Hauptburg
vorgelagert. Der eine Zugang führte anscheinend über mehrere Zugbrücken und Felseinschnitte zur
Hauptburg. Auf dem zweiten Felsen konnte ein starkes Vorwerk mit unregelmäßiger Anlage festgestellt
werden. Der Jnnenraum inißt 5,60 m und läuft gegen Westen in eine Spitze aus. An der Nordostseite
mißt dieses Werk 17,60 m. Der folgende dritte Felsen scheint nicht überbaut gewesen zu sein, wenigstens findet man
keine Mauerreste, noch Mörtelspuren. Auf dem vierten Felsen sind deutliche Mauerzüge, wohl von einem Gebäude,
zu erkennen; an der Westseite wurden sogar noch die Fundamente eines starken Turmes freigelegt mit ganz eigenartigem
Jnnenraum. Dieser an den Felsen angelehnte Turm hat an der Südseite 9,65 m und bildet ein unregelmäßiges
Viereck. Der fünfte Felsen war in die Mauer gefaßt, man sieht daran noch etwas wie angeklebte Mauerspuren. Jenseits
des Felsens wurde ein Keller festgestellt, aber mit zerstörtem Gewölbe. Über diesem Felsen soll das eigentliche Schloß
gestanden haben. Nach einwärts hat sich an dieses noch ein weiteres Gebäude angeschlossen; nach der Überlieferung soll
dieses der Marstall (mit Remise) gewesen sein. An das vorerwähnte Gebäude mit Keller sich anschließend hat anscheinend
noch ein viereckigerTurm gestanden, nur eine Ecke davon war noch vorhanden, und weiter gegen Norden daran anschließend
stand das innere Haupttor. Vorwärts von diesem stieß man gleich zu Anfang der Grabungen auf die Fundamente
der Kapelle; in dieser steckte im Schutt ein zertrümmertes Rauchfaß, ebenso Reste von grünglasierten Ofenkacheln
im Stil des 16. Jahrhunderts. Weiter vorwärts und auch an die Ringmauer angebaut war wieder ein kleineres
Gebäude, mit Resten eines Backofens, davor fand man noch drei verschiedene Bodenfliesenmuster. Diese kamen in
die Altertümersammlung nach Geislingen nebst noch drei steinernen Kugeln von kleinerer Form. Südlich gegenüber
wurde noch ein weiteres Gebäude mit Keller aufgefunden. Der Eingang in diesen Keller mit Türpfosten war gut
erhalten, aber das Gewölbe fehlte auch hier, nur die Ansätze waren noch erkenntlich. Zwischen diesen beiden Gebäuden
war eine rund ausgemauerte Zisterne. Hinter einer beide Gebäude verbindenden Abschlußmauer war ein Hof. In diesem
sollen an der äußeren Ringmauer noch Rundtürme gestanden haben. Die auf felsiger Unterlage errichteten Türme
sind sämtlich abgestürzt. Der um die Hauptburg herumführende Zwinger hatte sechs runde Flankiertürme, von denen
die zwei stärksten erst aus dem Schutt ans Tageslicht gezogen werden mußten. Verschiedene alte Abbildungen der
Burg sind vorhanden, aber keines ist ganz zutreffend. Nach der Aufzeichnung des Planes wurde alles wieder zugedeckt.
Die Kosten übernahmen die Geislinger; diese waren verhältnismäßig gering infolge der Erfahrung des Leiters auf
diesem Gebiet. Die Bausteine bestanden aus weißem Jura und Tufsteinen.
Geschichte. Die Grafen von Helfenstein zählten einst zu den mächtigsten und reichsten Grasengeschlechtern
in Schwaben. Ein Zweig dieses Geschlechts saß einst auf der benachbarten Burg Spitzenberg, dessen 'Wappenbild
wieder ein anderes ist. Die beiden Burgen bildeten mit Wiesensteig eine Herrschaft. Spitzenberg wurde erstmals
1083 genannt, während Helfenstein erst 1113 vorkommt. Im Gefolge der Hohenstaufen war kein Graf, der an Ansehen
höher stand. Dieser Graf schwur, er habe den Ritter Georg auf einem Kreuzzug gesehen. Schon im 9. Jahrhundert
kamen sie vor, denn im Jahre 861 stiftete ein Graf Rudolf das Kollegialstift Wiesensteig. In der Mitte des 14. Jahr-
hunderts erstreckte sich ihr Gebiet 8 deutsche Meilen in die Länge und bereits ebensoviel in die Breite. Ihre Stamm-
burg lag darin etwa in der Mitte. Ihre Herrschaft bestand also vom 9. bis 16. Jahrhundert in der Alblandschaft
zwischen Fils, Blau und Brenz und erstreckte sich auch schon einmal über die Sigmaringer Landschaft. Der Mittelpunkt
dieser Landschaft hieß einst „Pleonungatäl". Die Grafschaft wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts zwischen den
Grafen Ulrich dem Älteren und Ulrich dem Jüngeren geteilt, wodurch jener das Stammschloß Helfenstein erhielt.
Ein Graf Ulrich III. vermählte sich mit Willibirg, einer Tochter des ältesten Grafen Hartmauns von Dillingen, dessen
Sohn Hartmann zur nämlichen Zeit Bischof zu Augsburg war (1252—1286). Durch diese Heirat fiel ihm ein Teil
der Dillingschen Güter zu. In den Zeitraum zwischen 1267 und 1270 fällt die von ihm gemachte beträchtliche Er-
werbung der Stadt Blaubeuren mit einigen umliegenden Schlössern und Dörfern zu mit der Vogtei über die Be-
sitzungen des Klosters außerhalb seiner Ringmauern, mit Ausnahme einiger Mühlen um die Stadt. Aber durch
immerwährende Händel geriet er sehr in Schulden, daß er 1277 seine oberdillingschen Güter an das Hochstift Augs-
burg verkaufen mußte. Sein gleichnamiger Sohn hatte eine Tochter des Pfälzgrafen Rudolfs III. von Tübingen zur
ersten Gemahlin. Zum zweiten Male verheiratete er sich mit Agnes, Tochter Graf Gottfrieds von Löwenstein, Witwe
Engelhards von Weinsberg. Seine Händel mit den Pfalzgrafen und den Grafen von Haigerloch, in die auch Graf
Eberhard von Württemberg verwickelt war, sind berüchtigt.
Übertriebener Luxus und immerwährende Händel, welche sich von Ulrich auf seinen gleichnamigen Sohn
vererbten, Zogen auch diesen in die Notwendigkeit hinein, beträchtliche Teile seiner Besitzungen zu veräußern. Die
Reihe begann 1302 mit der Burg Herwartstein. Einen Teil hatte er zuvor schon an Graf Albrecht von Rechberg
verpfändet.
Die Verschwendungssucht trieben sie so weit, daß sie ihren Pferden silberne Hufeisen anschlugen und den welschen
Wein im Neckarwein abkühlten. In der Folge wurden sie Dienstmannen der Grafen von Württemberg. Ulrich
wurde noch im Jahre 1305 vom Kaiser Heinrich VII. zum Landvogt von Augsburg ernannt.
Burg Helfenstein ob Geislingen a. d. Staige.
Aber die Ausgrabungen im Jahre 1922 von K. A. Koch, Letter der Grabungen.
ie einst sehr bedeutende Bnrganlage erhob sich auf einer langgestreckten felsigen Bergzunge, dahinter
etwas erhöht das östliche Hinterland. Fünf schroffe Felskegel mit Zwingeranlagen sind der Hauptburg
vorgelagert. Der eine Zugang führte anscheinend über mehrere Zugbrücken und Felseinschnitte zur
Hauptburg. Auf dem zweiten Felsen konnte ein starkes Vorwerk mit unregelmäßiger Anlage festgestellt
werden. Der Jnnenraum inißt 5,60 m und läuft gegen Westen in eine Spitze aus. An der Nordostseite
mißt dieses Werk 17,60 m. Der folgende dritte Felsen scheint nicht überbaut gewesen zu sein, wenigstens findet man
keine Mauerreste, noch Mörtelspuren. Auf dem vierten Felsen sind deutliche Mauerzüge, wohl von einem Gebäude,
zu erkennen; an der Westseite wurden sogar noch die Fundamente eines starken Turmes freigelegt mit ganz eigenartigem
Jnnenraum. Dieser an den Felsen angelehnte Turm hat an der Südseite 9,65 m und bildet ein unregelmäßiges
Viereck. Der fünfte Felsen war in die Mauer gefaßt, man sieht daran noch etwas wie angeklebte Mauerspuren. Jenseits
des Felsens wurde ein Keller festgestellt, aber mit zerstörtem Gewölbe. Über diesem Felsen soll das eigentliche Schloß
gestanden haben. Nach einwärts hat sich an dieses noch ein weiteres Gebäude angeschlossen; nach der Überlieferung soll
dieses der Marstall (mit Remise) gewesen sein. An das vorerwähnte Gebäude mit Keller sich anschließend hat anscheinend
noch ein viereckigerTurm gestanden, nur eine Ecke davon war noch vorhanden, und weiter gegen Norden daran anschließend
stand das innere Haupttor. Vorwärts von diesem stieß man gleich zu Anfang der Grabungen auf die Fundamente
der Kapelle; in dieser steckte im Schutt ein zertrümmertes Rauchfaß, ebenso Reste von grünglasierten Ofenkacheln
im Stil des 16. Jahrhunderts. Weiter vorwärts und auch an die Ringmauer angebaut war wieder ein kleineres
Gebäude, mit Resten eines Backofens, davor fand man noch drei verschiedene Bodenfliesenmuster. Diese kamen in
die Altertümersammlung nach Geislingen nebst noch drei steinernen Kugeln von kleinerer Form. Südlich gegenüber
wurde noch ein weiteres Gebäude mit Keller aufgefunden. Der Eingang in diesen Keller mit Türpfosten war gut
erhalten, aber das Gewölbe fehlte auch hier, nur die Ansätze waren noch erkenntlich. Zwischen diesen beiden Gebäuden
war eine rund ausgemauerte Zisterne. Hinter einer beide Gebäude verbindenden Abschlußmauer war ein Hof. In diesem
sollen an der äußeren Ringmauer noch Rundtürme gestanden haben. Die auf felsiger Unterlage errichteten Türme
sind sämtlich abgestürzt. Der um die Hauptburg herumführende Zwinger hatte sechs runde Flankiertürme, von denen
die zwei stärksten erst aus dem Schutt ans Tageslicht gezogen werden mußten. Verschiedene alte Abbildungen der
Burg sind vorhanden, aber keines ist ganz zutreffend. Nach der Aufzeichnung des Planes wurde alles wieder zugedeckt.
Die Kosten übernahmen die Geislinger; diese waren verhältnismäßig gering infolge der Erfahrung des Leiters auf
diesem Gebiet. Die Bausteine bestanden aus weißem Jura und Tufsteinen.
Geschichte. Die Grafen von Helfenstein zählten einst zu den mächtigsten und reichsten Grasengeschlechtern
in Schwaben. Ein Zweig dieses Geschlechts saß einst auf der benachbarten Burg Spitzenberg, dessen 'Wappenbild
wieder ein anderes ist. Die beiden Burgen bildeten mit Wiesensteig eine Herrschaft. Spitzenberg wurde erstmals
1083 genannt, während Helfenstein erst 1113 vorkommt. Im Gefolge der Hohenstaufen war kein Graf, der an Ansehen
höher stand. Dieser Graf schwur, er habe den Ritter Georg auf einem Kreuzzug gesehen. Schon im 9. Jahrhundert
kamen sie vor, denn im Jahre 861 stiftete ein Graf Rudolf das Kollegialstift Wiesensteig. In der Mitte des 14. Jahr-
hunderts erstreckte sich ihr Gebiet 8 deutsche Meilen in die Länge und bereits ebensoviel in die Breite. Ihre Stamm-
burg lag darin etwa in der Mitte. Ihre Herrschaft bestand also vom 9. bis 16. Jahrhundert in der Alblandschaft
zwischen Fils, Blau und Brenz und erstreckte sich auch schon einmal über die Sigmaringer Landschaft. Der Mittelpunkt
dieser Landschaft hieß einst „Pleonungatäl". Die Grafschaft wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts zwischen den
Grafen Ulrich dem Älteren und Ulrich dem Jüngeren geteilt, wodurch jener das Stammschloß Helfenstein erhielt.
Ein Graf Ulrich III. vermählte sich mit Willibirg, einer Tochter des ältesten Grafen Hartmauns von Dillingen, dessen
Sohn Hartmann zur nämlichen Zeit Bischof zu Augsburg war (1252—1286). Durch diese Heirat fiel ihm ein Teil
der Dillingschen Güter zu. In den Zeitraum zwischen 1267 und 1270 fällt die von ihm gemachte beträchtliche Er-
werbung der Stadt Blaubeuren mit einigen umliegenden Schlössern und Dörfern zu mit der Vogtei über die Be-
sitzungen des Klosters außerhalb seiner Ringmauern, mit Ausnahme einiger Mühlen um die Stadt. Aber durch
immerwährende Händel geriet er sehr in Schulden, daß er 1277 seine oberdillingschen Güter an das Hochstift Augs-
burg verkaufen mußte. Sein gleichnamiger Sohn hatte eine Tochter des Pfälzgrafen Rudolfs III. von Tübingen zur
ersten Gemahlin. Zum zweiten Male verheiratete er sich mit Agnes, Tochter Graf Gottfrieds von Löwenstein, Witwe
Engelhards von Weinsberg. Seine Händel mit den Pfalzgrafen und den Grafen von Haigerloch, in die auch Graf
Eberhard von Württemberg verwickelt war, sind berüchtigt.
Übertriebener Luxus und immerwährende Händel, welche sich von Ulrich auf seinen gleichnamigen Sohn
vererbten, Zogen auch diesen in die Notwendigkeit hinein, beträchtliche Teile seiner Besitzungen zu veräußern. Die
Reihe begann 1302 mit der Burg Herwartstein. Einen Teil hatte er zuvor schon an Graf Albrecht von Rechberg
verpfändet.
Die Verschwendungssucht trieben sie so weit, daß sie ihren Pferden silberne Hufeisen anschlugen und den welschen
Wein im Neckarwein abkühlten. In der Folge wurden sie Dienstmannen der Grafen von Württemberg. Ulrich
wurde noch im Jahre 1305 vom Kaiser Heinrich VII. zum Landvogt von Augsburg ernannt.