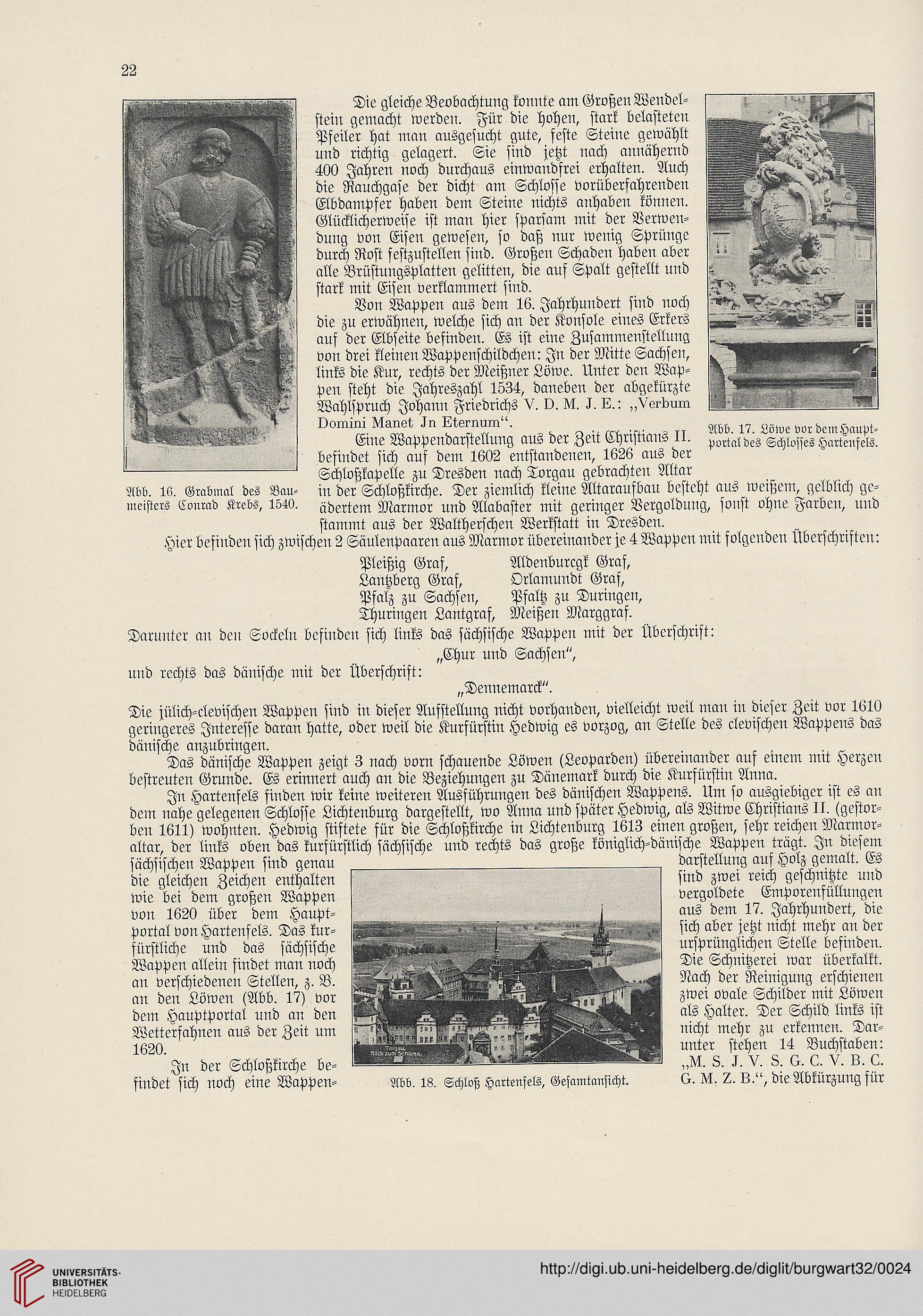22
Die gleiche Beobachtung konnte am Großen Wendel-
stein geinacht werden. Für die hohen, stark belasteten
Pfeiler hat man ausgesucht gute, feste Steine gewählt
und richtig gelagert. Sie sind jetzt nach annähernd
400 Jahren noch durchaus einwandfrei erhalten. Auch
die Rauchgase der dicht am Schlosse vorüberfahrenden
Elbdampfer haben dem Steine nichts anhaben können.
Glücklicherweise ist man hier sparsam mit der Verwen-
dung von Eisen gewesen, so daß nur wenig Sprünge
durch Rost festzustellen find. Großen Schaden haben aber
alle Brüstungsplatten gelitten, die auf Spalt gestellt und
stark mit Eisen verklammert sind.
Von Wappen aus dem 16. Jahrhundert sind noch
die zu erwähnen, welche sich an der Konsole eines Erkers
auf der Elbseite befinden. Es ist eine Zusammenstellung
von drei kleinen Wappenschildchen: In der Mitte Sachsen,
links die Kur, rechts der Meißner Löwe. Unter den Wap-
pen steht die Jahreszahl 1534, daneben der abgekürzte
Wahlspruch Johann Friedrichs V. D. LI. 1. U.: „Verbum
Domini Nanet ln Ulernum".
Eine Wappendarstellung aus der Zeit Christians II.
befindet sich auf dem 1602 entstandenen, 1626 aus der
Schloßkapelle zu Dresden nach Torgau gebrachten Altar
in der Schloßkirche. Der ziemlich kleine Altaraufbau besteht aus weißem, gelblich ge-
ädertem Marmor und Alabaster mit geringer Vergoldung, sonst ohne Farben, und
stammt aus der Waltherschen Werkstatt in Dresden.
Hier befinden sich zwischen 2 Säulenpaaren aus Marmor übereinander je 4 Wappen mit folgenden Überschriften:
Abb. 17. Löwe vordem Haupt-
portal des Schlosses Hartenfels.
Abb. 16. Grabmal des Bau-
meisters Conrad Krebs, 1540.
Pleißig Graf, Aldenburcgk Graf,
Lantzberg Graf, Orlamundt Graf,
Pfalz zu Sachsen, Pfaltz zu Duringen,
Thüringen Lantgraf, Meißen Marggraf.
Darunter au den Sockeln befinden sich links das sächsische Wappen mit der Überschrift:
„Chur und Sachsen",
und rechts das dänische mit der Überschrift:
„Dennemarck".
Die jülich-clevischen Wappen sind in dieser Aufstellung nicht vorhanden, vielleicht weil man in dieser Zeit vor 1610
geringeres Interesse daran hatte, oder weil die Kurfürstin Hedwig es vorzog, an Stelle des clevischen Wappens das
dänische auzubringen.
Das dänische Wappen zeigt 3 nach vorn schauende Löwen (Leoparden) übereinander auf einem mit Herzen
bestreuten Grunde. Es erinnert auch all die Beziehungen zu Dänemark durch die Kurfürstin Anna.
In Hartenfels finden wir keine weiteren Ausführungen des dänischen Wappens. Um so ausgiebiger ist es an
dem nahe gelegenen Schlosse Lichtenburg dargestellt, wo Anna und später Hedwig, als Witwe Christians I I. (gestor-
ben 1611) wohnten. Hedwig stiftete für die Schloßkirche in Lichtenburg 1613 einen großen, sehr reichen Marmor-
altar, der links oben das kurfürstlich sächsische und rechts das große königlich-dänische Wappen trägt. In diesem
sächsischen Wappen sind genau _ darstellung auf Holz gemalt. Es
die gleichen Zeichen enthalten sind zwei reich geschnitzte und
wie bei dem^ großen Wappen - ^ ^bbidet^ E^ip^ownf^ürlng^n
findet^sich noch" eine Wappen- Abb. 18. Schloß Hartenfels, Gesamtansicht. o. LI. 2.1!.", die Abkürzung für
Die gleiche Beobachtung konnte am Großen Wendel-
stein geinacht werden. Für die hohen, stark belasteten
Pfeiler hat man ausgesucht gute, feste Steine gewählt
und richtig gelagert. Sie sind jetzt nach annähernd
400 Jahren noch durchaus einwandfrei erhalten. Auch
die Rauchgase der dicht am Schlosse vorüberfahrenden
Elbdampfer haben dem Steine nichts anhaben können.
Glücklicherweise ist man hier sparsam mit der Verwen-
dung von Eisen gewesen, so daß nur wenig Sprünge
durch Rost festzustellen find. Großen Schaden haben aber
alle Brüstungsplatten gelitten, die auf Spalt gestellt und
stark mit Eisen verklammert sind.
Von Wappen aus dem 16. Jahrhundert sind noch
die zu erwähnen, welche sich an der Konsole eines Erkers
auf der Elbseite befinden. Es ist eine Zusammenstellung
von drei kleinen Wappenschildchen: In der Mitte Sachsen,
links die Kur, rechts der Meißner Löwe. Unter den Wap-
pen steht die Jahreszahl 1534, daneben der abgekürzte
Wahlspruch Johann Friedrichs V. D. LI. 1. U.: „Verbum
Domini Nanet ln Ulernum".
Eine Wappendarstellung aus der Zeit Christians II.
befindet sich auf dem 1602 entstandenen, 1626 aus der
Schloßkapelle zu Dresden nach Torgau gebrachten Altar
in der Schloßkirche. Der ziemlich kleine Altaraufbau besteht aus weißem, gelblich ge-
ädertem Marmor und Alabaster mit geringer Vergoldung, sonst ohne Farben, und
stammt aus der Waltherschen Werkstatt in Dresden.
Hier befinden sich zwischen 2 Säulenpaaren aus Marmor übereinander je 4 Wappen mit folgenden Überschriften:
Abb. 17. Löwe vordem Haupt-
portal des Schlosses Hartenfels.
Abb. 16. Grabmal des Bau-
meisters Conrad Krebs, 1540.
Pleißig Graf, Aldenburcgk Graf,
Lantzberg Graf, Orlamundt Graf,
Pfalz zu Sachsen, Pfaltz zu Duringen,
Thüringen Lantgraf, Meißen Marggraf.
Darunter au den Sockeln befinden sich links das sächsische Wappen mit der Überschrift:
„Chur und Sachsen",
und rechts das dänische mit der Überschrift:
„Dennemarck".
Die jülich-clevischen Wappen sind in dieser Aufstellung nicht vorhanden, vielleicht weil man in dieser Zeit vor 1610
geringeres Interesse daran hatte, oder weil die Kurfürstin Hedwig es vorzog, an Stelle des clevischen Wappens das
dänische auzubringen.
Das dänische Wappen zeigt 3 nach vorn schauende Löwen (Leoparden) übereinander auf einem mit Herzen
bestreuten Grunde. Es erinnert auch all die Beziehungen zu Dänemark durch die Kurfürstin Anna.
In Hartenfels finden wir keine weiteren Ausführungen des dänischen Wappens. Um so ausgiebiger ist es an
dem nahe gelegenen Schlosse Lichtenburg dargestellt, wo Anna und später Hedwig, als Witwe Christians I I. (gestor-
ben 1611) wohnten. Hedwig stiftete für die Schloßkirche in Lichtenburg 1613 einen großen, sehr reichen Marmor-
altar, der links oben das kurfürstlich sächsische und rechts das große königlich-dänische Wappen trägt. In diesem
sächsischen Wappen sind genau _ darstellung auf Holz gemalt. Es
die gleichen Zeichen enthalten sind zwei reich geschnitzte und
wie bei dem^ großen Wappen - ^ ^bbidet^ E^ip^ownf^ürlng^n
findet^sich noch" eine Wappen- Abb. 18. Schloß Hartenfels, Gesamtansicht. o. LI. 2.1!.", die Abkürzung für