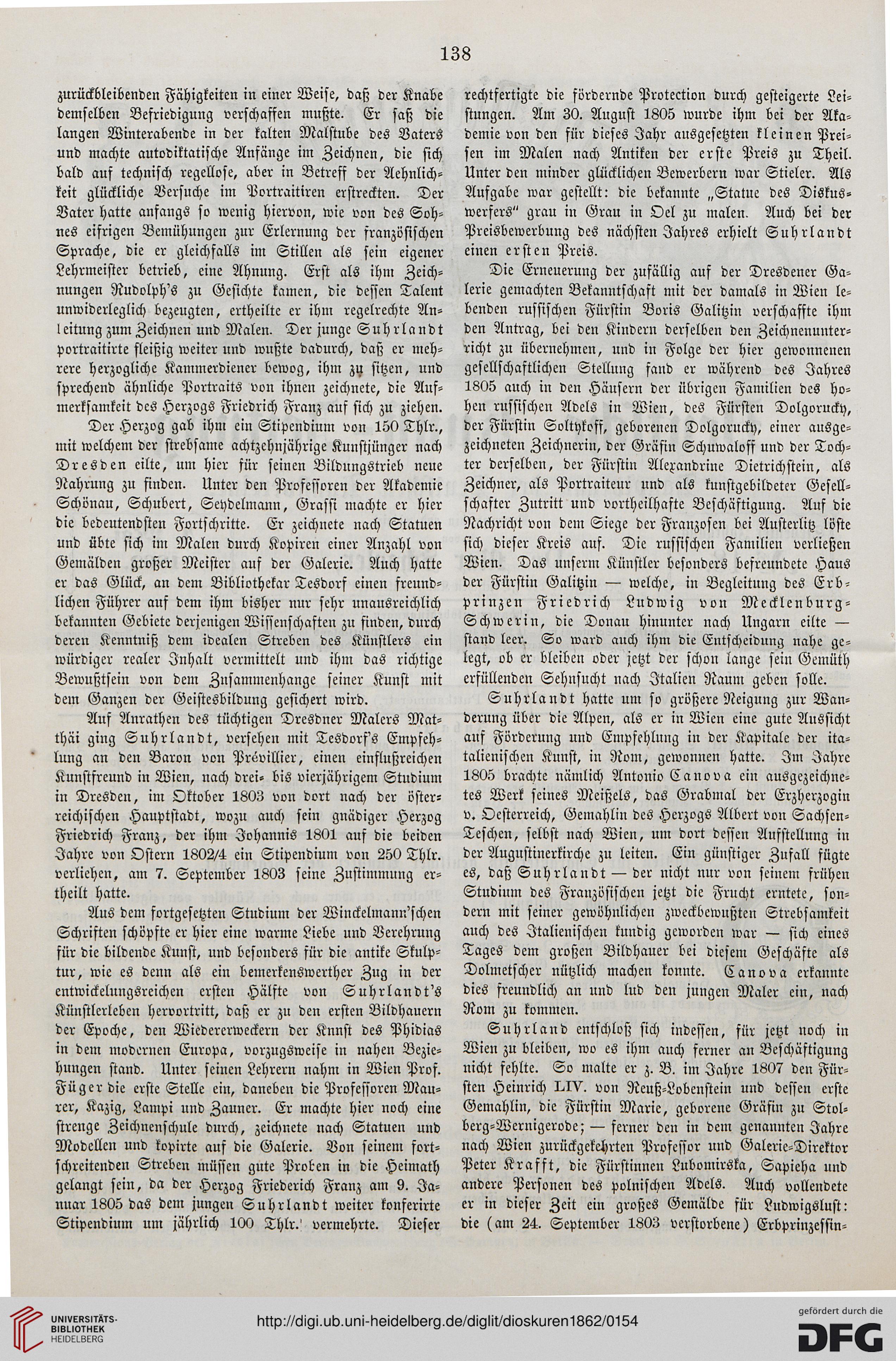138
zurückbleibenden Fähigkeiten in einer Weise, daß der Knabe
demselben Befriedigung verschaffen mußte. Er saß die
langen Winterabende in der kalten Malstube des Vaters
und machte autodiktatische Anfänge im Zeichnen, die sich
bald auf technisch regellose, aber in Betreff der Aehnlich-
keit glückliche Versuche im Vortraitiren erstreckten. Der
Vater hatte anfangs so wenig hiervon, wie von des Soh-
nes eifrigen Bemühungen zur Erlernung der französischen
Sprache, die er gleichfalls im Stillen als sein eigener
Lehrmeister betrieb, eine Ahnung. Erst als ihm Zeich-
nungen Rudolph's zu Gesichte kamen, die dessen Talent
unwiderleglich bezeugten, erthciltc er ihm regelrechte An-
leitung zum Zeichnen und Malen. Der junge Suh rlandt
portraitirte fleißig weiter und wußte dadurch, daß er meh-
rere herzogliche Kammerdiener bewog, ihm zu sitzen, und
sprechend ähnliche Portraits von ihnen zeichnete, die Auf-
merksamkeit des Herzogs Friedrich Franz auf sich zu ziehen.
Der Herzog gab ihm ein Stipendium von 150 Thlr.,
mit welchem der strebsame achtzehnjährige Kunstjünger nach
Dresden eilte, um hier für seinen Bildungstrieb neue
Nahrung zu finden. Unter den Professoren der Akademie
Schönau, Schubert, Seydelmann, Grassi machte er hier
die bedeutendsten Fortschritte. Er zeichnete nach Statuen
und übte sich im Malen durch Kopiren einer Anzahl von
Gemälden großer Meister auf der Galerie. Auch hatte
er das Glück, an dem Bibliothekar Tesdorf einen freund-
lichen Führer ans dem ihm bisher nur sehr unausreichlich
bekannten Gebiete derjenigen Wissenschaften zu finden, durch
deren Kenntniß dem idealen Streben des Künstlers ein
würdiger realer Inhalt vermittelt und ihm das richtige
Bewußtsein von dem Zusammenhänge seiner Kunst mit
dem Ganzen der Geistesbildung gesichert wird.
Auf Anrathen des tüchtigen Dresdner Malers Mat-
thäi ging Suhrlandt, versehen mit Tesdorf's Empfeh-
lung an den Baron von Provillier, einen einflußreichen
Kunstfreund in Wien, nach drei- bis vierjährigem Studium
in Dresden, im Oktober 1803 von dort nach der öster-
reichischen Hauptstadt, wozu auch sein gnädiger Herzog
Friedrich Franz, der ihm Johannis 1801 auf die beiden
Jahre von Ostern 1802/4 ein Stipendium von 250 Thlr.
verliehen, am 7. September 1803 seine Zustimmung er-
theilt hatte.
Aus dem fortgesetzten Studium der Winckelmann'schen
Schriften schöpfte er hier eine warme Liebe und Verehrung
für die bildende Kunst, und besonders für die antike Skulp-
tur, wie es denn als ein bemerkenswerthcr Zug in der
entwickelungsreichcn ersten Hälfte von Suhrlandt's
Künstlcrlcbcn hervortritt, daß er zu den ersten Bildhauern
der Epoche, den Wiedercrweckern der Knnst des Phidias
in dem modernen Europa, vorzugsweise in nahen Bezie-
hungen stand. Unter seinen Lehrern nahm in Wien Prof.
Füger die erste Stelle ein, daneben die Professoren Mau-
rer, Kazig, Lampi und Zauner. Er machte hier noch eine
strenge Zeichnenschule durch, zeichnete nach Statuen und
Modellen und kopirte auf die Galerie. Von seinem fort-
schreitenden Streben müssen gute Proben in die Heimath
gelangt sein, da der Herzog Friederich Franz am 9. Ja-
nuar 1805 das dem jungen Suhrlandt weiter konferirte
Stipendium um jährlich 100 Thlr/ vermehrte. Dieser
rechtfertigte die fördernde Protection durch gesteigerte Lei-
stungen. Am 30. August 1805 wurde ihm bei der Aka-
demie von den für dieses Jahr ausgesetzten kleinen Prei-
sen im Malen nach Antiken der erste Preis zu Theil.
Unter den minder glücklichen Bewerbern war Stieler. Als
Aufgabe war gestellt: die bekannte „Statue des Diskus-
werfers" grau in Grau in Ocl zu malen. Auch bei der
Preisbewerbung des nächsten Jahres erhielt Suhrlandt
einen ersten Preis.
Die Erneuerung der zufällig auf der Dresdener Ga-
lerie gemachten Bekanntschaft mit der damals in Wien le-
benden russischen Fürstin Boris Galitzin verschaffte ihm
den Antrag, bei den Kindern derselben den Zeichnenunter-
richt zu übernehmen, und in Folge der hier gewonnenen
gesellschaftlichen Stellung fand er während des Jahres
1805 auch in den Häusern der übrigen Familien des ho-
hen russischen Adels in Wien, des Fürsten Dolgorucky,
der Fürstin Soltykoff, geborenen Dolgorucky, einer ausge-
zeichnete» Zeichnerin, der Gräfin Schuwaloff und der Toch-
ter derselben, der Fürstin Alexandrine Dietrichstein, als
Zeichner, als Portraiteur und als kunstgebildeter Gesell-
schafter Zutritt und vorthcilhafte Beschäftigung. Auf die
Nachricht von dem Siege der Franzosen bei Austerlitz löste
sich dieser Kreis auf. Die russischen Familien verließen
Wien. Das unserm Künstler besonders befreundete Haus
der Fürstin Galitzin — welche, in Begleitung des Erb-
prinzen Friedrich Ludwig vou Mecklenburg-
Schwerin, die Donau hinunter nach Ungarn eilte —
stand leer. So ward auch ihm die Entscheidung nahe ge-
legt, ob er bleiben oder jetzt der schon lange sein Gemüth
erfüllenden Sehnsucht nach Italien Raum geben solle.
Suhrlandt hatte um so größere Neigung zur Wan-
derung über die Alpen, als er in Wien eine gute Aussicht
ans Förderung und Empfehlung in der Kapitale der ita-
talienischen Kunst, in Rom, gewonnen hatte. Im Jahre
1805 brachte nämlich Antonio Canova ein ausgezeichne-
tes Werk seines Meißels, daö Grabmal der Erzherzogin
v. Oesterreich, Gemahlin des Herzogs Albert von Sachscn-
Teschen, selbst nach Wien, um dort dessen Aufstellung in
der Augustinerkirche zu leiten. Ein günstiger Zufall fügte
es, daß Suhrlandt — der nicht nur von seinem frühen
Studium des Französischen jetzt die Frucht erntete, son-
dern mit seiner gewöhnlichen zweckbcwußten Strebsamkeit
auch des Italienischen kundig geworden war — sich eines
TageS dem großen Bildhauer bei diesem Geschäfte als
Dolmetscher nützlich machen konnte. Canova erkannte
dies freundlich an und lud den jungen Maler ein, nach
Rom zu kommen.
Suhrland entschloß sich indessen, für jetzt noch in
Wien zu bleiben, wo es ihm auch ferner an Beschäftigung
nicht fehlte. So malte er z. B. im Jahre 1807 den Für-
sten Heinrich LIV. von Reuß-Lobenstein und dessen erste
Gemahlin, die Fürstin Marie, geborene Gräfin zu Stol-
berg-Wcrnigerode; — ferner den in dem genannten Jahre
nach Wien zurückgekehrtcn Professor und Galerie-Direktor
Peter Krafft, die Fürstinnen Lubomirska, Sapieha und
andere Personen des polnischen Adels. Auch vollendete
er in dieser Zeit ein großes Gemälde für Ludwigslust:
die (am 24. September 1803 verstorbene) Erbprinzessin-
zurückbleibenden Fähigkeiten in einer Weise, daß der Knabe
demselben Befriedigung verschaffen mußte. Er saß die
langen Winterabende in der kalten Malstube des Vaters
und machte autodiktatische Anfänge im Zeichnen, die sich
bald auf technisch regellose, aber in Betreff der Aehnlich-
keit glückliche Versuche im Vortraitiren erstreckten. Der
Vater hatte anfangs so wenig hiervon, wie von des Soh-
nes eifrigen Bemühungen zur Erlernung der französischen
Sprache, die er gleichfalls im Stillen als sein eigener
Lehrmeister betrieb, eine Ahnung. Erst als ihm Zeich-
nungen Rudolph's zu Gesichte kamen, die dessen Talent
unwiderleglich bezeugten, erthciltc er ihm regelrechte An-
leitung zum Zeichnen und Malen. Der junge Suh rlandt
portraitirte fleißig weiter und wußte dadurch, daß er meh-
rere herzogliche Kammerdiener bewog, ihm zu sitzen, und
sprechend ähnliche Portraits von ihnen zeichnete, die Auf-
merksamkeit des Herzogs Friedrich Franz auf sich zu ziehen.
Der Herzog gab ihm ein Stipendium von 150 Thlr.,
mit welchem der strebsame achtzehnjährige Kunstjünger nach
Dresden eilte, um hier für seinen Bildungstrieb neue
Nahrung zu finden. Unter den Professoren der Akademie
Schönau, Schubert, Seydelmann, Grassi machte er hier
die bedeutendsten Fortschritte. Er zeichnete nach Statuen
und übte sich im Malen durch Kopiren einer Anzahl von
Gemälden großer Meister auf der Galerie. Auch hatte
er das Glück, an dem Bibliothekar Tesdorf einen freund-
lichen Führer ans dem ihm bisher nur sehr unausreichlich
bekannten Gebiete derjenigen Wissenschaften zu finden, durch
deren Kenntniß dem idealen Streben des Künstlers ein
würdiger realer Inhalt vermittelt und ihm das richtige
Bewußtsein von dem Zusammenhänge seiner Kunst mit
dem Ganzen der Geistesbildung gesichert wird.
Auf Anrathen des tüchtigen Dresdner Malers Mat-
thäi ging Suhrlandt, versehen mit Tesdorf's Empfeh-
lung an den Baron von Provillier, einen einflußreichen
Kunstfreund in Wien, nach drei- bis vierjährigem Studium
in Dresden, im Oktober 1803 von dort nach der öster-
reichischen Hauptstadt, wozu auch sein gnädiger Herzog
Friedrich Franz, der ihm Johannis 1801 auf die beiden
Jahre von Ostern 1802/4 ein Stipendium von 250 Thlr.
verliehen, am 7. September 1803 seine Zustimmung er-
theilt hatte.
Aus dem fortgesetzten Studium der Winckelmann'schen
Schriften schöpfte er hier eine warme Liebe und Verehrung
für die bildende Kunst, und besonders für die antike Skulp-
tur, wie es denn als ein bemerkenswerthcr Zug in der
entwickelungsreichcn ersten Hälfte von Suhrlandt's
Künstlcrlcbcn hervortritt, daß er zu den ersten Bildhauern
der Epoche, den Wiedercrweckern der Knnst des Phidias
in dem modernen Europa, vorzugsweise in nahen Bezie-
hungen stand. Unter seinen Lehrern nahm in Wien Prof.
Füger die erste Stelle ein, daneben die Professoren Mau-
rer, Kazig, Lampi und Zauner. Er machte hier noch eine
strenge Zeichnenschule durch, zeichnete nach Statuen und
Modellen und kopirte auf die Galerie. Von seinem fort-
schreitenden Streben müssen gute Proben in die Heimath
gelangt sein, da der Herzog Friederich Franz am 9. Ja-
nuar 1805 das dem jungen Suhrlandt weiter konferirte
Stipendium um jährlich 100 Thlr/ vermehrte. Dieser
rechtfertigte die fördernde Protection durch gesteigerte Lei-
stungen. Am 30. August 1805 wurde ihm bei der Aka-
demie von den für dieses Jahr ausgesetzten kleinen Prei-
sen im Malen nach Antiken der erste Preis zu Theil.
Unter den minder glücklichen Bewerbern war Stieler. Als
Aufgabe war gestellt: die bekannte „Statue des Diskus-
werfers" grau in Grau in Ocl zu malen. Auch bei der
Preisbewerbung des nächsten Jahres erhielt Suhrlandt
einen ersten Preis.
Die Erneuerung der zufällig auf der Dresdener Ga-
lerie gemachten Bekanntschaft mit der damals in Wien le-
benden russischen Fürstin Boris Galitzin verschaffte ihm
den Antrag, bei den Kindern derselben den Zeichnenunter-
richt zu übernehmen, und in Folge der hier gewonnenen
gesellschaftlichen Stellung fand er während des Jahres
1805 auch in den Häusern der übrigen Familien des ho-
hen russischen Adels in Wien, des Fürsten Dolgorucky,
der Fürstin Soltykoff, geborenen Dolgorucky, einer ausge-
zeichnete» Zeichnerin, der Gräfin Schuwaloff und der Toch-
ter derselben, der Fürstin Alexandrine Dietrichstein, als
Zeichner, als Portraiteur und als kunstgebildeter Gesell-
schafter Zutritt und vorthcilhafte Beschäftigung. Auf die
Nachricht von dem Siege der Franzosen bei Austerlitz löste
sich dieser Kreis auf. Die russischen Familien verließen
Wien. Das unserm Künstler besonders befreundete Haus
der Fürstin Galitzin — welche, in Begleitung des Erb-
prinzen Friedrich Ludwig vou Mecklenburg-
Schwerin, die Donau hinunter nach Ungarn eilte —
stand leer. So ward auch ihm die Entscheidung nahe ge-
legt, ob er bleiben oder jetzt der schon lange sein Gemüth
erfüllenden Sehnsucht nach Italien Raum geben solle.
Suhrlandt hatte um so größere Neigung zur Wan-
derung über die Alpen, als er in Wien eine gute Aussicht
ans Förderung und Empfehlung in der Kapitale der ita-
talienischen Kunst, in Rom, gewonnen hatte. Im Jahre
1805 brachte nämlich Antonio Canova ein ausgezeichne-
tes Werk seines Meißels, daö Grabmal der Erzherzogin
v. Oesterreich, Gemahlin des Herzogs Albert von Sachscn-
Teschen, selbst nach Wien, um dort dessen Aufstellung in
der Augustinerkirche zu leiten. Ein günstiger Zufall fügte
es, daß Suhrlandt — der nicht nur von seinem frühen
Studium des Französischen jetzt die Frucht erntete, son-
dern mit seiner gewöhnlichen zweckbcwußten Strebsamkeit
auch des Italienischen kundig geworden war — sich eines
TageS dem großen Bildhauer bei diesem Geschäfte als
Dolmetscher nützlich machen konnte. Canova erkannte
dies freundlich an und lud den jungen Maler ein, nach
Rom zu kommen.
Suhrland entschloß sich indessen, für jetzt noch in
Wien zu bleiben, wo es ihm auch ferner an Beschäftigung
nicht fehlte. So malte er z. B. im Jahre 1807 den Für-
sten Heinrich LIV. von Reuß-Lobenstein und dessen erste
Gemahlin, die Fürstin Marie, geborene Gräfin zu Stol-
berg-Wcrnigerode; — ferner den in dem genannten Jahre
nach Wien zurückgekehrtcn Professor und Galerie-Direktor
Peter Krafft, die Fürstinnen Lubomirska, Sapieha und
andere Personen des polnischen Adels. Auch vollendete
er in dieser Zeit ein großes Gemälde für Ludwigslust:
die (am 24. September 1803 verstorbene) Erbprinzessin-